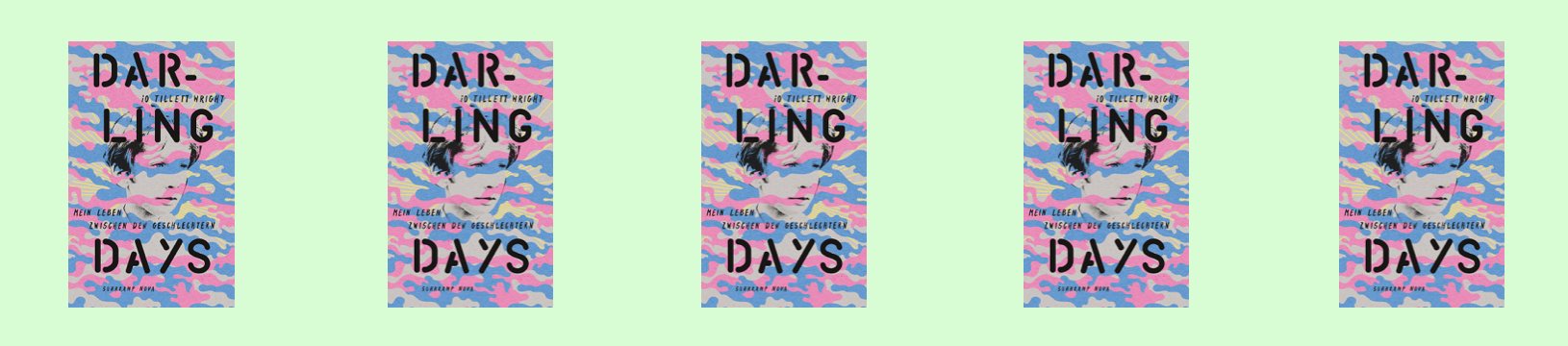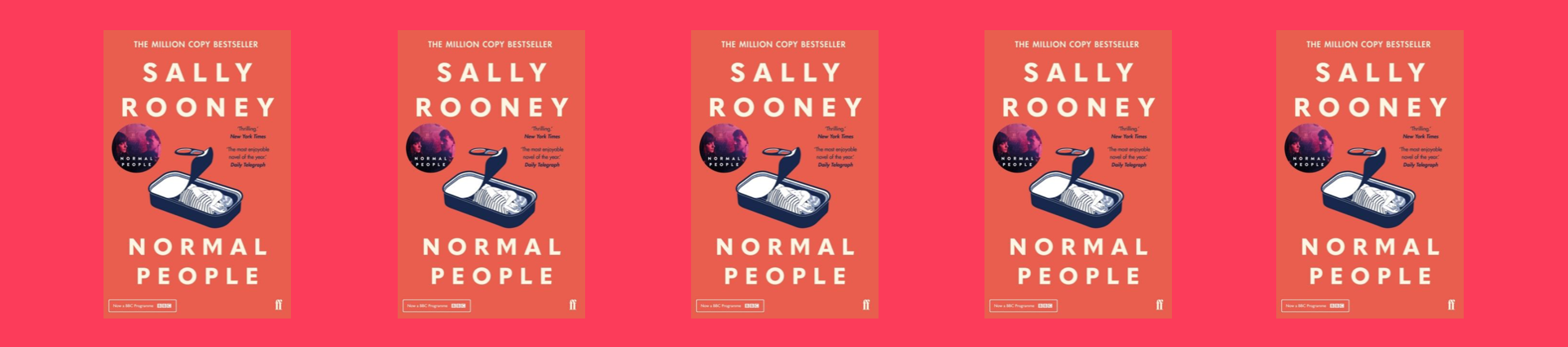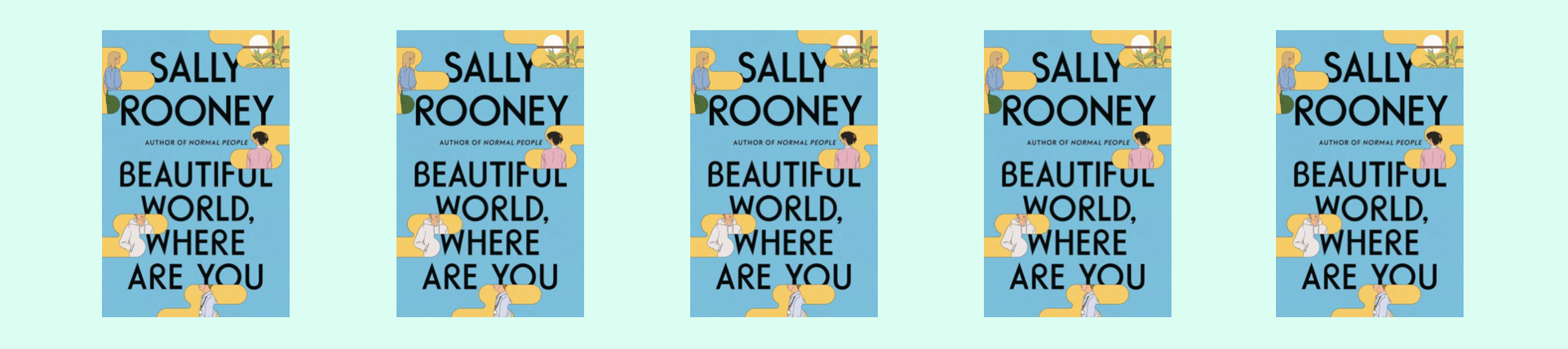Blog

Wodurch hebt sich eigentlich ein packender Krimi von allen anderen, gut recherchierten, bruchfreien, makellos konstruierten, aber absehbaren Konkurrenten ab?
weiter ...Diesen Bestsellern, die mit einem Strom von aktuellen Themen und raffinierten Wendungen die Story am Laufen halten und uns weiterlesen lassen, weil wir wissen wollen, wer es nun tat. Die beim Umblättern gleich auch noch einen Bildungsauftrag erfüllen und Insidertipps über die französische Küche etwa oder Fachwissen zum Permafrost zum besten geben. Die so konstruiert sind, wie Bestseller konstruiert sein müssen. Das ist nicht nichts. Fesseln jedoch, über dieses Whodunit und den malerischen Hintergrund hinaus, tun sie (mich) nicht.
Bei Monika Geier ist das anders. Sie weiss, wie man Krimis schreibt. Sie geht mit grosser Sorgfalt vor und richtet ihre Aufmerksamkeit auch auf die alltäglichen Dinge, auf diese Details, die gerne übersehen werden. Diese kleinen Gesten, die aus ihren literarischen Figuren Identifikationsfiguren machen, diesen Sinn für Räume und Atmosphäre, der Orte zu Filmszenen erweckt. Monika Geier hat ein Sensorium für alles Menschliche und sie lässt uns vergnüglich daran teilhaben. Im Grunde genommen zeigt sie auf, dass tief in uns allen eine schräge Person verborgen ist. Wir brauchen uns nur zuzuhören und uns über uns selber zu amüsieren. Das hat etwas Versöhnliches. Eigentlich nicht das, was ein Krimi normalerweise an Gefühlen hervorruft. Ihre Krimis tun das.

Die Baupläne von Geiers Romanen sind durchdacht, das Resultat stabil. Sie beachtet die Bauregeln, bezieht die Umgebung mit ein und verliert nie die Sicht aufs Ganze. Sie plant Details in den Innenausbau, hat das Gefühl für Mass und Proportion und eine gehörige Portion Spielwitz beim Bespielen der Räume. Vielleicht kann sie das, weil Schreiben eine unter anderen Tätigkeiten ist, mit denen sie den Lebensunterhalt ihrer Familie finanziert. Könnte es sein, dass die Freiheit im Schreiben so grösser wird, weil sie Vergleiche anstellen kann, von Erfahrungen ganz praktischer Art profitiert und diese neu interpretiert. Jeder Dialog sitzt, jeder Witz trifft den Kern der Sache. Sie kann Pointe. Sie braucht die Story nicht mit Infotainment aufzublähen. Sie lässt ihre Figuren reden und handeln und zeigt, worum es geht. Wahrscheinlich ist sie ein Naturtalent. Aber eines mit Ausdauer und Selbstreflexion.
Wenn ich eines ihrer Roman-Gebäude betrete, weiss ich nie, auf welcher Etage, aus welcher Nische sie zum Schluss das Kästchen mit dem grossen Geheimnis kramt. Ich lasse mich durch die Räume führen, nehme die Atmosphäre war, die Gerüche und Geräusche, den Lichteinfall. Ich blicke aus den Fenstern, sehe die Umgebung und stelle fest, die Autorin hat sogar an die Gartengestaltung gedacht. Und die Kühlschränke sind auch gefüllt. Aber nicht mit irgendwas, das zeitgeistig oder gegoogelt etwas hergibt. Da steht das, was da stehen muss. Weil es zu den Bewohner:innen passt.
Bei ihrem jüngsten Krimi, Antoniusfeuer, erschienen bei Ariadne, taucht sie tief ins Kirchenrecht ein. Sie knöpft sich den Satan vor und konstruiert einen spannenden Plot mit den gewohnt schrägen Figuren. Alte, Mittelalte und Junge. Alle mit Macken und Begabungen. Keine:r wird vorgeführt, doch auch niemand in Watte gepackt. In der Pole Position natürlich Bettina Boll, die alleinerziehende Teilzeitkriminalkommissarin aus der Pfalz. Am Anfang von Antoniusfeuer steht der Tod des Asylbewerbers Al Afghani. Am Anfang sieht das nach Rassismus aus. Am Anfang. Und am Ende sieht es nach ganz viel anderem aus. Und gäbe es da nicht Elle, die mutige, verschrobene und äusserst lebenspraktische Esoterikerin, dann sähe es nochmals ganz anders aus.
Dazwischen liegen kaputte Beziehungen, solche die einiges auszuhalten haben, unheimliche Nachbarn, vom richtigen Glauben Überzeugte und Pubertierende, die ihr Leben durchziehen. Oder es zumindest versuchen…
Monika Geier braucht keine Vergleiche zu anderen Bestsellerautor:innen. Sie kann sich jedes noch so heikle und angesagte Thema vorknöpfen, am Ende kommt immer ein Geier-Konstrukt raus. Todernst und hochvergnüglich sind sie allesamt.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.
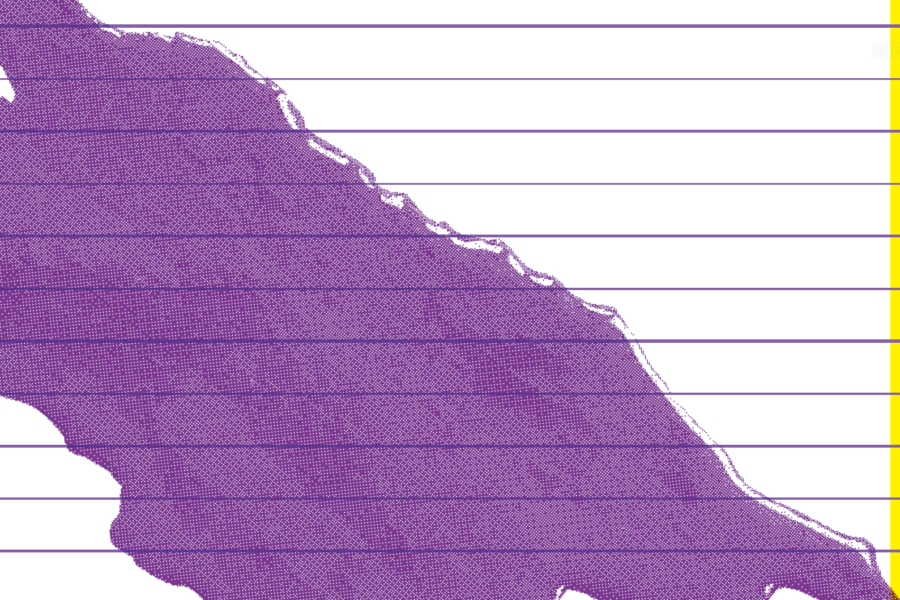
Kapitel eins beginnt mit Tilu dem Schriftsteller, Kapitel zwei mit Samsher Singh, dem Leiter des Polizeireviers, in Kapitel drei wird der Zuhälter Rambo Maity eingeführt und im vierten erfahren wir durch Lalees Mund so einiges über Mohayama, beide Sexarbeiterinnen. Und das sind noch nicht alle.
weiter ...Ich bin erst auf Seite 20 und bereits mitten im Kosmos von Shonagachi, Südostasiens grösstem Rotlichtviertel. Nach jedem weiteren Kapitel frage ich mich, ob ich mir noch eines dieser Häppchen gönnen soll. Oder ob ich mich dann um das Vergnügen bringe, zu geniessen, bevor die Sättigung mich träge macht.
Die Welt, die Rijula Das evoziert, ist prall gefüllt mit Leben, gutem und abgrundtief bösem, zärtlichem und gewalttätigem. Es stinkt erbärmlich darin und duftet verführerisch, es dröhnt und säuselt, ist stickig schwül und macht einen frösteln. Und doch sind da diese ewigen Momente. Diese jahrhundertealten immer gleichen Geschichten von Liebe und Loyalität, Unterdrückung und Befreiung. Wo ein beinahe ewiger Hauch die Zeit durchstreift, Luftspiegelungen von Orten des Glücks heranträgt, Orten, die aus dem Elend entstehen, weil genau dort die raren Glücksmomente so unglaublich flirren.

Irgendwann funktioniert das mit dem häppchenweisen Lesen nicht mehr. Der Appetit ist stärker. Der Mord ist zwar schon auf den ersten Seiten geschehen, doch wird immer deutlicher, dass jede Person, die etwas darüber weiss, in Gefahr ist. Lalee ist eine davon. Denn in Die Frauen von Shonagachi ist manches Leben nur solange von Wert, wie es widerstandslos Profit abwirft. Lalee lebt ein solches Leben. Als Prostituierte im Blauen Lotus, einem Bordell in Shonagachi, ist das Überleben ein täglicher Hochseilakt. Sie ist eine unter geschätzten 20 Mio. Sexarbeiter*innen – davon drei Viertel durch Menschenhandel zwangsrekrutiert – die dort ihren Beruf ausüben. Sie wird ihre eigene Geschichte nur uns Leser*innen anvertrauen. Allen anderen erzählt sie immer wieder eine andere. Und jede davon ist ebenso wahr und brutal, wie ihre eigene.
Rijula Das traut den Leser*innen einiges zu. Sie erzählt in vergnüglichem Stil vom gefährlichen Kampf der Sexarbeiter*innen auf ein menschenwürdiges Leben. Else Laudan, ihre deutsche Verlegerin bei Ariadne, die das Buch aus dem Englischen übersetzte, belässt viele Begriffe in Bangla, der Hauptsprache Bengalens und fügt ein Glossar zur Erläuterung an. Dem Lesefluss tut dies keinen Abbruch, denn vieles lässt sich erahnen.
Die Autorin zaubert Bilder herbei, evoziert Gefühle, lässt feine Bettwäsche in unseren Händen knistern und seidene Saris die Haut kitzeln. Treibt den Dampf von Fettgebackenem durch unsere Stuben und den Zigarettenrauch der wartenden Sexarbeiterinnen vor dem Bordell gleich hinterher. Sie erschafft mit ihren Dialogen lebendige Charaktere, versteht es, mittels Gesagtem oder nicht Gesagtem die Dynamik von Beziehungen zu verschieben und uns Lesende dabei köstlich zu unterhalten.
Ja, da sind diese Bösen. Die wirklich Bösen. Und daneben alle Anderen mit ihren guten und schlechten Seiten, die manipulieren, weg schauen oder gar nicht erst hin. Ausser der schmächtige Tilu, bedeutungsloser Autor erotischer Romänchen, wie er etwas mitleidig in die Geschichte eingeführt wird. Er ist der Antiheld im ganzen wirren Macht- Ohnmachtsgefüge, aus dem ein Entrinnen schier unmöglich scheint. Ausgerechnet er wird zum Rettungsanker, ausgerechnet er wird uns zeigen, was wahre Liebe ist.
Das letzte Drittel des Romans hat das Potential, Tageszeiten, Arbeitgeberinnen und den ganzen Rest an Terminen zum Teufel zu wünschen und einfach weiterzulesen. Himmel, lass sie es schaffen. Lass sie es gelingen.
Und dann ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Doch Rijula Das schiebt noch ein kleines Kapitel mit der Überschrift Einige Zeit davor…hinterher. Mit scherzenden Frauen, die rauchend vor dem Bordell auf Freier warten und von der Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben reden. Nicht alle werden den nächsten Tag überleben. Wir Lesenden wissen das. Deshalb glauben wir, dass sich solche Hoffnungen nie erfüllen werden. Doch was wissen wir eigentlich. Könnte es nicht sein, dass sich die Hoffnungen auf die grossen, gesellschaftlichen Veränderungen einfach noch nicht erfüllen.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Und was, wenn der Beweis von Jesu Existenz in einer Schatulle in einem französischen Chateau auf seine Entdeckung wartet?
weiter ...Der englische Originaltitel von Denise Minas jüngstem Noir Fester Glaube heisst Confidence. Vertrauen. Was wäre fester Glaube schon ohne Vertrauen? Diese beiden eng verknüpften Begriffe unterfüttern die atemlose Suche der True-crime-Podcasterin Anna McDonald und ihres Kollegen Fin Cohen nach der verschwundenen YouTuberin Lisa Lee, die schliesslich zur Jagd nach einem wertvollen religiösen Artefakt wird.
Lisa Lee steigt in verlassene Häuser ein – Urban Exploring nennt sich das – und stellt die Filme in Echtzeit auf YouTube. Dass sie dabei in einem französischen Château auf eine begehrte religiöse Schatulle stösst, die aus der Zeit von Jesu Kreuzigung stammen soll, ist ein sehr dummer und lebensgefährlicher Zufall. Die Jagd auf sie und diese Schatulle beginnt, denn die soll den Beweis für Jesu Existenz enthalten. Anna und ihr Kollege Fin stossen auf Lisas Verschwinden und machen sich ebenfalls auf die Suche nach ihr. Ihr Trip führt sie durch Europa und endet schliesslich in Paris an einer Kunstauktion, an der die Schatulle versteigert wird. Über zehn atemlose Seiten hinweg werden wir Zeuginnen einer Auktion, an der sich die Bietenden an Eleganz und Habgier gegenseitig selber unerbittlich überbieten.

Denise Mina beginnt ihre Story mit den alltäglichen Katastrophen von Anna und Fin, die über Patchworkbeziehungen miteinander verhängt sind, schneidet Annas Vergangenheit an, die sie ihren beiden Teenagertöchtern lieber ersparen würde und lässt die beiden schliesslich in diese halsbrecherische Geschichte schlittern. Dabei hält sie uns am Gängelband mit dem was den Plot eines Noir spannend macht: Wer erzählt welchen Teil der Wahrheit und warum.
Die Story zieht einen Rattenschwanz an Geschichte und Geschichten hinter sich her. Sie wühlt in der Vergangenheit hinter dem Eisernen Vorhang, flicht mysteriöse Priester und andere Kriminelle in die Jagd nach Geld und Macht in die Handlung ein und lässt im Hintergrund eine äusserst mächtige und skrupellose Amerikanerin die Fäden ziehen. Und dann ist da noch dieser südafrikanische Drogenschmuggler Bram Van Wyk. Er hat etwas von einem abgewrackten Rockstar und bringt zweifelhaften 80iger-Glam à la Miami Vice und einiges an Tempo in die Geschichte.
Denis Mina erzählt spannend, leicht und mit einem Mass an Ironie, die die Story erträglich macht aber nichts verballhornt. Überhaupt. Denise Mina muss eine genaue Beobachterin sein und sie beherrscht ein beachtliches sprachliches Instrumentarium, dies literarisch umzusetzen. Ihre Figuren bewegen sich lebendig durch die Story. Man nimmt ihnen ihre Sprache, ihre Gesten, ihr Verhalten ab und unterhält sich dabei köstlich.
Der Showdown schliesslich hat sich gewaschen, ist schauerlich und abgespact zugleich und zum Schluss stellt sich Anna doch noch der drängendsten Frage ihrer Tochter zu ihrer verdrängten Vergangenheit. Ja und auch unsere drängendste Frage zum Schluss, nämlich die, was die mysteriöse Schatulle nun tatsächlich enthält, wird beantwortet. Und die Antwort ist etwa so simpel, wie die nach dem Sinn des Lebens im Kultbuch Per Anhalter durch die Galaxis: Nämlich eine Banalität mit Wert.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Populäre Kunst, die aufklärt, bildet und sich mit Charisma und gutem Erzählen gegen Unterdrückung und Unsichtbarmachung wehrt – das ist zu 100% genau meine Baustelle.»
weiter ...Das sagt Else Laudan 2019 in einem Interview im Fachbuchjournal. Sie ist Herausgeberin der Ariadne-Reihe, einem feministischen Kulturprojekt beim Argumentverlag, das seit 1988 Politkrimis und Noirs verlegt.
Schon bequem, das. Sich einfach auf den Ariadne-Verlag verlassen können. Natürlich sind Sprache, Plot und Setting der Krimis immer noch Geschmackssache und die Auseinandersetzung mit dem Inhalt ist nicht immer bequem. Doch allesamt sind sie ein Garant für literarische Qualität. Ein knappes Drittel der Krimiliteratur im Wyborada-Archiv wurde in der Ariadne-Reihe herausgegeben. Fragt sich, welcher andere Verlag den Mut gehabt hätte, feministische Krimikultur ins Programm aufzunehmen, oder ob viele gar nie geschrieben worden wären, weil die Autorinnen von vornherein dachten, sie kämen nirgends unter.
Mag sein, dass das marxistisch-feministische Programm des Argument-Verlags der Ariadne-Reihe im Literaturbetrieb zu mehr Gewicht verholfen hat. Anhängsel war sie jedoch nie. Und diese gut dreissig Jahre, die Ariadne nun auf dem Buckel hat, haben sich gelohnt. Der Verlag und seine Krimikultur werden ernst genommen.

Ich lese Krimis seit meiner Jugend. In den Siebzigern las ich sämtliche Detektivgeschichten aus der Dorfschulbibliothek. Dann entdeckte ich Glauser. 1988, als Ariadne gegründet wurde, war ich wahrscheinlich bei Ambler, Chandler, Hammett und Macdonald angelangt. Und plötzlich tauchte Sara Paretsky auf und in ihrem Fahrwasser Linda Barnes. In deren Krimis waren hartgesottene Privatdetektivinnen am Werk, die ihren Job liebten, Und zwar nicht aus Selbstermächtigung, weil sie aus einer Opferrolle ausbrechen mussten. Nein, sie klärten Verbrechen auf, weil dieser Job ihnen Spass machte. Dass sie dabei dieselben Mittel anwendeten, wie ihre Kollegen, war nicht weiter erstaunlich. Mir Krimileserin blieben als Identifikation bis dahin nur die männlichen Marlows, Spades und Archers, denn Frauen waren entweder nur Beiwerk oder Opfer. So war es ein leichtes, mich auf diese toughen Weiber einzulassen. Mittlerweile ist das Psychogramm der Heldinnen glücklicherweise wesentlich diverser.
Else Laudan nahm das Genre von Anfang an ernst und sah das Potential, das in der Krimiliteratur steckt. Für sie machen diese Autorinnen die Welt besser und beackern dafür superkreativ das klügste, beweglichste und zugleich niedrigschwelligste Genre – Krimis zeigen ihrer Ansicht nach die Bruchstellen und für sie steckt die ganze Welt in diesen Romanen und alle können sie mit Lust lesen – für so ein Projekt ist ihr keine Hürde zu hoch (nachzulesen auf buchmarkt.de).
Komplexe politische und gesellschaftliche Themen lassen sich über diesen Unterhaltungskanal einfach transportieren. Sie bleiben nicht auf theoretische Diskurse beschränkt, sondern werden eins zu eins über eine brutale, dramatische, ungerechte oder wie auch immer geartete Wirklichkeit beschrieben.
Else Laudan hat mit der Ariadne-Reihe den Anspruch, intelligente, gut gemachte feministische Krimiliteratur zu verlegen. Der Fokus liegt dabei immer auf politischen und sozialkritischen Themen. Literatur von unten, von Frauen geschrieben, weil den Frauen bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein – und auch heute noch – die Erzählstimme verweigert wurde.
Wer nicht nur Spannung und das Whodunit im Krimigenre sucht, sondern auch gesellschaftskritische Themen und deren unerwartete Zusammenhänge in intelligenten Plots verpackt lesen will, der bietet Ariadne den richtigen Stoff. Das Genre boomt, und für Else Laudan ist noch lange nicht Schluss. Die Krisen der Gegenwart verlangen eine neue Sicht auf die Entwicklungen. Intelligente Krimikultur kann das bieten. Und erst noch barrierefrei, wie sie sagt.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Kennen Sie das? Sie lesen gerade dieses Buch, vielleicht ist es Zufall, vielleicht interessiert Sie die Thematik oder Sie brauchen einfach Lesefutter. Sie sind mittendrin und dann fliegt Ihnen der Plot, den sie gerade lesen, aus dem News-Ticker eines Nachrichtenportals um die Ohren.
weiter ...Am Morgen des 27. Juni 2023 wird der 17 jährige Nahel bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre von einem Streifenpolizisten erschossen. Die Begründung, dass der Polizist in Notwehr gehandelt habe, erweist sich als haltlos. Das zeigt das Video einer Passantin. Darauf folgen tagelange Krawalle.
Ich lese zur selben Zeit den Krimi «Einschlägig bekannt» der französischen Autorin Dominique Manotti, erschienen 2011 im Ariadneverlag. Dem Krimi liegen die Unruhen von 2005 zugrunde. Eingewoben sind tatsächliche Ereignissen, die sich zwischen 2002 und 2005 innerhalb des französischen Polizeiapparats abgespielt haben.

Zum Beispiel diese Passage: Ein Team der BAC (Brigade anti-criminalité) kehrt von einem Einsatz ins Kommissariat einer Pariser Banlieue zurück. Sie haben zwei Jugendliche unter fingierten Beschuldigungen festgenommen. Paturel, der äusserst korrupte und zynische King der Bacmen scheint sehr mit sich zufrieden.
«‹Zweimal Beamtenbeleidigung, die Bacmen retten die Kommissariatsstatistik mal wieder im Alleingang. Wenn ihr uns nicht hättet, faule Bande…› Bis der Wachhabende, der sich über den vor einer Wand zusammengesunkenen und erneut kotzenden Verletzten beugt, zu ihm sagt: ‹King, hast du dir den Jungen mal angesehen? Ist in ziemlich schlechtem Zustand.›»
Auch Ahmed aus dem Krimi wird durch einen Akt der Polizeiwillkür sterben. Allein die Kriminalstatistik zählt.
Die 1942 geborene Historikerin Manotti wurde mit dem Algerienkrieg politisiert, war militante Gewerkschafterin bei der CFDT, dem grössten Gewerkschaftsbund Frankreichs und unterrichtete Geschichte an verschiedenen Gymnasien und Universitäten im Raum Paris. Mit 50 Jahren schrieb sie ihren ersten Krimi. Sie webt gekonnt komplexe Strukturen in ihre Geschichten und verpasst ihren Figuren eine glaubwürdige Biographie. Ihr Stil ist knapp und trocken, eher berichtend als erzählend. Die Charaktere sind in ihren Rollen gefangen. Manchmal verlässt sie das Glück, manchmal nehmen sie irgendwo die falsche Abzweigung. So werden sie zu Teilen eines korrupten Systems, stützen es und manche können sich nicht mehr ohne Kollateralschaden daraus befreien. Das Leben nimmt seinen Gang und die Ausflüchte, Lügen und Begründungen passen sich dem eingeschlagenen Weg an.
«Einschlägig bekannt» handelt unter anderem von Korruption, Rassismus, Immobilienspekulation oder Prostitution. Was Manottis Romane in feministischer Hinsicht interessant macht, ist die Art, den Protagonistinnen eine starke Stimme zu geben, sie ohne Ressentiments oder Verklärung agieren zu lassen. Sie sind nicht besser oder schlechter als ihre Kollegen. Sie behaupten sich innerhalb einer männlichen Hierarchie, wenn nötig auch mit Gewalt. Auch wenn diese Form der Emanzipation die herrschenden Verhältnisse nur zementiert.
Kommissarin Le Muir zum Beispiel kennt sich mit den Spielarten der Macht bestens aus und hat nicht im Sinn, sich aus ihrer Stellung verdrängen zu lassen. Sie ist eine rücksichtslose Manipulatorin. Sie schaut, dass die Kriminalstatistik ihres Kommissariats stimmt, dass der Innenminister wiedergewählt wird, dass die Immobilienhaie ihre Geschäfte abwickeln können. Dabei geht sie über Leichen. Ihre Gegenspielerin Noria Ghozali, Kommissarin beim Nachrichtendienst RG, versucht, diese Machenschaften aufzudecken und dabei halbwegs integer zu bleiben. Doch auch sie weiss sich kreativer Methoden zu bedienen und manipuliert Beweise.
«Einschlägig bekannt» endet ohne Illusionen. Ermittlerin Ghozali kommt der Wahrheit sehr nahe, aber ihr fehlen die Mittel, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Realismus statt Happy End. Die Verlierer:innen sind zahlreich. Noria Ghozali gehört allerdings nicht dazu. Sie hat wohl auf ein Happy End gesetzt, aber erwartet hat sie es nicht wirklich.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Ich bin eine Mörderin / Ich bin keine Mörderin / Acht Kugeln / Eineinhalb Magazine / Eine Mörderin, viele Tode / drei Jahre Jugendknast, / Trauma lebenslänglich / Ich würde es jederzeit wieder tun»
weiter ...In ihrem Roman «Leicht wie Blei», erzählt Lena Elfrath die erschütternde Geschichte eines jahrelangen Kindesmissbrauchs. Nur indem das Opfer schliesslich zur Täterin wird, kann es sich und seine Geschwister erlösen. Erschienen ist der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, 2022 in der «Edition W».

Emma, so heisst die Protagonistin, wird mit vier Jahren zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Mit vier Jahren wird Emma vom Kleinkind zur immer verfügbaren Frau. Sie hat die Worte für Vater und Mutter aus ihrem Vokabular getilgt. Sie spricht nur noch vom «Mann» und der «Frau». Sie wird nie erleben, was es heisst, Kind zu sein. Ihre Mutter betäubt sich mit Alkohol und Tabletten. Und eines Tages ist sie ganz weg.
Mit sechzehn erschiesst Emma ihren Vater, als er beginnt, sich mehr und mehr für seine einjährige Tochter zu interessieren. Für Emma gibt es nur diesen einen Ausweg um die kleine Schwester vor demselben Schicksal zu bewahren. Es ist keine Tat im Affekt, denn Emma lädt das leer gefeuerte Magazin der Waffe nach und schiesst weiter. Das Urteil lautet denn auch 300 Tage Jugendhaft.
Der Roman führt uns durch Emmas Haftalltag. Chronologisch erzählt sie aus der Ich-Perspektive vom «Tag 1» bis zum Tag ihrer Entlassung. Während ihrer Gefangenschaft erlebt sie zum ersten Mal so etwas wie Sicherheit. Die Türen hier haben Schlösser, im Gegensatz zu denen zu Hause. Ihr Schutz jedoch ist unvollständig. Die Rückblenden auf das erlebte Martyrium, die sie immer wieder heimsuchen, können auch verschlossene Türen nicht fernhalten. Die erinnerten Passagen lässt Lena Elfrath ihre Protagonistin in der 3. Person erzählen. Die Abspaltung vom «Ich» der Gegenwart zum «Sie» der Vergangenheit ermöglicht es Emma, dass Geschehene in seiner Ungeheuerlichkeit überhaupt erst auszusprechen. «Nacht für Nacht lag Emma wach und wartete darauf, dass der Mann durch die Tür treten und sich zu ihr legen würde. Wenn der Moment gekommen war, liess die Angst von ihr ab. Dann musste Emma sich nur noch darauf konzentrieren, auszuhalten.»
Diese Rückblenden basieren auf tatsächlichen Gesprächen, die Lena Elfrath mit «Emma» führte. Der Rest der Erzählung ist Fiktion. Dass die Rahmenhandlung in der Haftanstalt manchmal etwas konstruiert wirkt, sieht man der Autorin nach. Die Gespräche und Interaktionen unter den Insassinnen könnten als Wege gelesen werden, wie versehrte Frauen sich solidarisieren und gegenseitig stützen. Wie sie gemeinsam Schritte in Richtung Befreiung und Normalität unternehmen.
Der Roman erzählt von der Selbstermächtigung einer jungen Frau. Er erzählt vom Tatort Familie und darüber, wie die Umgebung wegschaut. Wie die Gesellschaft männlichen Machtmissbrauch deckt und Frauen nur aus ihrer aufgezwungenen Opferrolle herausfinden, indem sie «kriminell» werden.
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

«Allmachtsdackel», erschienen 2007 im Argument Verlag, ist ein rasant und kenntnisreich geschriebener, wortwitziger Krimi, in dem es um ausgebüxte Rindviecher, protestantische Patriarchen und eine Meisterin im «Bibelfechten» geht.
weiter ...Christine Lehmann hat keine Scheu vor plakativen Sprachbildern und rabenschwarzem Humor. Sie kann es sich leisten, denn sie ist gut darin. Mit ihrer hartgesottenen, selbstironischen Heldin, der Schwabenreporterin Lisa Nerz, hat sie eine Figur erschaffen, die sich keinen Deut um Rollenbilder schert und was andere von ihr halten.
Eigentlich ist Lisa Nerz mit ihrem Gefährten, dem Staatsanwalt Richard Weber und Rauhaardackel Cipión zum Essen verabredet. Doch beim Aperitif erreicht sie die Nachricht, dass Webers Vater das Zeitliche gesegnet hat. Und so fahren die drei auf die Schwäbische Alb und der Albtraum beginnt. Lisa zweifelt bald an der offiziellen Todesursache des Patriarchen, was Unruhe ins beschauliche Balingen bringt. Dann taucht auch schon eine weitere Leiche auf.

Virtuos beschreibt Christine Lehmann die Verstrickungen im Weberschen Mikrokosmos, in dem das von der Gesellschaft honorierte Familienoberhaupt sein bigottes und perfides Machtspiel trieb. Nicht erstaunlich, dass über dessen Tod niemand wirklich traurig ist. Auch nicht seine betagte Schwester Anna: «Und desmal ka mi der Martinus net schoich anblicke, weil i z’viel ess. Fett ischer worre uff seine alde Dag!»
Es kriegen überhaupt alle ihr Fett weg. Es geht um Misogynie und Homophobie, ums Erben, um unterdrückte Leidenschaften und rigide Glaubensvorstellungen. Die Frauen sind nicht einfach Opfer und die Männer Täter. Die Rollenbilder sind zwar noch in etlichen Köpfen zementiert, doch wo Gott hockt, ist auch im ländlichen Schwaben nicht mehr so eindeutig auszumachen. Lisa Nerz pfeift sowieso darauf. Darauf, dass Staatsanwalt Webers Mutter Lotte sie trotz «fehlender Uniform» mit sturer Ignoranz zum Chauffeur ihres Sohnes degradiert. Und dass es zwischen Lisa und Webers Cousine, dem «Bäsle» Barbara (vier Kinder und ein Mann), gewaltig funkt, ist halt so. Doch damit gerät ihre eigene Beziehung zu Weber ins Trudeln. Lisa muss sich zwischen den beiden entscheiden, was so einfach nicht ist.
Christine Lehmanns androgyne Protagonistin Lisa Nerz verbreitet mit schnoddriglockerer Zunge einen unwiderstehlichen schwäbischen Charme. Sie treibt auch in ihrem 6. Fall ihr neugieriges Unwesen, dröselt die Verflechtungen im Familiengefüge auf, verdächtigt alle und jede und landet wortwörtlich im Grab. «Allmachtsdackel» ist ein Krimi für alle, die sinnliche, bildhafte Sprache mögen und sich nicht vor Landmaschinentoten fürchten.
Über die Autorin:
Judith Gamma Prost (*1963), arbeitet in einem Bioladen in St. Gallen und sieht in ihrer Arbeit durchaus Parallelen zum Krimi. So macht sie sich beständig die Hände schmutzig, braucht einen gesunden Sinn fürs Verderbliche und kann die Frage nach ethisch richtigem Verhalten auch nicht immer so einfach beantworten.

Salome Heiniger steht Krimis eher kritisch und vorurteilsvoll gegenüber; kann sie sich nach der Lektüre eines feministischen Krimis doch noch für das Genre begeistern?
weiter ...Ich bin, was Krimis betrifft, eine blutige Anfängerin. Ganz zu schweigen von Krimis aus den 90er-Jahren. Meine ersten Erinnerungen setzen irgendwann in den frühen 00er-Jahren ein. Dementsprechend hatte ich nie das Vergnügen, einen Walk-Man in der Tasche zu führen oder eine dehnbare Tattoo-Kette um den Hals zu tragen.
Bezüglich des Genres «Krimi» bin ich etwas voreingenommen: Viele Bilder schwirren in meinem Kopf herum, von pfeifenrauchenden Detektiven mit Wollmützen oder traumatisierten Kommissaren, die zum x-ten Mal böse Verbrecher*innen jagen müssen. Schauermärchen für Erwachsene.
Fairerweise muss ich zugeben, mich nie tiefergehend mit dem Genre «Krimi» auseinandergesetzt zu haben. Stattdessen lese ich lieber feministische Literatur, obwohl sich diese ja auch mit den Misständen unserer Gesellschaft beschäftigen. Warum sollte ich es also nicht mal versuchen? Im Bibliothektsarchiv der Wyborada, stolpere ich schliesslich über einen feministischen Kriminalroman, der mit altbackenen Klischees bricht. Jedenfalls grösstenteils.

Worum geht es?
New Orleans, 90er-Jahre: Privatdetektivin Micky Knight kämpft nicht bloss gegen das Verbrechen, sondern führt eine toxische Beziehung mit einem grösser werdenden Stapel unbezahlter Rechnungen. Ganz im Gegenteil zu ihrer reichen Freundin. Die finanzielle Ungleichheit und hartnäckige Schatten ihrer Vergangenheit verkomplizieren das Liebesleben der Ermittlerin. Ganz zu schweigen davon, dass sich ein vermeintlich schneller Job als Bodyguard zu einem haarsträubenden Fall entwickelt, der Micky bis in die Tiefen des organisierten Verbrechens in New Orleans führt.
Sozialkritik statt Blutvergiessen
Im dritten Band der Krimireihe wagt Autorin J.M Redmann einen ausgiebigen Blick in die seelischen Abgründe der Menschen, legt den Finger auf ihre Ängste, enthüllt die chronische Einsamkeit der Menschen. Feministische Themen packt sie in eine Kriminalgeschichte und streift dabei manch grosses Thema ihrer Zeit: Rassismus, Queer- und Frauenfeindlichkeit, Machtgefälle zwischen Ober- und Unterschicht, die Schrecken der Aids-Pandemie.
Buch aus der Retroperspektive
Redmann schildert das verzweifelte Versteckspiel, das manche ihrer queeren Figuren spielen müssen, um nicht ihren Job, Spendengelder, Erbschaften oder gar ihr Leben zu verlieren. Damit thematisiert sie in ihrem Roman ein Thema, das in der Mainstreamliteratur der 80er- und 90er-Jahren zu wenig Beachtung fand. Fast 27 Jahre später lesen sich einige ihrer Figuren etwas kritischer (nicht jede lesbische Frau hat eine Katze oder wurde als Kind missbraucht) und die Leserin stolpert über teils etwas schwammigen Konsens in einigen Sexszenen. Zudem wäre eine allgemeine Triggerwarnung angebracht gewesen, denn das Buch thematisiert unter anderem sexuellen Missbrauch an Minderjährigen.
Fazit
Wer auf eine trashige, lesbische Liebesgeschichte mit einer Prise Verbrechen und lilafarbenem Happy End hofft, ist hier definitiv an der falschen Adresse. Redmann hat keinen Roman geschrieben, der trügerische Illusionen weckt: «Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe», so die Protagonistin Micky Knight. Ein nüchternes Fazit, ob das so mit mir und Krimis noch was wird? Wir werden sehen.
Das Buch ist 1995 im Argument Verlag + Ariadne erschienen. Es kann – wie viele weiter feministische Bücher – in der Bibliothek Wyborada ausgeliehen werden.
Autorin: Salome Heiniger (24 Jahre alt), ehem. Hospitantin (Oktober 2021), studiert Organisationskommunikation an der ZHAW in Winterthur. Sie geht gerne wandern, setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein und interessiert sich für alles, was mit Literatur zu tun hat.

Dass der von (männlichen) Autoren und Figuren geprägte Krimi eine kleine Prise Feminismus mehr als verträgt, beweist Sara Paretsky mit ihrem 1982 veröffentlichten Roman «Schadenersatz».
weiter ...Die toughe Privatdetektivin V.I. Warshawski wird mit der Suche nach einer verschwundenen jungen Frau beauftragt. Diese lösbar erscheinende Aufgabe verwandelt sich jedoch schon bald in die Aufklärung zweier Morde, die auch das Leben der Detektivin selbst in Gefahr zu bringen droht. V.I. Warshawskis Untersuchungen führen sie dabei in der Großstadt Chicago von der Universität durch höchste Chefetagen bis zu bekannten Gesichtern des organisierten Verbrechens. Zwischen Versicherungsbetrug, familiären Auseinandersetzungen und auseinandergenommenen Wohnungen steigert sich eine harmlose Vermisstensuche in eine halsbrecherische Jagd nach Aufklärung.
Spannung ist vorprogrammiert, und Paretsky vermag es, wie nebenbei, dem männlich geprägten Krimi-Genre einen Spiegel vorzusetzen. Aus der Ich-Perspektive der Privatdetektivin erzählt wird V.I. Warshawski allzu oft durch Männer von ihrem entschiedenen Vorhaben abgeraten. Dafür rücken mit der Verschollenen, einer mütterlich fürsorglichen Freundin und einer beistandssuchenden Jugendlichen aber gerade absichtlich Überhörte und Übersehene in den Fokus.

Als Feministinnen treten lediglich die Angehörigen einer Hochschulgruppe in Erscheinung, in selbstgenähten Jeansröcken und allseits kritischer Haltung, auch V.I. Wahrshawski und ihren Ermittlungen gegenüber. So bleibt der Feminismus in «Schadenersatz» ein gleichermassen subtiler wie elementarer – ein diskutabler Begriff und gleichzeitig unumgängliche Notwendigkeit im Dasein als weibliche Protagonistin eines Kriminalromans. Was Paretsky dabei gelingt, ist weniger die Neuerfindung eines Genres, als vielmehr eine produktive Anerkennung: Anerkennung, insofern das Frau-Sein V.I. Warshawskis genauso wenig gerechtfertigt werden muss wie die Genre-Muster, denen sich die Spannung und das Mitfiebern bei Mordfällen verdanken. Und produktiv, da sich so Neues und Bekanntes stets gegenseitig erhellen und die genüssliche Krimi-Lektüre sich ganz nebenbei einiger ihrer verstaubtesten Konventionen entledigt. Ein angeschossener Liebhaber kann im Vergleich zu einem zerbrochenen Glas kaum der Rede wert sein – «Spiegelbilder der geltenden Sozialmoral»?
«Schadenersatz» ist der erste Fall für V.I. Warshawski, die bis heute in zahlreichen weiteren Kriminalromanen Sara Paretskys ermittelt. In der Bibliothek Wyborada finden Sie unter anderem: «Deadlock», «Ihr wahrer Name», «Kritische Masse» und «Eine für Alle».
Sara Paretsky (geb. 1947) ist Mitbegründerin der 1986 ins Leben gerufenen Organisation «Sisters in Crime», die sich der Förderung von Frauen verfasster Krimis widmet.
Jakob Reeg (24) ist ehemaliger Hospitant (August/September 2021) und frisch gebackener Bachelor der Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft in Konstanz. Am liebsten liest er aus dem Schatten, den ein Buch am See spendet.

Was macht eine Krimi zu einem feministischen Krimi, was macht einen Roman zu einem feministischen Roman? Eine Annäherung.
weiter ...An meinem ersten Arbeitstag in der Bibliothek Wyborada, wurde mir der Auftrag erteilt, eine Leseempfehlung zu einem feministischen Krimi zu verfassen. Ich bin keine erprobte Krimileserin und wusste gar nicht, wonach ich suchen, womit ich anfangen sollte. Ein feministischer Krimi, was ist das überhaupt?
Dem liegt die grundsätzliche Frage des feministischen Schreibens zu Grunde. Was ist ein feministischer Text? Ist es ein Text, der eine emanzipierte Frauenfigur beschreibt? Ist es ein Text, der das patriarchale System thematisiert und kritisiert? Ist es ein Text, der von einer Feministin verfasst wurde? (Kurze Vorwarnung: Ich habe keine klare Antwort auf diese Fragen.)
Es scheint auch unter Autor:innen unterschiedliche Meinungen zu geben, was alles in einen feministischen Krimi gehört. Es wird zumindest unterschiedlich umgesetzt und aktiv oder weniger aktiv als feministischer Krimi betitelt und beworben.
Isabel Rohner schreibt sogenannte feministische Kicherkrimis, die auch ganz viel feministische Theorie beinhalten. Ich habe in Gretchens Rache hineingelesen: Die Hauptfigur, Linn Kegel, ist selbst Autorin von feministischen Kicherkrimis. An einem Pressewochenende im Spreewald kommt es zu einem Mord. Dabei wird immer wieder explizit auf Sexismus in der Buchbranche hingewiesen und auch sexuelle Belästigung wird früh im Buch thematisiert. Diese teilweise kolumnistische Art, Feminismus in einen Krimi zu integrieren, und den Krimi ganz aktiv als feministisch zu Vermarkten ist eine Variante.

Petra Ivanov hingegen schreibt den Feminismus nicht auf den Buchrücken, bei ihr steht Gesellschaftskritik zu diversen Themen wie Extremismus und mentale Gesundheit. Aber als ich Entführung gelesen habe, bin ich starken weiblichen, fragilen männlichen und allgemein sehr vielschichtigen Figuren begegnet. Diese Vielschichtigkeit und das Brechen von Geschlechterstereotypen gehört für mich auch zur feministischen Literatur dazu. Und gerade Extremismus bei jungen Männern (was in Entführung das Hauptthema ist) kann auch als ein Problem von einem zu verteidigenden Männlichkeitsbild gelesen werden. Franziska Schutzbach leitet in ihren Buch Die Erschöpfung der Frauen her, wie misogyne Denkmuster Hass und Mord an Frauen «als Heldentat erscheinen zu lassen» (S. 131).
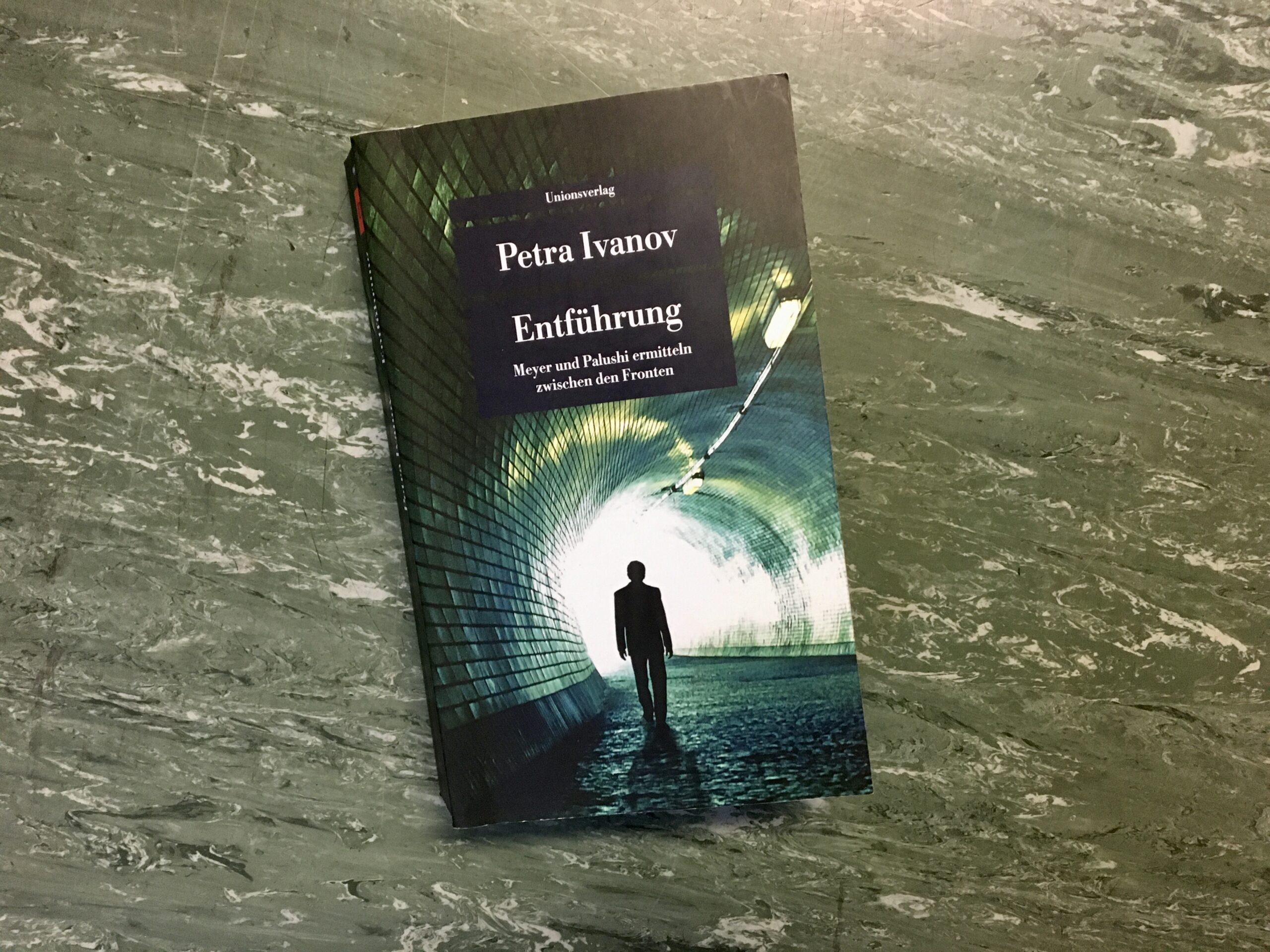
Krimi ist ein sozialkritisches Genre. Es geht um die Ängste und inneren Abgründe von Menschen. Es geht darum, wie sich Verbrechen am Rande der Gesellschaft organisiert und wie es hinter den Fassaden aussieht. Dass feministische Themen in einem sozialkritischen Genre verhandelt werden, scheint mir naheliegend und sinnvoll. Denn erwiesener Massen erleben Frauen soziale Ungleichheiten, sexistische Übergriffe und sexualisierte Gewalt, der Kriminalroman ist also ein passendes Genre um auf Sexismus und Gewalt an Frauen hinzuweisen. Die Darstellungen von Gewalt an Frauen in Krimis ist tatsächlich weit verbreitet. Für mich ist wichtig zu betonen, dass feministische Krimis Gewalt an Frauen und Femizide zwar durchaus thematisieren sollen, dabei aber nicht voyeuristische Darstellungen dieser Gewalt enthalten dürfen.
Es geht also nicht darum, soziale Ungerechtigkeit anhand von Gewalt an Frauen darzustellen und diese Gewaltdarstellung als Verkaufsfaktor zu nutzen, sondern darum, patriarchale, rassistischen, klassistische Strukturen sowie Diskriminierung aufgrund von Sexualität und Religionszugehörigkeit zu thematisieren.
Feminismus muss eben immer – auch im Krimi – intersektional sein und gesellschaftliche Strukturen in ihrer Gesamtheit erkennen und kritisieren. Dabei kann kein einzelner Kriminalroman die Gesellschaft ganzheitlich abbilden, deshalb ist wichtig, dass es viele unterschiedliche feministische Krimis gibt. Solche, die Sexismus direkt ansprechen, wie Isabel Rohner es in ihren Krimis tut; andere, die das Thema eher subtil angehen und zudem noch weitere gesellschaftliche Probleme thematisieren, wie das bei Petra Ivanov der Fall ist.
Quellen:
Isabelle Rohner: Gretchens Rache.
Petra Ivanov: Entführung.
Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen, wider die weibliche Verfügbarkeit.
Dieser weiterführende Artikel zu feministischen Krimis.
Die Studie zur sexualisierten Gewalt in der Schweiz.
Autorin: Sara Räss (23 Jahre alt), Hospitantin (März bis Mai), studiert Germanistik und Skandinavistik an der Universität Zürich. Wenn sie gerade nicht am Lesen ist, stöbert sie im Bücherladen oder dem Bibliothekskatalog nach ihrer nächsten Lektüre.

Warum stehen Frauen eigentlich so auf True Crime? Weil sie klatschbesessen und überemotional sind? Im Gegenteil! Zeit für ein feministisches Reading eines zufällig feministischen Genres. Und eine Anklage an alle Nicht-Fans.
weiter ...Text: Emeli Glaser Illustration: Noon Selina Marrero Julian
Vor kurzem haben ich eine True Crime-Doku von Stern Crime mit dem relativ albernen Namen “Der Alptraummann” geschaut. Titel bei Seite, hier das Besondere daran: Man konnte für die Doku Archivmaterial benutzen, von dem niemand gedacht hat, dass es nochmal gebraucht wird.
Das Videomaterial ist von der Sendung “Goodbye Deutschland!”, in der sich in der Regel Vollkartoffeln den Traum vom eigenen Fitnesscenter auf Mallorca erfüllen. Einer der Auswanderer, der für die Sendung begleitet wurde, stellt sich allerdings als verurteilter Mörder heraus, mit einer langen Geschichte von Gewalt gegen seine Partnerinnen.
In quälenden Parallelmontagen sieht man wie der Mörder Sven und seine Frau Julia in ein wirklich abgelegenes (!) Häuschen am Arsch von Schweden ziehen, Hundeschlittenfahren, hoffnungsvoll über die Zukunft reden. Dazwischen sprechen Ex-Partnerinnen – beziehungsweise Überlebende – über die Dinge, die Sven ihnen angetan hat. Von Szene zu Szene macht man sich mehr Sorgen um Julias Sicherheit. Was passiert, wenn das Fernsehteam erstmal wieder weggefahren ist?
Es gibt viele Svens in Deutschland
Und während ich mich etwas schuldig fühle, weil man beim Schauen der Doku praktisch mit in der schwedischen Holzhütte steht und sich dabei wohlig gruselt, fällt mir noch etwas auf: Es gibt in Deutschland tausende, wenn nicht Millionen Svens. Mit dem Unterschied, dass über die niemals eine Doku gemacht wird.
Diese Alptraummänner missbrauchen ihre Partner:innen, tun ihnen psychische Gewalt an, nehmen sie finanziell aus und lassen sie mit Kindern zurück. Das Bizarre daran: Es scheint schon so etwas Gewöhnliches zu sein, dass man meint, das Thema sei ja schon sowas von auserzählt. Auf der anderen Seite liegt eine dicke Schicht Schweigen darüber, wie Gewalttäter in Partnerschaften vorgehen, welchen Mitschuld die Gesellschaft trägt, wie man das Ganze verhindern könnte.
True Crime wurde in den letzten Jahren immer wieder als “Frauengenre” bezeichnet. Die Zahlen bei Podcasts, Dokus, Magazinen waren eindeutig: Auffällig viele weibliche* Konsument:innen.
Erkläransätze gibt es dafür auch. Zum Beispiel, dass Frauen einen praktischen Nutzen daraus ziehen wollten. Also lernen, Gefahren frühzeitig erkennen und einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Ein weiteres Modell: Frauen seien allgemein empathischer, interessierten sich mehr für menschliche Belange, während Männer sich lieber mit sachlichen Themen beschäftigten.
Dass diese Ideen bereits mit sexistischen Stereotypen versetzt sind, bringt der Spiegel in einem Artikel zu dem Thema nochmal schön auf den Punkt: “Ist True Crime am Ende nichts anderes als ein Klatschmagazin, in dem statt Promi-Schwangerschaften Mordfälle ausgeweidet werden?”
Empathisch? Solidarisch!
Höchste Zeit für ein feministisches Reading von True Crime! Warum, zum Beispiel, geht gleich eine Abwertung des Emotionalen damit einher? Das, was als “menschlich”, “empathisch” oder “Klatsch-liebend” bezeichnet wird, kann man auch solidarisch und mutig nennen. Dieselben Eigenschaften zeichnet die Sendung “Aktenzeichen XY ungelöst” mit einem Preis für Zivilcourage aus, der meistens an Männer geht, die sich mit stolzgeschwellter Brust als Helden des Alltags bezeichnen.
Einen Preis gibt es aber nur für Oma-vor-dem-Bus–Retter, nicht für eine tiefergehende Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Blind Spots. Es soll nun eine besonders weibliche Eigenschaft sein, sich für das Wohlbefinden anderer zu interessieren. Was bedeutet es dann eigentlich für Männer, wenn sie keine Anteilnahme verspüren oder keinen Handlungsbedarf sehen, wenn anderen Menschen strukturell Gewalt angetan wird?
Die Entmenschlichung beginnt früher
Und schon sind wir bei der Normalität vieler Arten von Gewalt. Wie “Der Alptraummann” zeigt, ist serielle Gewalt an Frauen erst erwähnenswert, wenn das Ganze in ein Kapitalverbrechen mündet. Das Bewusstsein, dass Männer Hassverbrechen an Frauen begehen, und zwar nur aus dem Grund, dass ihre Opfer Frauen sind, fehlt immer noch weitgehend. Und, dass dem Mord viele gesellschaftliche Prozesse vorausgehen. Die Verachtung für und Entmenschlichung von Frauen beginnt viel früher.
Wie unterschiedlich Männer und Frauen Situationen bewerten, zeigt eine wirklich starke Szene aus dem True Crime-Podcast “Der Mörder und meine Cousine”: Dort gräbt ein Schauspieler in der Vergangenheit des Mannes, der seine Cousine ermordet hat. Er findet dort sehr Ähnliches wie bei Sven, dem Alptraummann: Vergewaltigung, körperliche und psychische Gewalt an Partnerinnen. Der Mörder hat sogar eine seiner vorherigen Partnerin auf offener Straße erschossen.
Der Schauspieler und seine Recherchepartnerin, eine jüngere Journalistin, besuchen den Verteidiger des Mörders. Der hat vor allem zu sagen, dass das Opfer den Mörder mit ihrem großen Dekolleté gereizt habe. Dass sie mit ihrem attraktiven Aussehen und selbstbewussten Auftreten nur darum gebettelt habe, dass ihr jemand früher und später etwas antut.
Das Gespräch, das der Schauspieler und die Journalistin nach dem Besuch beim Anwalt führen, bringt das Problem auf den Punkt: Die Journalistin kann ihre Fassungslosigkeit und Wut über das, was sie gerade gehört hat, kaum verstecken. Der Schauspieler ist irritiert von dieser Reaktion und beginnt das, was der Anwalt gesagt hat, herunterzuspielen.
Die Journalistin weiß, dass genau das Denken, das der Anwalt vertritt, die Ursache für Morde an Frauen ist. Dass ein Gericht, das nur aus Männern besteht, die Gefahr nicht ernst nimmt. Im Zweifel der Frau selbst die Schuld gibt und einen Mörder auf freien Fuß setzt, der wieder zuschlagen wird. Der Schauspieler hört dummes Gerede, das für ihn nichts weiter bedeutet.
Der rote Faden der Gewalt
Und damit kommen wir zu dem, was ich für den Kern des weiblichen Interesses für True Crime halte: Es ist eine der wenigen Ausnahmen in einer patriarchalen Gesellschaft, wo weibliche Erfahrungen nicht verschwiegen oder bestritten werden.
Wer in der Gesellschaft als (weißer Cis-) Mann lebt, wird niemals wissen, was es heißt, einer permanenten Bedrohungssituation ausgesetzt zu sein. Viel Zeit, Kraft und Gedanken damit zu verbringen, Situationen zu bewerten und Gefahren frühzeitig zu erkennen.
True Crime-Dokus erkennen diese Erfahrung an – statt sie, wie in den meisten anderen Bereichen, herunterzuspielen. True Crime erkennt die Kontinuität der Gewalt an Frauen an. Es zeichnet den roten Faden, der vom misogynen Gedanken bis zum Femizid gespannt ist. Im Alltag führt der Faden nicht immer bis zum schlimmstmöglichen Ergebnis. Aber oft genug.
Wie würde True Crime für Männer aussehen?
Wenn Frauen True Crime schauen, fühlen sie sich also weniger gegaslightet. Aber die Pflegearbeit leisten sie dabei immer noch allein: Sie beschäftigen sich damit, wie sie sich vor Männern schützen können – statt dass Männer sich bemühen würden, ihresgleichen beizubringen, keine Gewalt mehr auszuüben.
Manchmal frage ich mich, wie True Crime aussähe, mit dem Männer sich identifizieren könnten. Was bildet ihre tiefsten Ängste ab? Vielleicht auf einer Anklagebank zu sitzen, auch wenn sie nur den Verbrecher gedeckt haben? Oder noch plumper: Dass ihr Umfeld herausfindet, dass sie in Wirklichkeit gar keine Ahnung haben, warum man nicht einfach mehr Geld drucken könnte? Vielleicht, dass ihre Gymbros (Fitnessstudio-Kumpels) sie auslachen, weil sie eine emotionale Regung gezeigt haben? Wäre das nicht ihre Form von Horror?
In jedem Fall müsste man sie dazu zwingen, sich mit True Crime auf die gleiche Art zu beschäftigen, wie Frauen. Um das selbst zu tun, leben sie zu komfortabel. Ihnen geht es zu gut, um etwas ändern zu wollen. Und es wäre ihnen unangenehm: Das schlechte Gewissen wäre zu beißend. Weil sie tief drin wissen, dass sie Mitschuld tragen, Komplizen sind, an dem was andere Männer Frauen antun. Zumindest solange sie darüber schweigen.
Podcast-Tipp Nummer 1
«Der Mörder und meine Cousine» vom Bayerischen Rundfunk. Bestaunen Sie das gesellschaftliche Versagen, das Saskia ihr Leben kostet!
Über die Autorin
Emeli Glaser ist 25 Jahre alt und Journalistin aus Berlin. In deutschen Zeitungen schreibt sie über Dragqueens, Horrorfilme und Frauenhass im Internet. Für Wyborada durchkämmt sie alle zwei Monate Popkultur und soziale Medien nach heißem Shit und berichtet von den neuesten Phänomenen des Zoomer-Feminismus. Gen(eration) V(ulva) steht genau dafür. Twitter/Instagram

Nun ist es genau etwa ein Jahr her, seit die ersten UNI UTOPIA und DREIMAL Blogposts erschienen. Jedes Jahr wird es einen Wind of Change geben und der ist jetzt hier. Bald gibt es also Blognews und bald erfahrt ihr hier mehr dazu, also stay tuned (denn ihr werdet vielleicht noch gefragt sein)!
weiter ...Hier erstmal ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr, duale Farbkonzepte und den okayen Unmut des Schreibens. Denn so schön das war, sich hier mit Unithemen und Literatur x Gender Diskursen zu beschäftigen, so muss ich doch sagen, dass mein journalistisches Ich nicht allzu ausgeprägt ist. Lieber wissenschaftliches Schreiben, lieber Texte from other people.
Es waren Posts über literarische Fotzen und Weiblichkeit als Waffe. Als Waffe gegen die Vorstellung dass wir nur vollständig sind, wenn wir das Bett mit heterosexuellen Partner*innen teilen. Dann gings auch darum, dass Stories über romantische Liebe auch schön marxistisch beeinflusst sein können. Das Leben ist ein anderes, wenn man Cash hat. Mit Sally Rooney durch jeden Herbst und Winter; probierts mal aus, wenn ihrs nicht schon gemacht habt. Via Sibylle Berg wird klar, dass es okay ist, wenn Autor*innen sich als Figur konstruieren und inszenieren. Auch eine petite escapade in die Kunstgeschichte kam vor; get the Artist mit seinem Pinsel als Penis aus seinem Studio. Drei ganz dünne Bücher, die sich schnell und schön lesen lassen, für lesefaule Booklover*innen.
Weiter auch die Diskussion darüber, dass unsere Sprache zweigeteilt ist (nicht nur auf der Ebene des Geschlechts) und die Frage, was androgyne Literatur denn alles bewirken kann. Und ganz zu Beginn stand ein Text über die Macht der Autobiografie: wie viele Texte brauchen wir, die auf subjektiven Erfahrungen basieren?
Da gibts noch so viel mehr, worüber geschrieben werden könnte und noch geschrieben wird. Freuen wir uns da drauf und danke fürs lesen. Und benutzt Bücher, um euch ein besseres Gefühl in der Welt zu geben oder Dinge zu checken. Um zu chillen oder Verhältnisse einordnen zu können. Diskutiert darüber, hört Hörbücher oder lassts bleiben. Schaut, dass ihrs gut habt. <3 <3 <3
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

All die cuten Plätze auf denen mensch in St. Gallen Bücher lesen kann (zugegeben, es sind nicht genug öffentliche). Und all die Bücher, die da gelesen werden können?
weiter ...In der Wyborada-Bibliothek hat es 1’500 Biografien. Eine Biografie zu lesen ist ja manchmal ein bisschen, wie eine sehr weise Tante zu haben oder am Nomi auf irgendwelchen Treppenstufen vor irgendeiner Schule darüber nachzudenken, was es wohl alles für Leben auf der Welt gibt, die gelebt werden und wurden. Hier drei verschiedene Biografien, die du in der Wybo ausleihen kannst. Wir wissen es ja alle: bald/nun ist es Herbst und das inidividualistische Selfcare-Einmummeln kann um Erzählungen anderer Menschen ergänzt werden. <3
Audre Lorde, Sister Outsider
Hanser Verlag 2021
Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde veröffentlichte die Essays von Sister Outsider erstmals 1984, nur acht Jahre bevor sie starb. Trotzdem war es erst ihr viert-letztes Buch. Schon Zeit ihres Lebens war sie eine wichtige Stimme für queerfeministische und antikolonialistische Bewegungen, was sich nun nicht gross verändert hat. Im Zuge der BLM-Proteste, in Gender Studies Seminaren, bei selbstorganisierten Lesekreisen wird Lorde gelesen. Nun erschien Sister Outsider in einer Neuauflage beim Hanser Verlag. Es sind 15 Texte, in denen persönliche Erfahrungen auf eine strukturelle Ebene gehoben werden.
In Lyrik ist kein Luxus erklärt Lorde zum Beispiel, wieso Lyrik für Frauen «überlebensnotwendig» sein kann: Lyrik ist das konzentrierte Erzählen der eigenen Geschichte, sie soll dabei helfen, eigene Erfahrungen besser wahrzunehmen und zu erzählen. Weiter hinten im Buch steht, was wir von den Sechzigerjahren lernen können, womit Lorde gegen den Geschichtspessimismus anschreibt: die links-politischen Bewegungen, die uns vorausgingen sind vorbei, aber gibt es Dinge, die wir abschauen können? Die uns heute helfen, aktiv zu sein?
Vielleicht ist es ein Buch, das etwas mit Verantwortung zu tun hat: die Welt ist verantwortlich dafür, was für ein Leben einzelne Menschen haben. Und was wir jetzt tun, hat vielleich was mit dem zu tun, was noch kommt.
iO Tillett Wright, Darling Days
Suhrkamp Nova, 2017
In der Kunstszene im East Village New York, da ist der Asphalt und das Wissen eines Kindes, dass es ein Junge ist. «Ich habe kein Nicht-Jungen-Ich, das zur Not einspringen kann, es gibt nur dieses Jungen-Ich, das sich nicht mit meiner Anatomie vereinbaren lässt.»
Ein Buch über eine Person, die früh merkt, dass sie trans ist. Und das wiederum eine Tatsache, die während dem Buch auf eine (nicht komplette) Art vergessen geht. iO schreibt über die Nachbarschaft, in der er aufwächst. Beschreibt sich selbst durch die Welt, in der er lebte. Drogen, Sexarbeit, Party vor der Haustür. Aber auch Liebe und Nähe zur Familie. Das Buch bricht mit einem einfach Pessimismus oder Optimismus. Da ist was von allem, so wies halt ist.
Die Erzählungen sind begleitet von Fotografien. Von iO oder von Menschen, die er liebt(e), die ihn in den Kapiteln begleiten. So ist das Lesen ein bisschen, als ob wir mit ihm auf ner Couch sitzen, rauchen dürfen, durch ein Familienalbum blättern und die Geschichten dahinter (stark abschweifend) erzählt bekommen. That’s nice.
iO sagt auch, dass er trans ist und ein Mann, aber eigentlich einfach Bock hat, dass es egal ist. Und genauso, ist seine Geschlechtsidentität zwar eine Ebene des Buches, aber nicht alles. Und wird so zu etwas, das ihn nicht total definiert. Er ist mehr, als das Geschlecht, das er hat. Er erlebt viele Dinge, die was damit zu tun haben und einige auf die das nicht zutrifft. Er hat ein Umfeld, das seine Identiät nicht anzweifelte und Eltern, die ihm einen geschlechtsneutralen Namen gaben.
Susan Sontag, Wie wir jetzt leben
Hanser Verlag, 2020
Auch dieses Buch setzt sich aus verschiedenen Erzählungen zusammen, die ursprünglich in den 80er Jahren publiziert wurden. Die Welt der Biografien setzt sich aus Backflashs zusammen, was mal war, was es mit uns gemacht hat.
In diesem Falle ist es zum Beispiel ein gemeinsames rumhängen mit Thomas Mann unter der westlichen Brise Kaliforniens. Da wo die Sonne scheint, treffen zweit Literat*innen aufeinander. Das Ganze ein Ausdruck von Sontags Begeisterung für deutsche Literatur. Damals war sie sechzehn. Sie bewegte sich von Ivy League Uni zu Ivy League Uni, New York als der Ort, an den sie immer wieder zurückkehrte. Born and raised and died.
Im Zentrum dieses Essays steht ein weiteres Thema, das allgemein fest den 80ern zugeschrieben wird, heute manchmal wie ne Erinnerung an uns vorbei wabert. Die Boomer-Generation erzählt davon, wir Millenials habens auch grad noch so mitgekriegt: Aids.
Sontag beschreibt den Alltag eines erkrankten Freundes. Wie er fröhlicher wird, als er im Spital ist. Die Freund*innen bringen ihm Schokolade und Lakritz. Eine Erzählung, die den Alltag des Freundes durch seine Angehörigen schildert. Einen Zustand, den wohl Einige in Sontags Alter kennen: Wie geht man mit einer Krankheit um, die sich plötzlich in Freund*innenkreisen wiederfindet? Ein Zeitzeugnis über den (gem)einsamen Umgang mit den 80ern.
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

2018 kam in grellem Pink Enis Macis Essayband «Eiscafé Europa» auf die Tische der Buchhandlungen. Easy kompliziert und ausgecheckt, aber krass schön geschrieben, so meine Einschätzung. Die Dramatikerin und Essayistin Maci hat Jahrgang 1993 und fragt sich (und ihre Leser*innen) wie feministischer Wiederstand heute aussehn kann.
weiter ...Im Eiscafé Europa wird Eis gegessen, es werden Zigaretten geraucht und Limos aus der Dose getrunken. Maci «verweilt in den sozialen Randzonen und verwebt die losen Zipfel erzählens-notwendiger Dinge zu einem dichten Panorama europäischer Geschichte», so der Klappentext.
Die Philosophin Ruth Grossmass und Sozialpsychologin Christiane Schmerl sagen, dass es «per se etwas rebellisches» hat, wenn Geschichten, Erlebnisse, Erinnerungen nicht einfach nur in einer «Märchenstunde» erzählt, sondern auch in den Zusammenhang mit Theorien und wissenschaftlichen Texten gebracht werden.
Und das macht Maci auch: sie erzählt von ihrer Kindheit, zitiert zwischendurch Wikipediaartikel und Biografieausschnitte von Jeanne d’Arc. Sie lässt ihre Kindheitserinnerungen und Familienerzählungen nicht einfach so für sich stehen: sie sagt uns, dass es da Verbindungen gibt. Zu vielem Anderem. Verwebt persönliche Erfahrungen mit Theorien und weiteren Kontexten.
Das Erzählen aus der Kindheit liest sich zum Beispiel so:
«Im Eiscafé Europa also zeigte Bleta mit der flachen Hand, Handfläche nach oben, auf meine Mutter und rief: Schaut sie euch an, schaut sie euch genau an, und wir schauten, und sie weiter: Was für eine burrneshë. Natürlich gab meine Mutter das Kompliment zurück. Und ich wusste sofort, ohne dass mir irgendjemand je erklärt hätte, was das war, eine Männin, wusste sofort, schon allein der Grammatik wegen, dass das nur Frauen sein konnten, dass es etwas war, das in seiner ganzen unausgesprochenen Drastik besser war als alles, was ein Mann sein konnte, deshalb also nickte ich andächtig, bevor ich mit meinem rosa Strohhalm die San-Benedetto-Dose leersog.»
Eiscafé Europa besteht aus acht Essays, der erste davon heisst Jungfrauen. Darin geht es um die Tradition albanischer Schwurjungfrauen, der auch die Grosstante Macis folgte. Dabei «treten Frauen zum männlichen Geschlecht über», werden zu Männinen, zum Familienoberhaupt oder machen es wie Maci schreibt, «um dem Patriarchat ein Schnippchen zu schlagen» und so einer Heirat zu entgehen. Es ist eine soziale Aneignung von Männlichkeit.
Maci schreibt, dass die Befreiung der Frau an der Waffe stattfindet. Die Waffe sei eine Weigerung und im gleichen Atemzug: «Virginity means refusing to be fucked.»
Das ist jetzt erstmal die eine Ebene: eine Aneignung von Männlichkeit oder eines Männin-Seins, bedeutet eine Freiheit. Maci macht weiter auch was ähnliches auf einer Meta-Ebene: sie eignet sich eine mittlerweile oder bisher eher männlich geprägte Sprache an und setzt diese in einen neuen feministischen Kontext. So benutzt sie das Wort Fotze durch den gesamten Essayband und kombiniert dieses mit Waffen- und Kriegsrhetorik:
«Genauer ist, dass die Anwesenheit des Mannes in ihr, in ihrem Körper, als Belagerung zu verstehen ist, dass sie, egal wie freiwillig sie erfolgt, immer als unfreiwillig zu verstehen ist, beziehungsweise historischerweise zu verstehen sein hat. Genauer ist, dass der Mann durch seine Anwesenheit in ihr eine irreparable Wunde in ihren Körper reisst, und diese Wunde heisst Fotze, denn das Geschlecht der Frau existiert ungefickt nicht.»
Sie nimmt also einen patriarchal geprägten Begriff und verwendet ihn für eine Rhetorik, die eine Form des Kampfes gegen das Patriarchat verschriftlichen und festhalten soll. Fotze kann etymologisch vom Mittelhochdeutschen vut (dt.: Scheide) hergeleitet werden. Die Halterung für das Schwert (we all know where that leads to…) als Bezeichnung für die Vulva. Aber jetzt wird die Fotze selbst zur Waffe, ist nicht mehr nur deren Halterung.
Begriffe wie Fotze oder ficken und ein Konzept, wie das der Jungfrau müssen also nicht in ihrem patriarchalen Kontext verweilen. Können genommen, verwendet, neu besetzt und beschrieben werden. Maci eignet sich eine bisher vor Allem männlich geprägte Sprache an und beschreibt damit auf einer zweiten Ebene die Aneignung von Männlichkeit: die Männinen.
Quellen
Enis Maci. Eiscafé Europa. Berlin: Suhrkamp Edition (2018)
Grossmass, Ruth und Schmerl, Christiane. Leitbilder, Vexierbilder und Bildstörungen – über die Orientierungsleistung von Bildern in der feministischen Geschlechterdebatte. Frankfurt: Campus (1996)
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Die 2000er waren eine dunkle Zeit unerreichbarer Schönheitsideale und homofeindlicher Witze. Aber es gab einen Lichtblick. Wie Shrek die Millennials gerettet hat.
weiter ...Text: Emeli Glaser Illustration: Noon Selina Marrero Julian
Ein Geständnis: Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so doll für neue Internetphänomene. Was mich interessiert, ist, wenn Sachen aus meiner Jugend auf Tiktok neu bewertet werden – und ich plötzlich merke: Was für problematischen TV-Müll ich jahrelang in mich hineinkonsumiert habe.
Gehen wir mal 20 Jahre zurück, ins Jahr 2001. Damals kamen Filme wie “American Pie 2” und “Not Another Teen Movie” heraus. Wenn es so etwas wie Jugendkultur gab, die man sich zum Vorbild nehmen könnte, dann war die: amerikanisch, weiß, hypersexualisiert. Irgendwie rapey.
Der Stoff, aus dem Essstörungen gemacht sind
Weiße heterosexuelle Typen versuchen in diesen Dude-Filmen weiße heterosexuelle Frauen rumzukriegen, die in Unterwäsche rumlaufen und sehr dünn sind. Im Trailer von “Not Another Teen Movie” kracht das Prom Date des coolen Hauptcharakters durch eine Treppe in den Keller und eine alte Frau wird von einer Highschool-Footballmanschaft überrannt. Lustig wirds, wenn Frauen sich verletzen.
Nicht nur die Verachtung für Frauen war groß, sondern auch die Körper-Normen, denen man sich zu unterwerfen hatte, besonders dogmatisch: Noch immer war der Heroin Chic der 90er in, also dünn, blass und ungesund auszusehen. Alle Klamotten waren auf diesen Body Type ausgerichtet. Die Low Waist Jeans, extrem niedrig an der Hüfte sitzend – der Stoff aus dem Essstörungen gemacht sind. Dass diese Trauma-Hose gerade wieder in Mode kommt, triggert bei Millenial-Frauen reihenweise Komplexe.
Antisemitische Zauberer und mormonische Vampire
Der erfolgreichste Film 2001 war “Harry Potter und der Stein der Weisen”. Wahrscheinlich hat keine Buch- und Filmreihe eine gesamte Generation so geprägt, wie Harry Potter die Millennials. Erst jetzt reden wir darüber, wie antisemistisch und rassistisch einige Motive darin sind. Ach ja, und dann gab es noch “Twilight” : Die Vampir-Liebesgeschichte, die junge Leute zu Mormonen machen wollte und schon mal Enthaltsamkeit vor der Ehe gepredigt hat. Alles nur fucked up.
Das dürfte als kleiner Überblick reichen, um zu verstehen, was für Werte wir Spät-Millennials in unserer Pubertät mitbekommen haben, als wir am empfänglichsten für ideologischen Bullshit waren.
In diesem Text soll es aber nicht um die abgefuckten Sachen gehen, sondern um die eine Sache, die mit ihrem hellen Licht die gesamten 2000s überstrahlt hat: Shrek. Das Internet und ich sind uns einig, dieser Film hat uns Millennials praktisch im Alleingang durch diese düsteren Zeiten gerettet. Und bis heute spürt man die Dankbarkeit der Menschen an der Allgegenwart von Shrek in der Popkultur, 20 Jahre nach Erscheinen des modernen Meisterwerks.
Shrek ist ein Animationsfilm von Pixar. Damals hat das Unternehmen noch nicht zu Disney gehört (davon fange ich gar nicht erst an!). Es geht um einen grünen Oger, der in allein in seinem Sumpf lebt und damit sehr zufrieden ist. Aber der Herrscher des Landes Lord Farquaad verbannt alle magischen Wesen aus seinem Reich, die dann in Shreks Sumpf Zuflucht suchen. Um wieder seine Ruhe zu haben, willigt Shrek ein, Prinzessin Fiona aus einem Drachenturm zu retten und zu Lord Farquaad zu bringen. Das Abenteuer beginnt.
Bis heute erinnert man sich dankend an Shrek: Ein virales Tiktok-Video zeigt einen Junggesellinnen-Abschied im Jahr 2021, bei dem alle Anwesenden auf der Couch sitzen und unkontrolliert heulen. Die Kamera schwenkt auf den Fernseher: Es läuft Shrek.
In der 2000er-Folge der Serie Bojack Horeman schlägt der Hauptcharakter vor: “Let’s get wrecked and get Shrecked!” Man schaut bei Shrek nicht einen Film, es ist ein Prozess, ein Erlebnis! Seit einer Weile gibt es einen Shrek-Snapchat-Filter, wo einen der Oger von hinten umarmt.Wie irgendwelche christlichen Fundis Jesus in sich spüren wollen, wollten wir eben Shrek spüren.
Nichts ist gefährlicher, als ein verletztes männliches Ego
Die Bösewichte bei Shrek sind Arschlöcher, die alles versauen wollen, weil sie Komplexe haben: Der Inbegriff von Male Fragility. Lord Farquaad ist ein 60 Zentimeter großer Nerd, der nicht mal selbst Prinzessin befreien kann. Er kompensiert das mit einem riesigen schwanzförmigen Schloss.
Der Antagonist im nächsten Teil ist noch besser: Es ist der blonde Schönling Prince Charming, der eine viel zu Enge Bindung zu seiner Mutter hat. Der Typ Mann, der sich in einer Gesellschaft wie dieser nicht anstrengen muss und deshalb die Attitude hat, dass die ganze Welt ihm grundlos etwas schuldet. Als er endgültig bedeutungslos wird und seinen Machtstatus verliert, mobilisiert er die bösen Gestalten zum Angriff auf Shreks Königreich. Denn nichts ist gefährlicher als ein verletztes männliches Ego. Shrek hat das verstanden.
Die weibliche Repräsentation ist zum Heulen schön. Nicht nur kann Prinzessin Fiona Karate und rülpst aus vollem Hals, sie wird auch von der Gesellschaft verbannt, weil sie den “falschen Körper” hat. Denn nachts verwandelt sich die normschöne Prinzessin in einen Oger. Weil ihre Familie mit dem sozialen Stigma nicht umgehen kann, sperrt sie Fiona in einen Turm.
Die meisten anderen Romcoms transporieren die Message, dass es eine Frau erst nach ihrem Make-Over, wenn sie schlank und akzeptabel zurechtgemacht ist, verdient hat, glücklich zu sein. Prinzessin Fiona lehnt ihren Prinzessinnenkörper dankend ab und bleibt ein Oger. Denn das ist ihre wahre Identität. Und sie bekommt das Happy End. Gibt es eine empowerndere Darstellung von Frauen im Film? Nein? Dachte ich mir.
Und wenn man denkt, dass es nicht mehr besser werden kann, komme ich auch schon zur Queer Representation. Es gibt zwei trans Charaktere, die nicht da sind, damit man sich über sie lustig macht, so wie es lange in Filmen üblich war. Der Wolf und die Böse Stiefschwester sind trans Frauen. Und im Falle der zweiteren wird sogar ihre Diskriminierung im Shrek-Universe thematisiert. Shrek lehrt uns: Sie ist nicht böse, sie ist eine Frau und eine treue Gefährtin, Punkt.
Und warum muss ein Drache männlich gelesen sein? Oder eine Frau zierlicher als ihr Partner? Bei Shrek verlieben sich eine Drachin und ein Esel, weil: Love is Love. Und Pinocchio untergräbt Gender Norms im rosa Tanga.
Eine fundamentale Korrektur
Meine Lieblings-Shrek-Szene als Kind: Fiona und Shrek hüpfen verliebt durch ein Sonnenblumenfeld. Plötzlich kommt eine Mistgabel geflogen, dann taucht ein wütender Mob von Menschen mit Fackeln hinter ihnen auf. Sie werden gejagt, aber sie haben einander. Ihre Liebe ist mächtiger als der Hass. Mit ihrer Community und ihren Allys schaffen sie es sogar, das Königspaar von Far Far Away zu werden. Wir lernen: Veränderung ist möglich. Ist das nicht inspirierend?
Mit seinen positiven Vibes und Botschaften von Diversität und Zusammenhalt hat Shrek fundamental korrigiert, was mir das restliche Fernsehen als Kind weismachen wollte. Seine Popkultur-Referenzen, zweideutigen Witze und seine fantastische Musik haben mich zu der nutzlosen Feuilletonistin gemacht die ich heute bin. Und damit Tschüss, ich hab noch was vor: I’m gonna get Shreked.
Filmtipp Nummer 1
Die»Shrek» -Filme. Best to worst: Teil 2, Teil 1, Teil 3, der 4. Teil existiert nicht.
Über die Autorin
Emeli Glaser ist 25 Jahre alt und Journalistin aus Berlin. In deutschen Zeitungen schreibt sie über Dragqueens, Horrorfilme und Frauenhass im Internet. Für Wyborada durchkämmt sie alle zwei Monate Popkultur und soziale Medien nach heißem Shit und berichtet von den neuesten Phänomenen des Zoomer-Feminismus. Gen(eration) V(ulva) steht genau dafür. Twitter/Instagram

Sally Rooney ist eine junge Schriftstellerin und lebt in Irland. In ihren Romanen gehts oft ums Befreundet- oder Verliebtsein in der Nässe Dublins oder an Orten, an die mensch reisen kann, wenn Geld da ist. Es gibt nicht viele Lovestories, die Marxist*innen schrieben (aber wenn es sie gibt, bitte in den Kommentaren her damit). Rooney ist eine von ihnen, sie denkt und schreibt über das Leben «through a marxist framework.» Sie interessiert, wie das (nicht) haben von Geld unsere Beziehungen prägen kann. Und findet, dass Bücher immer irgendwie ausschliessend sind.
weiter ...Ein Beitrag, basierend auf einem Interview mit ihr, in dem sie erzählt, wie sie politische Verhältnisse in Romanstrukturen integriert und was das für sie als Autorin bedeutet.
In ihrem zweiten Buch Normal People (2018), das auch zu einer Miniserie gemacht wurde, fliesst marxistische Gesellschaftskritik subtil mit in die Zeilen. Es geht um Connell und Marianne. Beide studieren, seine Mutter putzt das Haus ihrer Familie, sie hat mehr Geld als er. Sie sind in den Ferien, er beginnt ein Gespräch:
I feel like everything has changed since scholarships (Stipendien).
What do you mean?
I don’t know, just all this, it’s real. You know foreign cities are real, famous artworks, the remnants of the Berlin Wall, eating icecream in litte Italian piazzas with you. It’s money though, isn’t it? The substance that makes the world real.
Wenn junge Menschen zuhause ausziehen, dann hat das was mit Geld zu tun. Wenn sie studieren oder arbeiten, hat das was mit Geld zu tun. Ob sie Fahrrad oder ÖV fahren, hat was mit Geld zu tun.
Rooney beschreibt in Normal People und in ihrem Interview die «Klasse der Bücher»: Schriftstellerinnen und Lesende besuchen Events, «full of people from a particular class with a particular educational background.»
Kulturelles Leben, das für Gewisse zugänglich ist und für Gewisse nicht, wird in einem Buch eingeschlossen und das Buch funktioniert dann in einem marxistischen Verständnis als Ware, dessen Kauf einen näher an diese Welt, diese Klasse bringen kann. Wenn Leute Geld für Bücher ausgeben, so sind sie laut Rooney «people paying to belong to a class who reads books.»
Die Welt des Schreibens wird von der «normal world» gesondert, so Rooney: «The economic and cultural backing of this world is a way of taking writers from their background, whatever that may be, and making them part of a special class which is somewhat fenced off from the normal world.»
Bücher als Ware, die mensch kaufen und damit die schönen Stringregale füllen kann, mit dem Ziel endlich eine «Book Person» zu sein. Der Grund, wieso Rooney das alles kritisiert, ist, dass es den Büchern eine politische Kraft nimmt: Auch wenn ein Buch voll mit subversiver marxistischer Theorie ist, ist es von einer realpolitischen Welt entfernt; wegen seiner Rolle als Ware innerhalb des Buchmarktes.
Wie wir uns in einer Welt fühlen, wie gut es uns geht, ist oft vom Besitz von Dingen abhängig. Wie also funktionieren zwischenmenschliche Beziehungen, die nicht auf einer «notion of buying and selling» basieren sollten?
Mit einem feministischen Mindset hat Rooney gelernt, dass die unabhängige Frau das Endziel ist, aber nun sagt sie «I don’t believe that anymore. I don’t believe in the Idea of independent people», weil wir eben gemeinsam in einer Welt, in Strukturen sitzen.
Das ist die eine Ebene: dass wir das Leben, das wir haben, nur wegen anderen Leuten haben. Und die Ebene, auf die Rooney in ihren Romanen fokussiert, ist reingezoomt: zwischen zwei, vielleicht drei, vier Menschen.
«You’re always a combination from the influence of others.»
Laut Rooney liegt hier genau die Macht der Romane begraben: wir wissen am Ende ihrer Bücher nicht nur, dass es Strukturen gibt, die unser Leben und unsere Beziehungen beeinflussen, sondern wir fühlen und verstehen es – durch ihre Protagonist*innen, die wir kurzzeitig dabei begleiten, wie sie einander im Leben und in gegebenen Strukturen begegnen.
Weiter könnten wir uns fragen, ob Rooney vielleicht auch deshalb politisch schreibt, weil ihre Bücher Bestseller-Romane sind, die wir auch an einem Kiosk finden können. Weil sie nicht nur in Literaturhäusern und schicken Buchhandlungen Raum kriegen. Weil es keine akademischen Theoriebücher sind, sondern Romane, die uns emotional catchen können.
Mal eben richtig den Kapitalismus fühlen gehn.
Anmerkung
Ihr neues Buch Beautiful World, Where Are You erscheint am 7. September 2021 auf Englisch.
Quellen
Sally Rooney Interview: Writing with Marxism. Youtube: Louisiana Channel. (26. Februar 2019)
Sally Rooney. Normal People. Faber And Faber Ltd. (2018)
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Sibylle Berg wird oft als eine Person abgetan, die nix positiv sehen kann, no feelings involved, kühl, cool, bisschen beängstigend, von vielen als unsympathisch bezeichnet, weil sie they wahrscheinlich einfach nicht genau fassen können. Voll okay, dass das so ist, machen wir hier doch mal bisschen weiter mit der Unfassbarkeit. Hier gehts um «Wie halte ich das nur alles aus? Fragen Sie Frau Sibylle»: eine Sammlung, ein Best Of von theys (jeweils etwa dreiseitigen) Kolumnen, die auch auf spiegel.de nachlesbar sind.
weiter ...Denn Berg hat die Feelings und zwar solche, mit denen wir nicht alle gerechnet haben. Da gibts die Frage, wie mensch weiterleben soll, wenn die Person, die man liebt, stirbt und Sätze über das entfremdete Gefühl während den ersten zehn Minuten einer Wanderung. Wir können Anti Alles sein und trotzdem lieben. Widersprüche aushalten, ihr kennt es.
Verblödet die Jugend immer mehr?
Ich stelle euch jetzt also drei von insgesamt 43 Kolumnen vor, die in diesem Buch nachzulesen sind. Die erste widmet sich wohl allen jungen Millenials und Gen Z Kids, allen die zwischen Erwachsen- und Kindsein am rumwuseln sind. Jenen, die lieber zu Hause «unwichtiges Wissen nachschlagen» als «in Bibliotheken Hustenanfälle zu bekommen.»
Berg erzählt zu Beginn von einem Wissenschaftler, der sagt, dass die Jugend immer dümmer wird. Berg sagt dann auch, dass er es doch eigentlich wissen sollte, er ist ja eben Wissenschaftler. Aber Berg widerspricht ihm, denn für they sind die Jugendlichen «die einzige Bevölkerungsgruppe» der they «ungebremste Dummheit gestatte.» Wir sollen den Kids mehr zutrauen und sie aber auch einfach mal in Ruhe lassen.
«Ich erlebe die Jugend heute als ausserordentlich reizend. Eigentlich wie immer. Es gibt ein paar Schwachköpfe, einige aggressive Randalierer» aber auch: «die Jugend heute ist meinem Empfinden nach politischer als früher, weil sie sich schnell informieren und verabreden kann.» Berg schreibt, dass they «jugendliche Jungs» mag, die in den Bussen nicht wissen, wo sie ihre grossen Füsse hinstecken sollen und junge Leute, die immer wieder ihre Meinung ändern.
Laut Berg sollen die Alten, die die Welt den Jungen immer bisschen kaputter hinterlassen, ruhig sein. «Wer die Dummheit der Jugend beklagt, kann selber nicht wahnsinnig intelligent sein, denn er hat vergessen, wie es sich anfühlte, dieses Jungsein mit dem Gefühl, die Welt sei zu gross für einen, und man wollte alles, nur nie, nie so alt werden, wie die Alten in ihren dämlichen Anzügen.»
Muss man unbedingt jemanden lieben?
Zugegebenermassen beginnt auch diese Kolumne damit, dass Berg eine Meinung einer Person darlegt (die Autorin Christiane Rösinger findet, dass Liebe in unserer Gesellschaft zu wichtig, ja sogar fast zur neuen Religion wird) und they dieser Meinung dann widerspricht. Berg macht uns erstmal klar, in welcher Realität wir uns befinden: Im Kapitalismus können wir alle die ganze Zeit auf verschiedenste Weisen unsere Meinung kundtun, aber «die Welt, um es einfach zu sagen, doesn’t give a shit. Sie macht weiter mit dem, was sie am besten kann: sich einstellen auf den kompletten Ruin durch die Menschen, die auf ihr herumspringen.»
Laut Berg ist die Liebe das Einzige, was uns im Kapitalismus noch retten kann. Und an den Punkt kommt they wie folgt:
Berg findet das Streben nach Unabhängigkeit und individueller Freiheit, die von keinem Mitmenschen genommen werden darf, veraltet. Permanente Selbstverwirklichung ist für they in den Achtzigern trendy gewesen und mittlerweile «sollten wir verstanden haben, dass einem eine Karriere keine kalten Lappen auf die Stirn legt, wenn man krank ist.»
So ist alles ausser der Liebe überbewertet. Sie macht, dass sich Menschen in Mitten eines «kapitalistischen geschwürhaften Systems», das nicht unbedingt darauf zählt, dass Menschen gut und lieb zueinander sind, umeinander kümmern.
«Es hilft keiner Sau, wenn wir uns alle das letzte Gefühl, das uns retten könnte, abgewöhnen.» Bisschen love rules, bisschen kollektive Verantwortung.
Ist es eigentlich noch cool, in die Provence zu reisen?
Die letzte der drei Kolumnen ist zynisch und wundervoll. Sie beginnt mit dem Satz «es ist zweifelsfrei sehr wichtig, ein cooles Leben zu führen, wenn man schon kein gutes hinbekommt.» Als uncool bezeichnet Berg das Reisen. Denn «der moderne Mensch bleibt umweltschonend zu Hause und entwickelt in seiner Urlaubszeit Projekte. Der etwas uncoolere Mensch macht Rafting-Touren oder paddelt mit einer Popgruppe durch die Mecklenburger Seenplatte. Der Rest verreist.»
Erst ist es die Provence, dann wenn wir älter sind, ist es die Toskana. Eine Ode an privilegierte Leute, die in nur etwas wärmeren Ländern den Minimalismus suchen gehen.
In der Provence fällt das Licht dann im besten Fall gelb auf blaue Fensterläden und auf den Lavendel. Immer ist es Lavendel und «aus putzigen Häusern purzeln Menschen in weissen Leinen.» Die Leute haben alle gewobene Körbe, mit denen gehen sie dann auf den Markt und vor den schön sanierten Bauernhäuser steht ein Stuhl, auf dem wie zufällig ein Leinentuch darüber geworfen wurde. Alles ganz entspannt. Sie brettern mit dem Jeep durch die Felder.
«Scharen weissgekleideter Menschen fahren zum Winzer: dekantieren, schnüffeln am Roten, am Weissen, o dieses Bukett, verdrehen die Augen. Was für ein Theater, um besoffen zu werden! O Provence, du Ballenberg Frankreichs. Diese Sucht einfaches Leben nachzuspielen.»
Nächstes Jahr gehts dann in die Toskana und habt einen schönen Sommer.
Anmerkung
So stands schon einmal in einem Beitrag über Sibylle Berg (weiter unten im Feed) geschrieben: In Bergs Instagrambio stehen die Pronomen they/them, auf Bergs Webseite steht non-binär und es wird das weibliche Pronomen verwendet, ich bin verwirrt, das ist erfreulich und okay, ich verwende hier they.
Quelle
Sibylle Berg (2015). Wie halte ich das nur alles aus? Fragen Sie Frau Sibylle. München: dtv Verlag.
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Caroline A. Jones schreibt in «Machine in the Studio» über das Konzept des «male artists», der Kohle hat, sich jedoch in seinem Studio, vermeintlich fern von Politik verbarrikadiert. Er romantisiert ein prekäres Leben am Limit (das er eigentlich nicht leben müsste) und benutzt seinen Pinsel wie ein Penis. Sounds cool, doesn’t it?
weiter ...Teil von der Rubrik UNI UTOPIA ist es, Texte, die plus ou moin ultra kompliziert oder dicht geschrieben sind, aber wichtige politische Inhalte haben, runterzubrechen. Ja zu Theoretiker*innen, die Dinge auf den Punkt bringen, mimimi für die Academia, die macht, dass das dann nicht unbedingt einfach verständlich ist.
So let’s go, wir wollen das «Genie» vor seiner Leinwand jetzt mal stören gehen.

Das Studio soll laut Jones bewusst als isolierter Raum wahrgenommen werden, indem der Künstler allein mit seiner Kunst ist. Ein individuelles Genie «off from the pressures of the outside world.» Studio ist also nicht einfach eine architektonische Raumbezeichnung, sondern es meint einen Raum, an dem viele Bedeutungen kleben.
Das war schon im 19. Jahrhundert so, einer Zeit, in der Frauen stark an den privaten Raum gebunden waren, Männer sich aber in der Öffentlichkeit frei bewegen konnten. Sich in einem privaten Raum zu isolieren, war für männliche Künstler eine Entscheidung. Für Frauen war es eine unverhandelbare Ausgangslage.
Das Studio war meist ein One-Room-Apartment, das an vermeintlich «struggling Individuals» vermietet wurde. Künstler Willem de Kooning sagte dazu: «For me, to be inside and outside is to be in an unheated studio with broken windows in the winter, or taking a nap on somebody’s porch in the summer. Some painters, including myself, do not care what chair they are sitting on. Rather, they have found that painting – any kind of painting is a way of living today. It is exactly the uselessness that is free.»
Wie viele Leute mussten zu der Zeit, als er das sagte, wohl unfreiwillig in unbeheizten Wohnungen wohnen? Was für ein Luxus seine Lebensumstände so prekarisieren zu können. Also weniger privilegiert zu leben, als es einem möglich wäre. Jones schreibt «The misery is not materially necessary.»
Künstler wie Jackson Pollock und Willem de Kooning kamen also Mitte 20. Jahrhundert nach New York, sassen in ihren Studios, mit kaltem Wasseranschluss und konzentrierten sich auf sich selbst. Erst die Kunstkritiker*innen waren jene, die laut Jones all diese Künstler zu einer Gruppe fassten: abstrakter Expressionismus. Sie behaupteten weiter eine Einsamkeit, eine Isolation vom Rest.
Was für ein Luxus, sich bewusst einsamer zu machen, ein bestehendes soziales Netzwerk (durchaus ein Privileg) aus romantischen Gründen zurückzuweisen.
Es geht also darum, dass es oft zur Künstleridentität gehörte (und immer noch gehört), das Leben am Existenzminimum zu romantisieren. Das Ganze wird dann so gut, wie es geht, weiter gefaket, wenn Künstler finanziell erfolgreich sind. «The lone artist did not want the world to be different, he wanted his canvas to be the world.» Bro, come on. Jones spricht von einer bewussten Entpolitisierung des Studios und der Leinwand. Die Behauptung der Künstler, dass ihre Kunst nicht politisch ist, dass das Studio ein «space beyond politics» sei. Jedoch werden Künstler und Canvas durch genau dieses Vorhaben zu einem politischen Raum.
Sich von politischen Verhältnissen frei sprechen zu können, ist wohl der grösste Luxus überhaupt.
Weiter erwähnt Jones noch das «fini» (deutsch: fertig), dem die männlichen Künstler jener Zeit eine Absage erteilen. Ein Gemälde soll nicht fertig und perfekt aussehen, der Pinsel ist männlich und soll sichtbar bleiben. «The spontaneous brushstroke has no boss, no patron, no mouths to feed», so Jones. Insert zahlreiche Fotografien von Jackson Pollock, wie er sich mit dem Pinsel oder einer Zigarette zwischen den Fingern orgasmisch über seine Gemälde hinfortbewegt. Wenn die Leinwand die Welt ist, dann ist er der Mann, der sich frei über ihr bewegen kann.
Ich google «Jackson Pollock Studio», klicke auf «Bilder» und frage mich, wie es malenden queeren Personen und Frauen jener Zeit ging. Konnten sie politische Verhältnisse auch von ihrer Leinwand brushen?
Anmerkung
Hier gings jetzt mal nur um die Boys. Es gab im abstrakten Expressionismus aber auch berühmte Frauen, allen voran zum Beispiel Helen Frankenthaler oder auch Lee Krasner, zweitere wird heute noch in den Schatten ihres Mannes (Jackson Pollock) gestellt. Sie unterschrieb ihre Gemälde oft nur mit L.K., um nach eigener Aussage als weniger weiblich wahrgenommen zu werden und sich so in der Kunstszene New Yorks freier bewegen zu können.

Quelle
Caroline A. Jones (1996). Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist. The University of Chicago Press. Seite 1-59
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Beginnen soll die neue Blog-Serie «Gen V» über Feminismus und Popkultur mit einem Thema, das nicht nur aktuell ist, sondern ein Dauerbrenner. Ein Thema, das unsere Gesellschaft spaltet: Es geht um Männer. Ein Annäherungsversuch an diese missverstandenen Wesen.
weiter ...
Text: Emeli Glaser Illustration: Noon Selina Marrero Julian
Sie sind das Kaugummi unter der Sohle des Fortschritts: Männer im 21. Jahrhundert. Bis heute sind Männer die kleinen Sonnenkönige unserer Gesellschaft: Bestimmen dürfen sie über alles, einen besonders guten Job machen sie dabei nicht. Eher einen katastrophalen. Darüber ist man sich einig.
Doch über ein Thema wird bei all der Kritik und Missgunst nicht genug gesprochen: Auf einem Schuhsolen-Kaugummi wird auch herumgetrampelt. Männer leiden selbst unter ihrer Rolle. Zu selten kommt zur Sprache, was das Patriarchat ihnen eigentlich alles antut.
Wir Feminist:innen wollen helfen. Die Hände reichen, starke Schultern zum anlehnen bieten. Aber um dem geschundenen Geschöpf Mann helfen zu können, muss zunächst Bewusstsein für seine Lage geschaffen werden. Und damit möchte ich heute beginnen, indem ich auf die Ungerechtigkeiten hinweise, die Männern tagtäglich zustoßen.
Leben nach den Gesetzen des Tierreichs
Noch ein kurzer Einschub: Wenn ich vom „Mann“ rede, dann meine ich das bemitleidenswerteste aller männlichen Wesen: den weißen, heterosexuellen Mann, der sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei der Geburt zugeteilt wurde. Den weißen Cis-Het-Mann (WCHM).
Stellen Sie sich vor, ihnen wird ihr ganzes Leben gesagt, sie seien nur etwas wert, wenn Sie andere sexuell dominieren. Jungs dürfen in Frauen keine Verbündeten, Respektspersonen oder Freund:innen sehen. Die Eigenschaft, die uns grundlegend zum Menschen macht, wird ihnen verboten: Mitgefühl. Stattdessen lernen sie die Gesetze des Tierreichs. So wie sie es verlernt haben, Frauen als Menschen zu sehen, sind sie auch blind für alles, das außerhalb der Gesetze von Macht und Gewalt existiert. Ihr Gehirn funktioniert, wie jeder Action-Film mit Vin Diesel: Fressen oder gefressen werden.
Auch einen Sinn für Schönheit dürfen WHCM nicht entwickeln. Anders lässt sich die „Hochglanz“-Sexfilm-Industrie nicht erklären, die Männer mit ihrem Konsum geschaffen haben. Jede:r empfindende Mensch muss sich innerhalb kürzester Zeit von den lieblosen, grell ausgeleuchteten Sets abwenden. Als Frau kann man wenigstens noch erkennen, ob die Pornodarstellerin gerade über ihr Abendessen oder eine Gehaltserhöhung nachdenkt. Der Mann sieht nur eine mechanische Bewegung. Irgendwie sad.
Einsame Dominanzmaschinen
Noch trauriger: WCHM haben nicht nur keine Beziehung zu ihrem Inneren, auch ihre eigenen Körper sind ihnen fremd. Es ist ihnen so strikt verboten, sich selbst oder andere Männer schön zu finden, dass sie sich ihr Leben lang nicht trauen, die eigene Klitoris zu benutzen. Denn sie haben besonders schreckliche Angst vor männlichen Polöchern. Prostatamassagen bedeuten aus irgendwelchen irrational-männlichen Gründen Schwulsein. Und Schwulsein bedeutet, aus der Gesellschaft, wie der WCHM sie kennt, verbannt zu werden.
Schwierig ist es für Männer auch, zu kommunizieren. Sie sollen berechnende Dominanzmaschinen sein. Während andere Leute eine ganze Palette von Emotionen benutzen, um sich mit der Außenwelt auszutauschen, hat ein WCHM nur Wut. Das ist das einzige Gefühl, das er zeigen darf. Es bleibt ihm nichts anderes übrig als Angst oder Zweifel in Wut umzuwandeln. Dann brüllt und schreit er, wie ein hilfloser Säugling, aber niemand kann verstehen, was er braucht. Er kann seine Gefühle weder mitteilen noch selbst deuten. Deshalb ist er einsam.
Die schlechteste Literatur kommt von Männern
Weil sein Blick die Welt dominiert, hat der WCHM nie gelernt, dass es andere Perspektiven gibt als seine. Frauen, queere Leute und People of Colour sind multilingual. Sie können mühelos zwischen der dominanten Perspektive der WCHM und ihrer eigenen hin und her wechseln. Der WCHM kann nur die eigene Sprache sprechen. Sein Überleben hing nie davon ab, sich andere Perspektiven anzueignen. Alle mussten sich immer an ihm orientieren. Das ist jetzt sein Nachteil.
Wie hilflos er ist, wenn seine eigene Perspektive nicht zählt, sieht man in seiner Benutzung von Dating-Apps. Frauen sind darin geübt, Männern zu gefallen. Sie lernen über Jahre Fotografie- und Make-Up-Techniken und wie sie ihren Körper betonen müssen. Um sich Frauen im Netz zu präsentieren, fällt dem WCHM nichts Besseres ein, als Sportsonnenbrille zu tragen und stolz einen geangelten Karpfen in die Kamera zu halten.

Illustration: Noon Selina Marrero Julian
Wegen ihrer eingeschränkten Wahrnehmung ist auch die Literatur von WCHM die schlechteste, die es gibt. Logischerweise sind Männer wegen ihres fehlenden Einfühlungsvermögens unfähig, Charaktere zu entwickeln, die ihnen selbst nicht ähneln. Und weil ein WCHM so sehr um sich selbst kreist, liebt er es, seitenlang seine persönlichen Eindrücke aufzuschreiben. Er geht davon aus, das sei für alle Welt von Interesse. Er ist also nicht nur taub und stumm, sondern auch blind für alles, was ihn umgibt. Und das schlimmste ist: Von all dem weiß er nichts.
Lob als Bezahlung
Weil sie auf sich gestellt völlig hilflos sind, fühlen sich Männer berechtigt, von jeder Person zu jeder Zeit umsorgt zu werden. Einen Mann zuhause zu haben, ist für Frauen, wie ein Kätzchen zu halten. Man füttert, entwurmt und beschützt das Kätzchen. Es zerkratzt Möbel, steigt bei der Arbeit auf den Laptop. Schenkt man ihm keine Aufmerksamkeit, macht es auf den Teppich. Stellen Sie sich eine Katze vor, die 80 Kilo wiegt, Sie also mit einem Prankenhieb umhauen könnte.
Mit Arbeit kann man den WCHM nicht belasten. Er kann sich nur auf eine einzige Sache auf einmal konzentrieren. Andere Menschen führen viele Arbeiten am Tag aus, nebenbei und manchmal gleichzeitig. Die bleiben für den Mann unsichtbar. Er wundert sich nicht, warum es um ihn herum ohne sein Zutun sauber und ordentlich bleibt. Für ihn ist das einfach die Natur der Dinge, so wie die Sonne morgens aufgeht.

Damit der WCHM etwas erledigt, müssen besondere Anreize geschaffen werden. Das Wohl der Gemeinschaft ist ihm kein Begriff. Er denkt in Status und Gegenleistungen, muss also für selbstverständliche Arbeiten entlohnt werden. In der Regel nimmt er soziale Bestätigung als Bezahlung an. Zum Beispiel überschwängliches Lob. Das Einzige, wofür er sich gut eignet, ist als Spielpartner für Kinder, denn er selbst hat nie die mentale Reife einer Erwachsenen erreicht.
Was das Patriarchat Männern antut ist brutal
Irgendwo spürt der WCHM, dass er in den Augen seiner Mitmenschen ein dorniges Pflänzchen ist, das umhegt werden muss. Tief in sich weiß er auch, dass alle anderen ihm weit überlegen sind. Darauf reagiert er mit Gewalt. Das hat bisher immer gut geklappt. Wenn eine Frau sich zum Beispiel im Biergarten zu Politik äußert, ist das ein direkter Angriff auf die Stellung des WCHM. Elegantere Männer begegnen der Provokation, indem sie ungezügelt Wikipedia-Artikel nacherzählen, die sie extra für diesen Fall auswendig lernen.
Was das Patriarchat Männern antut ist brutal. Es nimmt ihnen alle Fähigkeiten, die sie brauchen, um ein funktionierender Mitmensch zu sein. Vor allem macht das patriarchale Männerbild sie handlungsunfähig in einer Welt, die immer weniger auf sie ausgerichtet ist. Es wird hart für sie, die ganze giftige Männlichkeit zu verlernen. Sollten die WCHM irgendwann bereit sein, helfen wir natürlich gerne dabei. Außer sie zerkratzen das Sofa. Dann gibt es Sprühflasche.
Lektüretipp Nummer 1
«Scum Manifesto» von Valerie Solanas, das Buch einer Visionärin, die diesen Text sehr beeinflusst hat.
Über die Autorin
Emeli Glaser ist 24 Jahre alt und Journalistin aus Berlin. In deutschen Zeitungen schreibt sie über Dragqueens, Horrorfilme und Frauenhass im Internet. Für Wyborada durchkämmt sie alle zwei Monate Popkultur und soziale Medien nach heißem Shit und berichtet von den neuesten Phänomenen des Zoomer-Feminismus. Gen(eration) V(ulva) steht genau dafür. Twitter/Instagram

Bücher lesen ist schon auch ein lifestyle. Das Cover passt gut zu unserem ausgecheckten Dasein und zur rosa Grapefruit, die wir aufgeschnitten und auf der schicken Picknickdecke daneben gelegt haben. Und dann hier noch ein Blogbeitrag mit schönen Farben. Lesen ist gerade oft ein Identitätsding, Freund*innen reden über Bücher, die ihnen (nicht) gefallen haben. «Hast du diesdas gelesen, was hat es dir gebracht?»
weiter ...Es ist okay nicht gerne zu lesen. Literatur ist mehr als ein 1000 Seiten Epos. Spokenword, Hörspiele, eine Kurzgeschichte. Hier deshalb dreimal weniger als hundert Seiten, die sich schnell gelesen haben. Für Zeiten, in denen mensch sich gefühlt ewigs durch ein einzelnes Buch schleppt und da gerade keine Lust drauf hat. Es soll doch alles ganz schnell gehn. Das breite Thema Liebe in dünnen Büchern. Dreimal eine Hetero-Konstellation, die vielleicht gar nicht so romantisch ist. Die vielleicht gar nicht wirklich funktionieren kann.

Sally Rooney, Mr Salary
Wir starten mit einer 33 seitigen Kurzgeschichte. Sally Rooney, die sich als Marxistin bezeichnet und das auch in ihre Romane (z.B. Conversations with Friends 2017) einfliessen lässt, untersucht anhand ihrer Figuren, was mit deren Beziehung und Gesprächen geschieht, wenn nicht beide die gleiche finanzielle Ausgangslage haben.
Sukie hatte keine funktionierende Familie und zog zu Nathan. Er ist 15 Jahre älter als sie. Er hat mehr Geld als sie, «he provides for her.» Jahre später kehrt sie nach Dublin zurück, um ihren krebskranken Vater Frank zu besuchen. Sie stehn aufeinander, wissen aber auch, dass sie nichts miteinander haben können, ohne dass es in einem ungleichen Kontext geschieht.
Sie versuchen ihre Beziehung trotz verschiedener Ungleichheiten (finanziell, geschlechtlich, altersbedingt) irgendwo zu platzieren. Aber gerade die finanzielle Abhängigkeit entromantisiert ihre Beziehung aus einem marxistischen Blickwinkel.
Sukie nennt ihn «Mr Salary», er bezahlt ihr das Flugticket, sie fragt ihn «Can we fuck?» und er sagt nein. Eine sexuelle oder romantische Verbindung zwischen ihnen wird dadurch verunmöglicht, dass kein Tauschhandel in einem kapitalistischen Sinn zwischen ihnen stattfinden soll. Geld gegen Körper.
«They think you’re paying me for something, I told him. That made Nathan laugh. I’m not really getting my money’s worth, am I? he said. You don’t even do your own fucking laundry.»
Faber & Faber, 2019
Paulina Czienskowski, Gegen die emotionale Verkümmerung
Die Freundin sagt der Protagonistin, dass diese keine Feministin sei, weil sie so lange bei ihm geblieben ist, während die beiden «Fotze» von der Hauswand schrubben. Ihr Ex hat das Wort gesprayt. Es sind «Erzählungen in denen jeder auf seine Weise gegen die Leere nach einer Liebe ankämpft» auf 83 Seiten.
«Immer denkt man: Diesmal wird alles anders. Vergangenes wird mit jeder neuen Liebe ausgeblendet. Und dann wird doch wieder alles genau wie zuvor. Nur eben irgendwie anders. Da ist der Rahmen, Lorem ipsum, in ihn lässt sich hineinerzählen, was man will.»
Die Erzählerin schreit ihn in Frankreich an und er wird immer leiser und sie wird immer lauter. Einige Figuren schauen durch Türspione in Treppenhäuser und andere klingeln, weil es zu laut ist. Manchmal ist die U-Bahn dann «in ihrer Monotonie» beruhigend und oft hilft ein Negroni gegen den Pain. Dann, immer mehr, kommt aber auch folgende Erkenntnis durch die silbern scheinenden Seiten des Buches: «Dein Dasein kannst nur du durch dich selbst rechtfertigen. Niemand anderes kann das.»
«Ich fühle mich geliebt, in verschiedensten Nuancen, von rechts und links und von da oben. Komisch, dass die Übergänge zwischen all den Geschichten, die mich formen und zu dem machen, was ich jetzt bin, hier gerade so fliessend sind.» Und dann tanzen sie. Keine Angst, die Liebe stirbt nicht aus.
Korbinian Verlag 2018
Alejandro Zambra, Bonsai
«Julio liebt Emilia, Emilia liebt Julio, beide lieben Proust – beide haben in Wirklichkeit nicht eine Seite Proust gelesen. Dann verlässt sie ihn, und er liebt sie weiter» und irgendwann stirbt sie dann und er liebt sie «immer weiter».
Er ist in der WG von Emilia und ihrer Freundin, aber er wird nicht Teil davon. Sind sie zu zweit, verlieren sie sich ineinander: «Schnell lernten sie, das Gleiche zu lesen, ähnlich zu denken, ihre Differenzen zu verbergen. Sehr rasch entwickelten sie eine selbstgefällige Vertrautheit.»
Sie lügen sich an, sie haben eine gute Zeit. Auf dem Buchrücken steht: «Zambra zu lesen ist wie ein Anruf eines alten Freundes mitten in der Nacht.»
Was sind das für Leute, für die sich eine Person immer wieder für ne Zeit lang entscheidet? Und was haben die mit einem selbst zu tun? Emilia fragt ihre Freundin: «Was hat es für einen Sinn, mit jemandem zusammen zu sein, wenn er dein Leben nicht verändert?» Eine Beziehung also auch als Selbstzweck.
«Dies ist die Geschichte zweier Studenten mit einem Faible für die Wahrheit, dafür, Sätze loszulassen, die wahrhaftig klingen, endlos Zigaretten zu rauchen und sich in der gewaltsamen Selbstzufriedenheit derer einzuschliessen, die sich für besser, unverfälschter als die anderen halten, als diese riesige, verachtenswerte Gruppe derer, die man die anderen nennt.»
Suhrkamp 2016
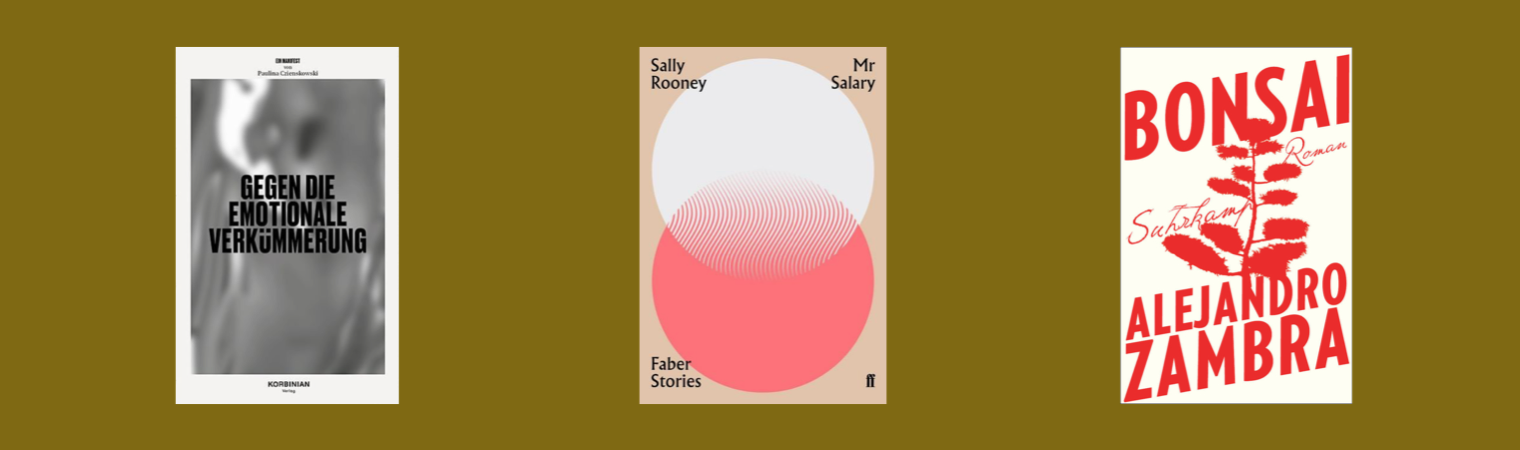
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Habt ihr Angst vor Sibylle Berg? Ein Dokumentarfilm von 2015 stellt dieselbe Frage über die in Zürich lebende Autor*in. Berg zieht sich schon damals eine hellblaue Hygienemaske an und erzählt uns, dass they sich einmal vornahm, sich umzubringen, wenn they bis 40 nicht vom Schreiben leben kann. Berg haut uns krasse Phrasen um die Ohren und findet, dass Liebe das einzige ist, das macht, dass wir im Kapitalismus nicht einen totalen Brainfuck kriegen. Autor*innenbeschriebe und Artikel verraten uns nicht viel über Berg: Aufgewachsen in der DDR, Studium der Meeresbiologie, Clownschule im Ticino, Autounfall. Immer mit der Betonung, dass Berg sowieso meist lügt, wenn they was erzählt. Ein Lebenslauf ohne Garantie also.
weiter ...Das führt dazu, dass sich viele fragen, wer denn die Person hinter brutalen Büchern und radikaler Gesellschaftskritik ist. Alle wollen Berg zu fassen kriegen, Berg der Fisch, der aus Händen springt. Der über Jugendliche schreibt, die nicht wissen, wohin mit ihren Füssen im Bus und herausfinden, wie sie sich gegen Überwachung wehren können.
Gleichzeitig hat Berg eine permanente Medienpräsenz. Viele Talkshows, ein gut gefütterter Instagramfeed und Podcastauftritte. They erzählt von sich, vom Leben, wie they zur Welt steht. Wir denken, wir kennen Berg, bis wir merken: We really don’t. Wir wissen gar nichts. Was ist gelogen, was nicht? Ist das they selbst oder ein*e Schauspieler*in, die they spielt? Wie befreiend dann manchmal das Gefühl so einfach an der Nase herumgeführt werden zu können. Wir findens nicht raus.
Stephanie Catani schreibt in ihrem Text «Aber wenn ich schon dieses seltsame Leben geh, will ich Applaus» (ein Zitat Bergs) über mediale Mechanismen, die Sibylle Berg inszenieren und auch: Wie sich Berg selbst via Medien inszeniert. «Der Marktwert eines Autors und einer Autorin misst sich an deren Medienwirksamkeit», so Catani. Sie betont dabei, dass das Konstrukt Autor*in nicht der Privatperson entspricht. Sondern es ist ein Autor*innenbild, «das im literarischen Feld» hergestellt wird. Via literarischer Texte der Autor*innen, wie auch Medienberichten und -auftritten. Bisschen Foundation, bisschen hell ausgelichtet werden. Ist das jetzt überraschend, dass das für eine queere Person oder eine Frau meist weniger cool ist, als für einen Mann?
In einer Studie von frauenzählen kam raus, dass 64% der besprochenen Bücher von Autoren stammen. Die Kritiken werden im Verhältnis 4:3 von Männern verfasst. Und männliche Kritiker rezensieren vor Allem männliche Bücher. Die Welt der Buchkritiken ist also überwiegend maskulin.Wenn über Bergs Texte geschrieben wird, so tauchen diese (wenn überhaupt) meist erst am Ende der Artikel auf, nachdem diese sich zuerst nur mit der Figur Bergs beschäftigen, so Catani. Der Zwang einer Frau sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht mit ihrem Schaffen. Berg stört, «dass die Arbeit immer erst gegen Schluss auftaucht und es vorher endlos um Äusserlichkeiten geht und darum, dass man als Frau nicht so zu schreiben hätte.»
Als Autor*in ist es also nicht einfach aus der Rolle der Frau auszutreten und einfach als Schreibende*r im Rahmen des Berufes wahrgenommen werden. Virginia Woolf zeichnet eine Utopie: «Sie schrieb als Frau, aber als Frau, die vergessen hat, dass sie eine Frau ist, sodass ihre Seiten voll waren von jenem seltsamen Reiz des Geschlechts, der sich nur einstellt wenn das Geschlecht sich seiner selbst nicht bewusst ist.»
Sibylle Berg steuert dem durch Kontrolle entgegen: «Berg überlässt die Inszenierung des eigenen Autor-Labels bewusst keinen ausschliesslich fremdbestimmten Prozessen, weil sie um die mitunter problematischen Mechanismen des öffentlichen Interesses an der Autorfigur weiss», so Catani weiter.
Und wenn wir das nächste mal hören, dass Berg «Ich lüg dann eh nur» in eine Kamera sagt, dann freuen wir uns doch einfach für they. Wie gut, dass Berg lügen kann, wie gut, dass ein fehlendes Versprechen von Wahrheit macht, dass Personen (zum Beispiel queere Personen und Frauen) an denen ein starkes voyeuristisches öffentliches Interesse besteht, sich dann privat und medial freier fühlen. Wie gut, dass Berg sich dadurch Souveränität verschafft und nicht allein durch männliche Literaturkritiken bestimmt wird.
«Schreiben Sie über die Welt, wird es heissen: Sie erklärt die Welt aus der Sicht einer Frau» sagt Berg und zeigt einigen patriarchalen Feuilletons den Mittelfinger. Sie hat keine Lust darauf, so ein Autorengenie zu sein, wie es in der Literaturwelt das nonplusultra ist. What are you so afraid of?
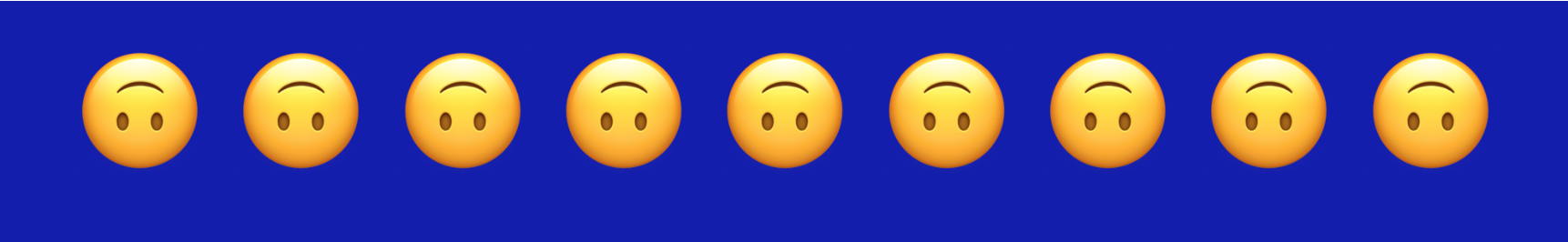
*in Bergs Instagrambio stehen die Pronomen they/them, auf Bergs Webseite steht non-binär aber es wird das weibliche Pronomen verwendet, ich bin verwirrt, es ist okay, ich verwende hier they
Quellen
Catani, Stephanie (2020). «Aber wenn ich schon dieses seltsame Leben geh, will ich Applaus». Mediale Mechanismen der Autorschaftsinszenierung bei Sibylle Berg. In: Text + Kritik 225.
Berg, Sibylle (2019). GRM. Brainfuck. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Berg, Sibylle (2015). Wie halte ich das nur alles aus? München: dtv Verlag.
Böller und Brot (2016). Wer hat Angst vor Sibylle Berg? (Dokumentarfilm)
Woolf, Virginia (1929). Ein eigenes Zimmer. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

In Zeiten von Mely Kiyaks «Frausein» oder Margarete Stokowskis «Untenrum frei» (ok, ja, das ist schon länger her) und vielen weiteren autobiographisch angehauchten Werken, taucht die Frage auf, was das denn für ein Ding ist. Das über-sich-schreiben. Diese Lebensgeschichten und -ausschnitte, persönliche Schicksale. Ein Genre, das gerade oft gelesen wird. I want to know, how you grew up and why you cry by night. Einblick in ein Leben einer anderen Person. Hat das was mit mir zu tun?
weiter ...
Sichtbar unsichtbar ist ein Buch, das fünf Frauen herausgegeben haben: eine Sammlung verschiedener Beiträge zum Thema «autobiographisches Schreiben». Lebensrealitäten sichtbar machen, ist laut ihnen Teil eines feministischen Kampfes und genauer wissenschaftlicher Arbeit.
Schreiben Personen ihr Leben auf, kann das eine historische Quelle sein, die uns Infos zu Leben gibt, die in Geschichtsbüchern oder anderen Erzählungen meist ignoriert werden. Es geht um das «making visible» von Realitäten. Und wenn sie schriftlich fesgehalten und somit vielleicht auch Teil von Wissenschaften werden, dann geht es sogar um ein «keeping visible». Nicht zu vergessen also.
Subjektive Quellen von Einzelerfahrungen also, die aber vielleicht, wenn ganz viele davon geschrieben und gelesen werden, dazu führen, dass wir Muster entdecken. Mosaiksteine führen zu grossem Ganzen sozusagen. Eine ganze Menge an Alltagswissen ist zum Beispiel für die Geschlechterforschung genauso wichtig, wie «objektivere» strukturelle Beobachtungen und Statistiken. Das eine lässt sich aus dem anderen ableiten. Mit stereotypen Erzählungen von Leben brechen. «Im lyrischen Sprechen tritt die ‹kunstschaffende Frau im Literaturbetrieb› vor die Augen der Lesenden», so De Felip in sichtbar unsichtbar. Also: Wer schreibt und wieso schreiben sie?
Laut Nünning gehts darum, Erinnerung ins «kollektive kulturelle Gedächtnis» zurück zu holen. Es werden verschiedene Versionen von gemeinsamen Vergangenheiten geschrieben und damit auch Platz für die eigene Identität geschaffen, wo kann ich mich drin finden? Grossmas schreibt, dass durch die Autobiographie eine emotionale Ebene hinzu kommt, die die Nähe zum Text verstärkt, eine Identifizierung verstärkt. Weil wir wissen wers geschrieben hat und dass das meiste wahr ist. Die Autobiographie vereint so Einzelschicksal mit Gemeinsamkeit, weil eine Menge von Personen sich mit der Geschichte einer identifizieren können.
Klar können wir uns fragen, ob wir uns denn wirklich immer mit dem Buch, das wir lesen, identifizieren können müssen. Ob vieles, das wir in unserem Leben machen, ein Spiegel von uns sein muss. Doch genau darum gehts, dass das nicht so ist, klar müssen wir das nicht. Aber es kann verdammt gut tun, ja für einige Personen lebenswichtig sein. Sich gesehen und repräsentiert fühlen.
In der, ich sag mal, jungen coolen queeren Buchsszene Deutschlands (i am thinking Hengameh Yaghoobifarah oder Paulina Czienskowski zum Beispiel) sind auch nicht-autobiographische Bücher immer mehr an Personen gebunden. Weil viele von ihnen politische Figuren sind, das Buch zu ihrem Instagramauftritt gehört. Damit wird ebenfalls eine klare Trennung von Autor*in und Buch aufgehoben. Personenkult nicht nur blöde, denn: Ja, oft spielt es ne Rolle, wer was geschrieben hat.
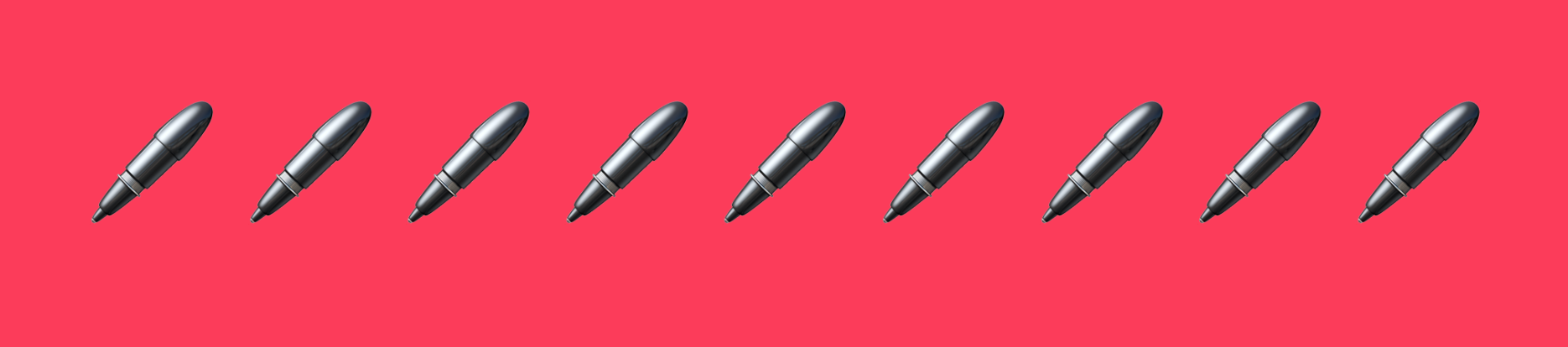
einige autobiographische Werke
Sophie Passmann, Komplett Gänsehaut (2021)
Tove Ditlevsen, Abhängigkeit (2021)
Semra Ertan, Mein Name ist Ausländer (2020)
Dorothee Elmiger, Aus der Zuckerfabrik (2020)
Mely Kiyak, Frausein (2020)
Ronya Othmann, Die Sommer (2020)
Linus Giese, Ich bin Linus (2020)
Saša Stanišić, Herkunft (2019)
Sheila Heti, Mutterschaft (2019)
Enis Maci, Eiscafé Europa (2018)
iO Tillet Wright, Darling Days (2017)
Margarete Stokowsi, Untenrum frei (2016)
Rebecca Solnit, Wenn Männer mir die Welt erklären (2014)
Maggie Nelson, Die Argonauten (2015)
Joan Didion, Blaue Stunden (2011)
Patti Smith, Just Kids (2010)
Annie Erneaux, Die Jahre (2008)
Quellen
Grossmass, Ruth und Schmerl, Christiane (1996). Leitbilder, Vexierbilder und Bildstörungen über die Orientierungsleistung von Bildern in der feministischen Geschlechterdebatte. Frankfurt: Campus.
Heidegger, Maria / Kogler, Nina / Schmitt, Mathilde et al. (Hg*innen) (2015). sichtbar unsichtbar: Geschlechterwissen in (auto-)biographischen Texten. Bielefeld: transcript.
Nünning, Ansgar / Stritzke, Nadyne und Nünning, Vera (2004). Erzähltextanalyse und Gender Studies. Stuttgart: JB Metzler.
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Genderstudies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog des Literaturhauses St. Gallen. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Schon gesehen? Zwei neue Blog-Beiträge von Alice Weniger: «Dreimal eine Jugend» und «Androgyne Literatur?», online seit Mitte Februar. Come and read!
weiter ...Direkt zum Blog qua Klick auf den Titel:
A propos androgyne Literatur: Wer kennt weitere Bücher, die dazu gezählt werden könnten? Unter allen Einsender:innen verlosen wir drei signierte Exemplare von Anna Sterns «das alles hier, jetzt.»
Mails an literaturhaus@wyborada.ch.
Wir sind gespannt!

Akademisch soll das sein, was eine Person an einer Uni lernt, bedeutet gleichzeitig aber oft auch Ausschluss. Weil wichtige oder spannende Inhalte nur via Vorwissen verständlich sind. Weil das, was an einer Uni oder in der Schule gelehrt wird, einem Kanon folgt, der von wenigen geschaffen wurde und nur wenige beinhaltet (und zwar die immer gleichen Namen seit Jahrhunderten). Also hier mal alle Scheinwerfer auf Audre Lorde statt Rainer Maria Rilke. Auf Cornelia Goethe statt ihren Bruder. Darauf, dass Literatur viele Geschlechter hat und politisch sein kann. Universität für alle, denn sonst hat sie keinen Wert, non? ///
weiter ...Wenn wir davon ausgehen, dass Literatur etwas bewirken kann, was genau geschieht, wenn sie androgyn ist, sie ihr Geschlecht gewissermassen vergisst?
Ein Beitrag darüber, dass Androgynität oder auch Geschlechtsvergessenheit auf verschiedenen Ebenen (nicht) stattfinden kann. Auf sprachlicher Ebene (also linguistisch betrachtet), via Figuren, Geschichten und in Theorien über Geschlecht und Literatur.
Literatur, die, einfach gesagt, was bewirkt nennt Literaturwissenschaftler Thomas Ernst subversive Literatur «die sich aus einer minorisierten Position heraus kritisch zu den komplexen, flexibilisierten und globalisierten Verhältnissen positioniert.» Sie soll die Ordnung stören und gegen Herrscher*innen schreiben, klassische künstlerische Sphären verlassen. Subversive Literatur soll sich nicht klar zuordnen lassen und Binaritäten hinter sich lassen. Mit Binaritäten sind zweiteilige Bedeutungswelten gemeint, wie zum Beispiel Geschlecht = männlich oder weiblich.
Das passt auch gut zu Judith Butler, die in ihrem Buch Gender Trouble über diese Binarität schreibt. Wird sie durch Pluralität ersetzt, also durch ganz viele verschiedene Geschlechteridentitäten, dann wird immer klarer: Geschlecht ist nicht natürlich forever ein Leben lang festgelegt, wenn dus› nicht fühlst. Geschlecht wird durch diese Pluralität weniger einfach festgeschrieben und damit auch die Erwartungen, die Personen heute durch ihr Geschlecht erfüllen (müssen). In Hass spricht meint Butler auch, dass das via Literatur passieren kann.
Ich stelle mir vor, wie Adam und Eva einander anlachen, sich gegenseitig einen geschlechtsneutralen Namen geben, wie «Finn» oder «Nico», die Blätter von den Körpern reissen und damit zwei Zigaretten drehen, währenddem sie ihre Genitalien austauschen.

Und was könnte denn jetzt mit androgyner Literatur gemeint sein?
Es geht nicht unbedingt darum, dass sich Figuren in einer Geschichte als non-binär outen sollen, sondern darum, dass das Geschlecht der Figuren auch mal einfach egal ist. Dass wir lesen, ohne uns überlegen, ob wir uns gleich wie eine Figur oder anders als sie definieren. Dass ein Buch eine gewisse Geschlechtsvergessenheit auslöst.
Via literarische Figuren kann auch gezeigt werden, dass sich Geschlecht im Verlauf des Lebens immer wieder ändern kann. Vielleicht nimmt das dann ein paar Menschen Druck, flüstert uns vor allem aber auch wieder «Geschlecht ist nicht natürlich» ins Ohr, die gute alte Leier eben.
Das spannende ist auch, dass Sprache selbst auch binär, also zweiteilig, organisiert ist. Darauf ist Ferdinand de Saussure gekommen. Es gibt bei jedem Wort zwei Seiten: Das Wort an sich (zum Beispiel Apfel) und das, was wir uns darunter vorstellen (zum Beispiel faust-gross, rot, rund, juicy). Ausserdem definieren wir Wörter auch immer durch das, was sie nicht sind, so Ferdinand. Eine Frau ist laut ihm also kein Mann. De Saussure war Strukturalist, danach kam dann bald Jaques Derrida und dekonstruierte diese zweiteilige Lehre. Hier nur kurz dazu, um zu zeigen, dass die literarische Welt sich lange sehr auf Zweiteiliges verlassen hat.
Androgynität kann in der Sprache heute zum Beispiel aussehen, wie es die Autor*innen vom Buch Intergeschlechtliche Körperlichkeiten vorschlagen:
«Das Deutsche ist geprägt von grammatikalisch meist eindeutigen maskulinen und femininen Formen, die das Geschlecht festlegen; mittels des Einsatzes von Unterstrichen, Asterisken [*], Binnen-I-Formen oder Schrägstrichen hat sich eine Vielzahl an Möglichkeiten etabliert, dieser Fixierung entgegenzuwirken. Die Entscheidung, in diesem Band verschiedene Lösungen nebeneinander stehen zu lassen, soll dabei verdeutlichen, dass auch diese Lösungsansätze nur Annäherungen an einen komplexen Sachverhalt darstellen, der sich jeder ‹destabilisierenden Fixierung› entzieht.»
Sie entscheiden sich also dazu alle Schreibformen zu verwenden, um zu zeigen, dass eine Festlegung (noch) nichts bringt und die Diskussion nicht fertig geführt ist. Vielleicht nie fertig geführt werden muss. Sprache entwickelt sich ja eh immer weiter. Es gibt die perfekte Form nicht und es muss sie auch nicht geben. Sprache zu ändern kann wichtig sein (z.B. gegen rassistische Diskriminierung). Sich aber daran auch nicht immer den Kopf zu zerbrechen und sie lieber etwas «underhopsi» zu führen und zu entlarven ist auch smart.
In Romanen, Theaterstücken oder Comics (et cetera) passiert es oft via Figuren, die darin vorkommen.
Autorin und Theaterregisseurin Nora Mansmann liess ihr*e Protagonist*in im Theatertext zwei brüder drei augen feststellen: «heute morgen bin ich aufgewacht und mein geschlecht war weg».
Auch Virginia Woolf bediente sich vor bald hundert Jahren, 1928, in ihrer biografischen Fiktion Orlando an einer geschlechtlichen Unklarheit: Orlandos Geschlechtsidentität ist fluid und verändert sich im Verlauf des Romans.
Eine weitere Stimme der (queer-)feministischen Theorie, ist die Donna Haraways und sie sagt uns, dass neue Technologien die geschlechtliche Natürlichkeit auf einen Untergrund setzt, der Treibsand gleicht. Die «Differenz zwischen natürlich und künstlich, Körper und Geist, selbstgelenkter und aussengesteuerter Entwicklung» wird von den «Maschinen des 20. Jahrhunderts» als unklar entlarvt. In ihrem Cyborg Manifesto schreibt sie von Mischwesen, die die Grenzen von Mensch und Maschine auflösen, gewissermassen geschlechtsvergessen sind.
Adam und Eva geben sich also vielleicht nicht nur geschlechtsneutrale Namen und tauschen Vulva gegen Penis, sondern sind Cyborgs, die das Paradies mit einer guten technischen Infrastruktur versorgen – Induktionsherde und indefinite Identitäten.
Vielleicht ja auch mal gut an Literatur nicht immer den Anspruch zu haben, dass sie die eigene Identiät spiegeln soll. Und uns für ne Zeit lang das Gefühl gibt, dass es egal ist, was für ein Geschlecht wir (jetzt gerade) haben.

Quellen
Baier, Angelika und Hochreiter, Susanne (Hg_innen) (2014). Inter*geschlechtliche Körperlichkeiten: Diskurs Begegnungen im Erzähltext. Wien: Zaglossus.
Ernst, Thomas (2013). Literatur und Subversion: Politisches Schreiben in der Gegenwart. Bielefeld: Transcript.
Haraway, Donna 1995: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt am Main /
New York: Campus.
Mansmann, Nora (2008). zwei brüder drei augen (Theatertext). Frankfurt am Main: Verlag der Autoren.
Woolf, Virginia (1994). Orlando: Eine Biographie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

In «Dreimal» werden immer drei Bücher oder Literaturprojekte zusammen vorgestellt. Und ein Zusammenhang aufgezeigt, der mal mehr, mal weniger besteht. Sie entsprechen gemeinsam einer Stimmung, einem Genre oder haben vielleicht Figuren, die sich ähneln. Es sind Bücher, die in der Bibliothek Wyborada eingeklemmt zwischen anderen stehen, Neuerscheinungen oder wiederentdeckte Wälzer. Drei als gute Zahl für ein Leseabenteuer. ///
weiter ...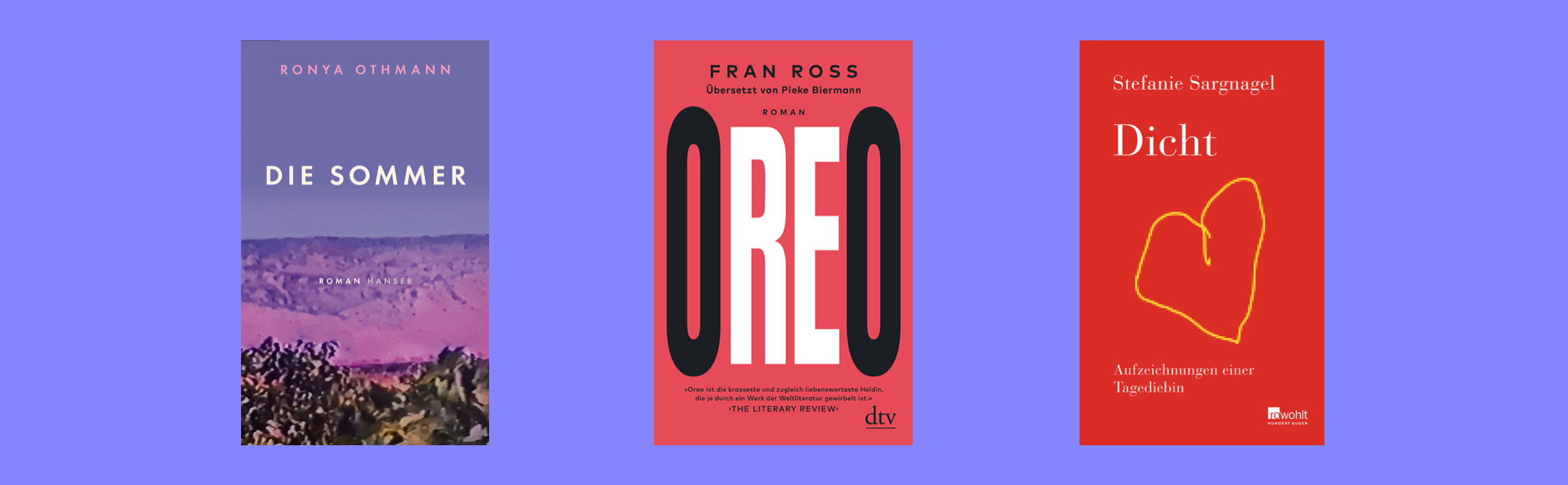
Jugend jetzt gerade hier in der Schweiz findet ohne die Cafés und die Pommesbuden und tanzen in Clubs statt. Oder Sommerferien relativ weit weg. Die Jugendlichen dieser Bücher erzählen davon, wie es ist, all das leben zu können. Und manchmal doch auch nicht. Weil das Geld fehlt, weil es Krieg gibt, weil erst was erledigt werden muss. Junge Leute lernen andere (junge) Leute kennen, an verschiedenen Orten und gehen dann gemeinsam eine Zeit lang durch den Sommer, die Nächte und in Wohnungen umher.

Stefanie Sargnagel, Dicht
Wir lernen mit Steffi die Figuren (oft depressive alte Männer) kennen, die im Café Stadtbahn sitzen und erzählen. Sie rauchen Kette. Sie waren mal DJs. Sie sind Dichter und laden zu Vernissagen ein, die nicht hip sind, aber gratis Wein ausschenken. Bei ihnen zuhause riecht es nach «Flohmarkt und Zigaretten». Nach dem Stadtbahn kommt das Joe’s und so wechseln sich in Sargnagels Buch die Stammkneipen ab, wie es die jugendlichen Jahre tun. Steffi trinkt drei Bier am Tag.
«Du bist die bekannteste anonyme Alkoholikerin, die ich kenne» sagt Michi.
«Voller Geschichten kehrten wir alle aus dem Sommer zurück in Michis Wohnung» schreibt Steffi.
Sie und Sarah finden Wege, sich als Kifferinnen aus den Armen der Polizei zu schälen, ein Stück Alltag. Und «wenn ich betrunken am Heimweg von Michis Wohung war, streifte ich manchmal noch allein durch die Clubs am Gürtel, B72, Chelsea, Rhiz. Ich kannte überall ein paar Leute und machte mich wie eine läufige Hündin auf die Suche nach ein bisschen Petting. Wenn ich mit irgendeinem Studenten geknutscht und gefummelt hatte, fuhr ich befriedigt nach Hause. Sexualität wurde für mich in dieser Zeit zu etwas, das man allein am Heimweg machte.»
Wir streifen mit ihr und ihren Freund*innen durch Wien, durch die Parks, die Cafés. Der Bewegungsradius der Protagonistin wächst mit steigender Seitenzahl. Lies das Buch, wenn du eigentlich Arbeiten müsstest, das fängt die Schul-Schwänz-Energy und die Stimmung jugendlicher Rebellion vielleicht ein bisschen ein.
«Wir konsumierten insgesamt wenig Kultur. Wir hätten zu grosse Angst gehabt, draussen etwas zu verpassen.»
Auf den letzten Seiten dann auch irgendwie das Ende mehrerer Jugenden mit einer Wohnung, die verloren geht und für diese stand. Stefanie Sargnagel legt ihre genialen Facebookstatusmeldungen für etwa 250 Seiten beiseite und erzählt eine Jugend der frühen Nullerjahre.
Rowohlt Verlag, 2020
Fran Ross, Oreo
«Freiheit ist, wenn du auf den Stühlen tanzt, zwischen denen du eigentlich sitzen sollst» steht auf der Rückseite des Neonroten Buches. Oreo sucht nach ihren «Wurzeln» ohne sich gänzlich von diesen festschreiben zu lassen. «Sie folgt der Theseus-Sage mit all ihren Volten bis zum letzten irrwitzigen Twist, dem Vatergeheimnis. Aber der antike Held ist heute jüdisch, schwarz und weiblich.» Das steht ihm Buch.
Es beginnt mit der Laune eines literarischen Sachbuchs, Ross bringt uns gut geordnet bei, was wir alles über Oreo wissen müssen, bevor der Tauchtrip in ihr Leben beginnt. Mischpoke, schön ausgeschreibene Steckbriefe der Generationen, die Oreo vorhergingen, um zu verstehen, in was für einen Kontext sie hineingeboren wurde. Wir lernen die Familie kennen und haben naiverweise kurz das Gefühl Teil von ihr zu sein.
Oreo will das Geheimnis um ihren Vater lüften und sieht die ganze Sache optimistisch. «‹Klar find ich den Motherfucker›, war ihre Antwort und Letzteres ihrer Ansicht nach genau le mot juste.»
Wir sehen La Carte du Dîner d’Hélène. Hélène ist Oreos Mutter, und die Gerichte darauf sind Louises Gerichte, das ist Hélènes Mutter. Es sind amerikanische und jüdische Gerichte, die sie für Hélène kocht und es ist, als ob ich als Leserin in ihrer Küche steh und die, an die Schränke geklebten Kochnotizen dort lese. Die Kleber schon bräunlich vergilbt.
Louise packt Mitte Buch Proviant für ihre Enkelin Oreo, die loszieht. Und «Nymphomanin Betty riss sich kurz von ihrem Vater los, um Oreo vom Schlafzimmerfenster aus zuzuwinken und hinterherzurufen: ‹Und vergiss nicht die versauten Postkarten, die du mir versprochen hast!›»
Wir wissen bald, was Oreo denkt, wenn sie in der U-Bahn in New York sitzt. Oder im «berühmten Bus der verrückten Frauen». Ross› Schreiben ist, als ob einem Oreo während dem Lesen immer wieder sehr kollegial auf die Schultern klopft und durch Manhattan hinterher schleift. Sie klappert verschiedene Samuels in New York ab und wir folgen ihr, versuchend Schritt zu halten, von Verkehrsmittel zu Park zu Waschsalon zu Public Library. Bis vor die Haustüre ihres Vaters.
dtv Verlag, 2019
Ronya Othmann, Die Sommer
«Eine Geschichte, dachte sie, erzählt man immer vom Ende her. Auch wenn man mit dem Anfang beginnt» steht im Prolog, der hinten ist. Die Sommer wird (nach westlicher Lesegewohnheit) von «hinten» nach «vorne» gelesen. Ich lese mich also zurück in Leylas Kindheit.
Es geht um Kurdistan als Herkunft, das nicht als solche akzeptiert wird, denn laut denen ist es einfach Syrien. Aber für Leyla ist es nicht das selbe. Am meisten ist Kurdistan aber nicht Bayern.
Ronya Othmann erzählt uns ihre Kindheit und Jugend via Protagonistin Leyla. Die Distanz zwischen ihnen politisiert das Buch und verallgemeinert Erfahrung. Leyla packt mich ein in die Sommerferien, an die ich mich zu gewöhnen beginne, bis es wegen dem Bürgerkrieg zu gefährlich wird. IS dort wo Zuhause auch ist. Der Genozid an den Jesiden 2014 lässt die Ferien nicht mehr Ferien und das Leben nicht mehr Leben sein. Ein Ereignis, das viele Jugenden, die in der deutschsprachigen Literaturwelt nur wenig erzählt und gelesen werden, trifft.
Leyla sieht im Fernsehen, wie ein Teil ihres Lebens, das sie vor Allem im Sommer lebt, zerstört wird. Sie hat Familie dort, sie hat Familie da wo der Fernseher ist. Sie kennt die Trockenheit der Böden und die Teppiche die darauf liegen und die Menschen die drauf sitzen. Und ist selbst in Bayern. Othmann erzählt uns Kurdistan auch jenseits des Schmerzes, voller Liebe und Alltag und Normalität. Erinnerung ist Widerstand.
«Besuchten sie Evîn in der Stadt, machte sie Kebab und Pommes für alle, zu trinken gab es Pepsi und Seven Up. Sie spazierte mit Leyla und Zozan zur Hauptstrasse, wo die Geschäfte waren und kaufte ihnen dort Eis.»
Es werden Marlboropackungen versteckt und die Kleider der Frauen glitzern immer. Leyla sucht sich ein Top aus mit dem sie sich in Kurdistan wohl fühlt und das sie in Deutschland nur in der Wohnung trägt. Nur die Angst vor den Schlangen, die nimmt sie mit. Unter das Bett in Bayern, in die deutschen Felder.
Carl Hanser Verlag, 2020

über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Akademisch soll das sein, was eine Person an einer Uni lernt, bedeutet gleichzeitig aber oft auch Ausschluss. Weil wichtige oder spannende Inhalte nur via Vorwissen verständlich sind. Weil das, was an einer Uni oder in der Schule gelehrt wird, einem Kanon folgt, der von wenigen geschaffen wurde und nur wenige beinhaltet (und zwar die immer gleichen Namen seit Jahrhunderten). Also hier mal alle Scheinwerfer auf Audre Lorde statt Rainer Maria Rilke. Auf Cornelia Goethe statt ihren Bruder. Darauf, dass Literatur viele Geschlechter hat und politisch sein kann. Universität für alle, denn sonst hat sie keinen Wert, non? ///
weiter ...Werfen, wie ein Mädchen ist ein Essay, in dem Iris Marion Young beschreibt, wie unser Geschlecht unsere Bewegungen, die wir jeden Tag machen, beeinflusst. Sie ist dabei nicht essenzialistisch, was das coole daran ist. Nicht essenzialistisch zu sein meint, dass sie Verhaltensweisen von Menschen nicht mit deren Biologie oder «Natur» erklärt, sondern mit der Sozialisierung, die eine Person erlebt. Schon schade, dass philosophische Texte, denen man an der Uni begegnet, oft so kompliziert geschrieben sind, wie Werfen, wie ein Mädchen. Bisschen wie Fisch sezieren, viel Lesemühe, bis der Inhalt dann mal wirklich begreifbar ist. Denn der könnte für viele wichtig sein. Dieser Beitrag soll also gewissermassen zeigen, dass es relevant ist, dass Texte einfach(er) geschrieben werden. Denn viele Theoretiker*innen stellen Vermutungen auf und sagen Dinge, die sehr emanzipatorisch oder informativ sein können.

Young überlegt sich, wieso sich viele Mädchen so bewegen, wie sie sich bewegen. Oder von was ihre Bewegungen beeinflusst werden. Mit Mädchen sind hier Menschen gemeint, die als solche gelesen und erzogen werden, es geht im Essay nämlich vor Allem um junge Menschen und die Erfahrungen in ihrer Kindheit. Es geht um Krafteinsatz, Haltung und Orientierung des Körpers. Um jene Bewegungen, die einen bestimmten Zweck oder eine Aufgabe erfüllen (wie zum Beispiel, einen Ball zu werfen, oder ein Glas zu öffnen). Der Essay kann insofern ermächtigend sein, weil er mit dem Vorwurf aufräumt, dass Mädchen «schwächer» sind. Aufgrund ihrer «Natur». Young sagt, dass das vermeintliche Geschlecht und die dazugehörige Biologie einer Person kaum bestimmt, was diese mit ihrem Körper alles tun kann. Aber das Denken, dass es etwas mit der Biologie einer Person zu tun hat, führt eben trotzdem dazu, dass Personen ihrem (gelesenen) Geschlecht entsprechend behandelt werden. Und das wiederum beeinflusst, wie sich eine Person durch Räume bewegt.
«Jede menschliche Existenz ist durch ihre Situation definiert; die einzelne Existenz der weiblichen Person ist also genauso durch die historischen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Grenzen ihrer Situation bestimmt.» (Young)
Es wird also nicht geleugnet, dass es manchmal Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, sondern festgestellt, dass dagegen etwas getan werden kann. Zum Beispiel mittels dieses Essays, um zu lernen, dass es so nicht sein und bleiben muss. Young sagt, dass es keine «ewige weibliche Existenz gibt», dass sich Geschlecht also immer (auch im Laufe eines Lebens) verändern kann und nicht alle Mädchen das Gleiche erleben. Sie sagt aber auch, dass es Dinge gibt, die oft gleich sind. Und um die geht es hier.
«Je mehr ein Mädchen davon ausgeht, dass sie weiblich ist, desto mehr empfindet sie sich selbst als zerbrechlich und unbeweglich und desto stärker vollzieht sie selbst ihr körperliches Gehemmtsein.» (Young)
Nun zu diesen Unterschieden, die nicht sein müssten. Am bezeichnendsten ist die Raumeinnahme und die Umfänglichkeit des Körpereinsatzes, die bei Jungs und Männern ausgeprägter ist, so Young. Bei Mädchen und Frauen sind zum Beispiel die Arme beim gehen oft näher am Körper. Auch untrainierte, nicht so starke Männer haben einen grösseren Bereich, weiter weg von ihrem eigentlichen Körper, in dem sie sich bewegen. Das hat also nichts mit Kraft zu tun. Frauen bewegen sich in einem bestimmten Raum, den sie seltener «verlassen». Bei einer Bewegung nutzen sie eher nur den direkt betroffenen Körperteil, zum Beispiel beim Öffnen eines Glases: Oft wird einfach das Handgelenk und die Kraft der Finger genutzt, statt die Kraft schon von den Schultern ausgehend zu gebrauchen.
Young benutzt den Begriff der gehemmten Intentionalität, womit sie meint, dass Frauen Bewegungen mit dem Gedanken «ich kann» beginnen, dem aber immer auch ein «ich kann nicht» entgegensetzen. Weil sie im Alltag und seit ihrer Kindheit weniger dazu animiert werden, alltägliche Kraftarbeiten zu machen. Weniger angefragt werden, um bei einem Umzug zu helfen, weniger adressiert werden, eine Kiste vom Regal ganz oben zu holen oder eine Lampe zu montieren.
Deshalb: Wenn immer ihr in einem Raum sind und ein Bier ohne Drehverschluss mit einem Feuerzeug öffnen wollt, fragt eine weiblich gelesene Person um Hilfe, wenn ihrs nicht selbst machen wollt oder könnt. Oder lasst euch solche Dinge von einer Freundin beibringen. Animiert die Grrrls um euch herum, alltägliche Kraftarbeiten zu übernehmen, damit das «ich kann nicht» auf dem Boden liegen bleibt und irgendwann vergessen geht. Viele Mädchen trauen sich kleine und grössere Bewegungen nicht zu, weil sie nicht im Zusammenhang mit diesen angesprochen werden. Sie sehen sich zu selten als Akteur*innen dieser.
«In den meisten Fällen wird Mädchen und Frauen weder die Gelegenheit gegeben, ihre gesamten physischen Kapazitäten in freiem und offenem Engagement mit der Welt zu beweisen, noch werden sie in gleichen Masse wie Jungen dazu ermutigt, spezielle körperliche Fertigkeiten zu entwickeln.» (Young)
Laut Young bewegen sich Mädchen und Frauen also seltener in Räumen, in denen sie ihre Kraft entdecken können. Versuchen wir diese Räume im Alltag doch wieder mehr herzustellen.
Ein weiterer Grund, warum sich Mädchen und Frauen gehemmter bewegen, ist, weil sie objektiviert werden, sich beobachtet fühlen. Das Verharren in der Nähe des eigenen Körpers ist also gewissermassen, so Young, ein Schutz. Die Frau entwirft ein kleines Gebiet, in dem sie Subjekt sein kann und nicht objektiviert wird.
Das alles müsste nicht sein, wenn mensch sich dem nur genug bewusst ist und mit neu geschaffenen Alltagspraxen entgegenwirkt (was viele bestimmt schon tun). Brennbälle auf schwer verständliche Texte – ich wünschte es gäbe Werfen wie ein Mädchen als Kinderbuch, das jedem Kind mit jedem Geschlecht das Gefühl gibt, sich so frei bewegen zu können, wie es Lust drauf hat. Auf Bäume klettern, das eigene Zimmer streichen und auf Schuldiskos frei und wild tanzen.
Werfen oder kämpfen oder rennen wie ein Mädchen heisst also eigentlich gar nichts. Es kann nicht als Beleidigung oder Herabsetzung benutzt werden, da Mädchen physisch genauso alles können, wie die anderen Geschlechter.

über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

In «Dreimal» werden immer drei Bücher oder Literaturprojekte zusammen vorgestellt. Und ein Zusammenhang aufgezeigt, der mal mehr, mal weniger besteht. Sie entsprechen gemeinsam einer Stimmung, einem Genre oder haben vielleicht Figuren, die sich ähneln. Es sind Bücher, die in der Bibliothek Wyborada eingeklemmt zwischen anderen stehen, Neuerscheinungen oder wiederentdeckte Wälzer. Drei als gute Zahl für ein Leseabenteuer. ///
weiter ...
In Deutschland gab es 1967 Schüler*innenproteste, folgend wurde Sexualaufklärung 1968 ins Pflichtprogramm der Schulen aufgenommen. Auch in der Schweiz eine öffentliche Debatte damals, 1971 fragt SRF Eltern, was sie von Aufklärungsunterricht halten. Ein Lehrer spricht mit seinen Schülern auf dem Fussboden eines Hallenbades über Masturbation, mit seinen Schülerinnen in einer Umkleide über Menstruation. Girls have to fight for their knowledge about orgasms, sie kriegen es nicht in der Schule.
Dann heute: Sekundarstufe in einem Ort im Toggenburg, auf der Wandtafel steht «Mädchen brauchen länger als Jungs bis sie kommen.» Kann gut sein, dass es ewig geht, wenn niemensch weiss, wie eine Klitoris funktioniert.
Wenn wir ins Rennen für selbstbestimmte Kids gehen, ist es wahrscheinlich schwer einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Was soll alles gesagt oder geschrieben werden? Geschlechtskrankheiten, klar. Die Vielfältigkeit vom Miteinander-pennen, of course. Der Zusammenhang von Sex und «Ich muss nicht» oder «ich darf Bock haben, all the time». Vielleicht gehts auch um Freund*innenschaften und Werbung auf Instagram und Algorithmen, die das Leben pasteller erscheinen lassen als es ist. Vielleicht ist es eine Endloskette von Themen, die zusammenkleben wie rosa Kaugummi. Vielleicht sind auch nicht nur die Bücher, die sich Aufklärung explizit zur Aufgabe machen, die die aufklären.
Hier drei Bücher, die diese Aufgabe nicht vollständig abdecken und ad acta legen, aber einen Teil zum Puzzle der Endlosigkeit beitragen.
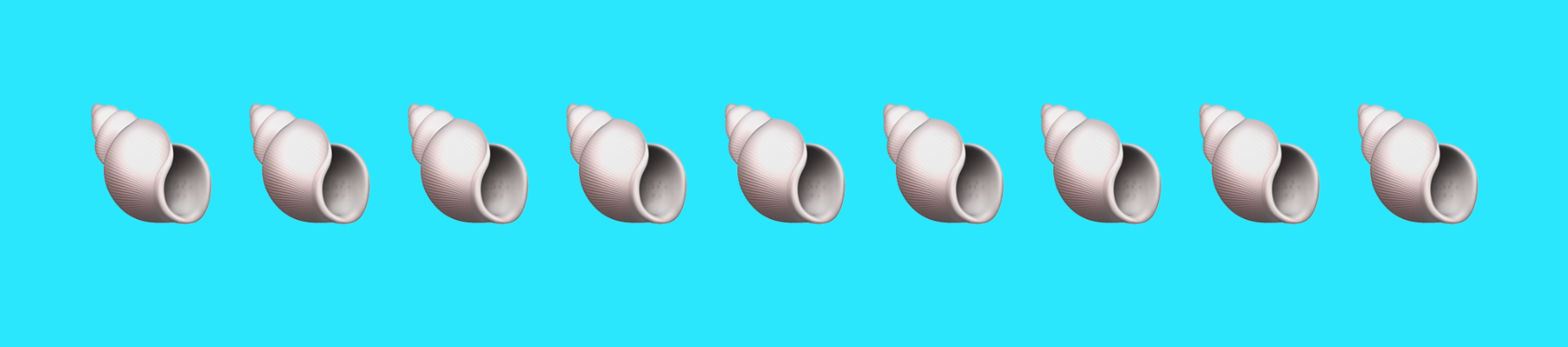
Oliwia Hälterlein & Aisha Franz, Das Jungfernhäutchen gibt es nicht
Wenn es um Aufklärung im «klassischeren» Sinne geht, wird oft auch vom ersten Mal gesprochen. Ein scheinbar grosses Feuerwerkereignis, krass, weil «Entjungferung». Mel C singt Never be the same Again in meine Ohren.
Es geht hier nicht darum zu sagen, dass dieses erste Mal nicht eine Bedeutung für horny Jugendliche haben kann oder darf. Es impliziert jedoch eine Vorstellung, was Sex ist (Penetration) und was nicht (zwei Vulvas die aufeinanderklatschen, gemeinsame Selbstbefriedigung, et cetera). Und der Entjungferungsmythos hängt nun mal mit dem sogenannten «Jungfernhäutchen» zusammen, das reissen kann. Gerade Mädchen werden über ein vorher und ein nachher definiert – ein Druck und eine Festschreibung. Im bunten Buchdeckel steht
«Alles über
blutbefleckte Laken
jungfräuliche Mythen
reissende Samthaargummis
elastische Frischhaltefolie
stossende Schwerter
geraubte Blumen
ausgeleierte Muschis
angebissene Äpfel
lüsterne Heilige
& patriarchale Könige.»
Gerade Vulva-Träger*innen wird damit vielleicht auch eine gewisse Lust am Ausprobieren genommen. Es gibt keine «Reinheit», die antizipiert werden kann und wenn es blutige Laken gibt beim Sex, dann nicht weil eine Haut reisst. Das Heft arbeitet die Geschichte dieses Mythos kulturwissenschaftlich auf und verweist in über dreissig Quellen auf medizinische Tatsachen, die gegen den Purismus der vermeintlichen Reinheit argumentieren.
«Fransen, Rüschen, Zotteln, hellrot und fleischig. Ich schenke meinen Schleimhäuten mit ihren Falten und Rezeptoren Aufmerksamkeit. Die Gesichtslippen sollen unmittelbar mit den Vulvalippen verbunden sein. In meinem Mund ist es feucht und glitschig. Ich ertaste mit meiner Zunge die Schleimhäute und stelle mir vor, dass ich gleichzeitig meine Vagina erforsche. Mein Bauch kribbelt und wie von selbst entspannen sich meine Mundwinkel. Ich benetze die Lippen und schmiege sie aneinander. Meine Zunge gleitet weiter. Nach oben und unten, nach links und rechts, vorne am Eingang und tiefer im Innern. Warm, weich und elastisch. Grossartig, diese Schleimhäute!»
Geschlechterforscher und Biologe Hans-Jürgen Voss flüstert mir und 200 anderen via Zoomvorlesung zu, dass sexuelle Bildung für Erwachsene immer wichtiger wird. Nicht nur Kinder und Jugendliche sollen aufgeklärt werden, we need it all.
Zieht euch diese 45-Seiten wissenschaftlich verarbeitete Informationen in literarischer Sprache rein und tell all the kids in the hood about it. Es gibt keine «Reinheit» und Girls müssen kein Kulturfetisch sein.
MaroVerlag, 2020
Sonja Eismann et al., Glückwunsch du bist ein Mädchen – Eine Anleitung zum klarkommen
Geilste 2013-Ästhetik trifft auf verschiedene Themen: Im ersten Kapitel Mädchen sein wird danach gefragt, wer die Regeln erfunden hat, wie ein Mädchen sein soll. Es wird in Judith Butler eingeführt, ohne dass es für dreizehnjährige zu kompliziert wird.
«Niemand wird als das eine oder andere Geschlecht geboren. Die Illusion, dass das Geschlecht angeboren sei, entsteht erst dadurch, dass wir die Eigenschaften, die das Mann- oder Frausein vermeintlich ausmachen, immer wieder wiederholen, also sprechen, gehen und handeln wie Männer und Frauen. Am Ende sieht es dann so aus, als hätte es das Geschlecht schon vorher gegeben – schon vor der Aufführung. Dabei kommt es erst dadurch zustande.»
In Freundschaft und Mädchensolidarität, dem zweiten Kapitel, geht es darum, wie Kritik aneinander geäussert werden kann, ohne sich unnötig weh zu tun oder inwiefern ein Konkurrenzdenken untereinander etwas mit Geld (nicht) haben zu tun hat. Es wird mit Studien gegen das Vorurteil geschrieben, dass Mädchen mehr lästern als Jungs und klar gemacht, dass wir auch viel voneinander lernen und uns unterstützen können.
In Sexualität gehts auch um Asexualität und die Frage, was nach dem Porno kommt. Die Klitoris ist viel grösser, als von aussen ertastbar und ein Orgasmus jagt deswegen manchmal durch die Beine bis zu den Zehen. «Guck dich doch mal anders im Spiegel an» ist das Credo. In Sport steht, dass alle BMX-Rad fahren können und Selbstverteidigung etwas mit der Riot-Grrrl-Bewegung zu tun hat.
«Nehmt Raum ein, wenn ihr euch in der Öffentlichkeit bewegt, macht euch nicht klein! Benützt eure Hände, um Fäuste zu ballen!»
Beltz & Gelberg, 2013
Liv Strömquist, I’m every Woman
«Das ist aber natürlich» sagt das kalte Draussen, «halt doch endlich die Klappe» sagt Liv Strömquist und ich schliesse mich lieber ihr an. Sie zeichnet gegen die Illusion monogam lebender Pinguine. Sie erzählt von den unsäglichsten Lover der Weltgeschichte: Karl Marx, Edvard Munch, Sting, Pablo Picasso, Albert Einstein, Elvis Presley, Jackson Pollock, Stalin, John Lennon. Damit will sie uns wohl sagen, dass der Wunsch nach einer romantischen Beziehung okay ist, aber nicht no matter what gelebt werden soll. Nicht wenn dir (Priscilla, 14) dein Traummann (Elvis, 25) sagt, du musst «rein» bleiben, zum Beispiel.
Strömquists Buch sagt eigentlich: Wir sollten alle die Möglichkeit haben, nur dann in Beziehungen zu sein, wenn wir Lust auf diese haben.
Die Geschichten verschiedener Frauen auf der Welt haben Zusammenhänge und wenn wir uns die Empathie zu eigen machen, können wir sagen «I’m every woman». Eine kollektive Verantwortung à la ich bin erst frei, wenn alle Frauen frei sind.
Avant Verlag, 2019
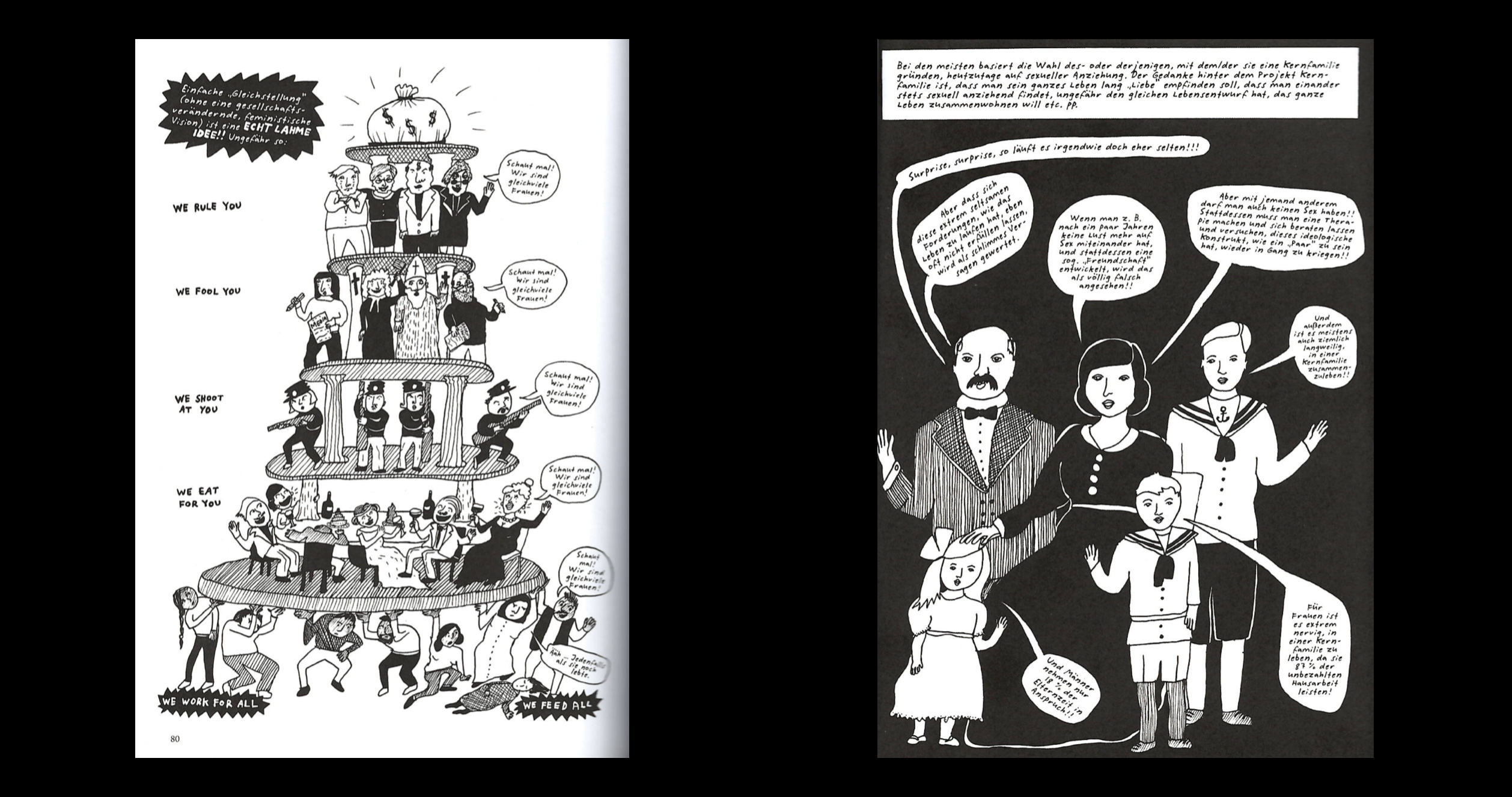
weitere Bücher:
Alicia Läuger, da unten
Myriam Daguzan, Unverblümt!
Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl, Schamlos schön
Henriette Wich und Anja Grote, Ach so ist das! Aufklärungsgeschichten für Kindergarten-Kinder
Sonja Eismann, Ene, Mene, Missy!
Juno Dawson, How to Be Gay
Jugend gegen AIDS e.V., FAQ YOU
Lydia Meyer, Sex und so – Das Aufklärungsbuch für alle
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Akademisch soll das sein, was eine Person an einer Uni lernt, bedeutet gleichzeitig aber oft auch Ausschluss. Weil wichtige oder spannende Inhalte nur via Vorwissen verständlich sind. Weil das, was an einer Uni oder in der Schule gelehrt wird, einem Kanon folgt, der von wenigen geschaffen wurde und nur wenige beinhaltet (und zwar die immer gleichen Namen seit Jahrhunderten). Also hier mal alle Scheinwerfer auf Audre Lorde statt Rainer Maria Rilke. Auf Cornelia Goethe statt ihren Bruder. Darauf, dass Literatur viele Geschlechter hat und politisch sein kann. Universität für alle, denn sonst hat sie keinen Wert, non? ///
weiter ...Hier soll es um Carla Kaspari, Arlo Parks oder auch lokaler: Jessica Jurassica gehen. Ich nenn sie jetzt mal Internettexter*innen. Was macht es mit der Literatur, wenn sie in sozialen Medien entsteht und publiziert wird? Was macht es mit Texten, wenn sie kaum Satzzeichen enthalten oder Gross- und Kleinschreibung egal ist?
Im Herbstsemester 2020 wollte ich eine Veranstaltung besuchen, die Schreiben ohne Regeln heisst, in der es darum ging, dass «das digitale Schreiben in den neuen Medien mit vielen Vorurteilen behaftet ist und diesbezüglich immer wieder sprachbezogene Befürchtungen geäussert werden: Vom Sprachverfall ist ebenso die Rede wie von fehlenden Rechtschreibfähigkeiten und mangelnden Sprachkompetenzen.» In der ersten Sitzung habe ich dann gemerkt, dass es überwiegend um Streitkultur in der Kommentarspalte geht, was mich weniger interessiert, als Auswirkungen auf literarisches Schreiben. Die Dozentin nannte Leute, die Tippfehler via Kommentarfunktion korrigieren «Grammarnazis» und mir wurde schlecht bei dieser Verwendung des Nazibegriffs, sagte ebendies und machte meine Belegung online rückgängig. Ein dann und wann auftretendes Uniphänomen sind Veranstaltungen, die im Beschreib spannender klingen, als sie sich später anfühlen.
Also, here’s to Internettexter*innen, die Literatur aus lektorierten Leinenbänden mit Schutzumschlag schleifen und eine leider meist unentgeltliche Selbstpublikation praktizieren.
@carlsparla
Carla Kaspari nennt es ihre Sturm und Drang Mentalität, die sie dazu bringt Gedanken sofort via Twitter ins› Netz rauszuballern. Der Reiz einer direkten Veröffentlichung. Über jedem Satz ohne Satzzeichen steht ihr Name, eine Trennung von Text und Autorin ist kaum möglich, auch das ist ihre Absicht. Die Kölnerin ist selbst weniger am Inhalt, sondern an der Form ihrer Literatur interessiert, sie schreibt parallel auch einen Roman. Was passiert mit einem Text, wenn er als Tweet startet und am Schluss in einem Buch steht? Was macht es mit dem eigenen Schreiben, wenn es genreübergreifend geschieht? Schon Virginia Woolf plädierte in Ein eigenes Zimmer dafür, dass Frauen* in mehr als einem Genre schreiben und sich so einer klaren Zuweisung innerhalb der Literaturbubble entziehen sollen. Quasi für eine Bewegungsfreiheit innerhalb der Medien, in und auf denen Literatur stattfinden kann. Hier einige Tweets.

@ahestae
Melissa gibt ihren Pflanzen die Liebe, die alle verdient hätten und vermisst Istanbul sicht- und lesbar. Immer auf der Suche nach Katzen, die sich auf den Rücken schmeissen und gekrault werden wollen, schreibt sie am Tag gegen Gewalt an Frauen die Texte, die alle lesen sollten.


@jessicajurassica
Straight out of Appenzell oder um via www.jessicajurassica.com die WOZ zu zitieren: «Wer bloss ist die Person hinter der Sturmmaske, die scheinbar ohne jedes Tabu über Drogen, Sex und ihren Ärger mit der Lohnarbeit schreibt? Eine Einzelperson oder ein Kunstkollektiv? Und hat sie sich tatsächlich das Tamedia-Logo tätowiert?» Auch bekannt(er) geworden durch die kinky Sexfiction über Alain Berset, medial unterschiedlich besprochen, aber oft heiss geliebt. Erotikliteratur ist das marginalisierte Girl in der Belletristikwelt, wann ist endlich Schluss damit? (mehr zu dieser Frage in einem Interview mit saiten.ch)

@arloparks
«I would say it was poetry first», dabei bezieht sich die Künstlerin auf ihre Musik. Geschichten als Kind, dann Lyrik als Jugendliche, «cause i was always more interested in imagery than plots». Und dann kam die Gitarre dazu, thank god, der soundtrack für vernebelte Novemberabende. Parks schreibt die meiste Lyrik, die oft auch als Songtexte funktioniert, in Notizen: das App auf ihrem iPhone oder analog, meistens während Busfahrten in der Nacht nach Hause in London.
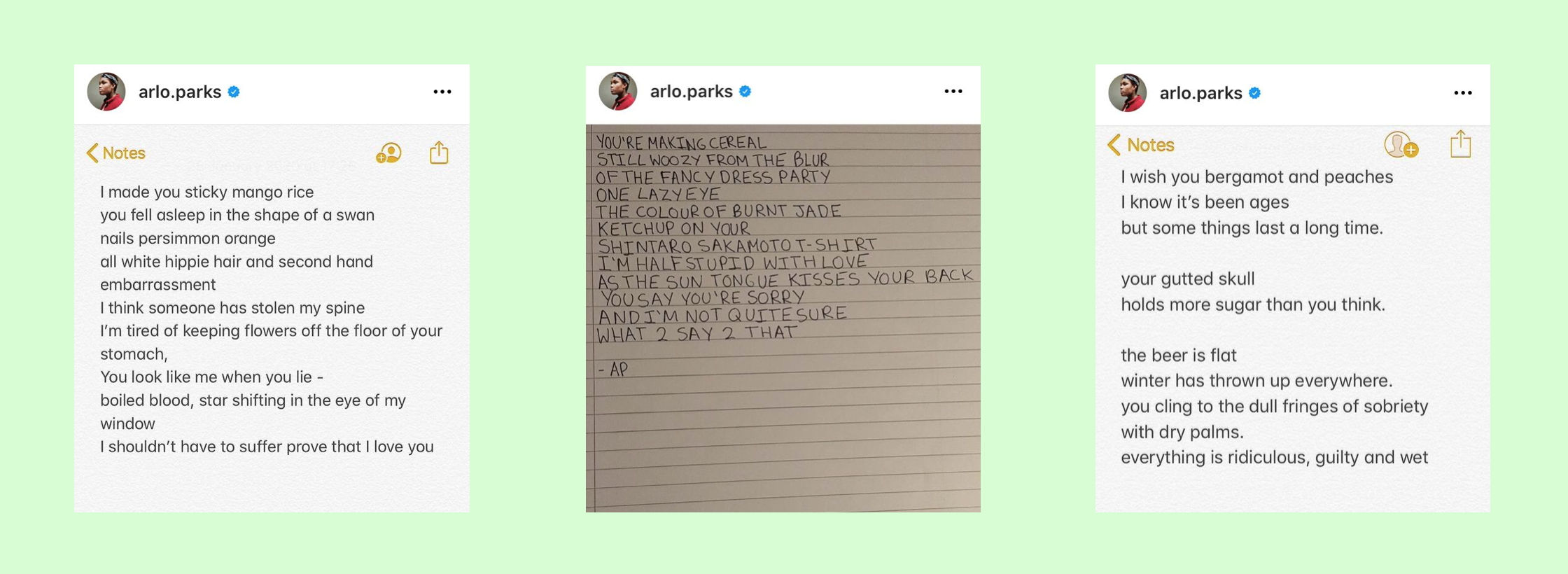
@annabridfiedler
Anna Fiedler spült mir genau dann Instagramstories von der Nordsee und gelesenen Büchern in den Feed, wenn ich es brauchen kann. Dazu ein paar Sätze, die sitzen und das Zugeständnis, dass das ästhetische Leben schon auch geil sein kann. Wir wissen, es ist nicht real, aber es kann gut tun, die Welt gerade dann anzuschauen, wenn der Lichteinfall schön ist. Ein Buch hat Anna auch geschrieben: Notizen über gemischte Gefühle, in dem die gemischten Gefühle einmal zusammen frühstücken und psychische Krankheit lyrisch verpackt wird – «die Poetisierung eines Gefühls auf der Kante.» Und auch hier wieder ein Mix von Genres: Whatsapp, Instagram und ein gebundenes Buch.


über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.
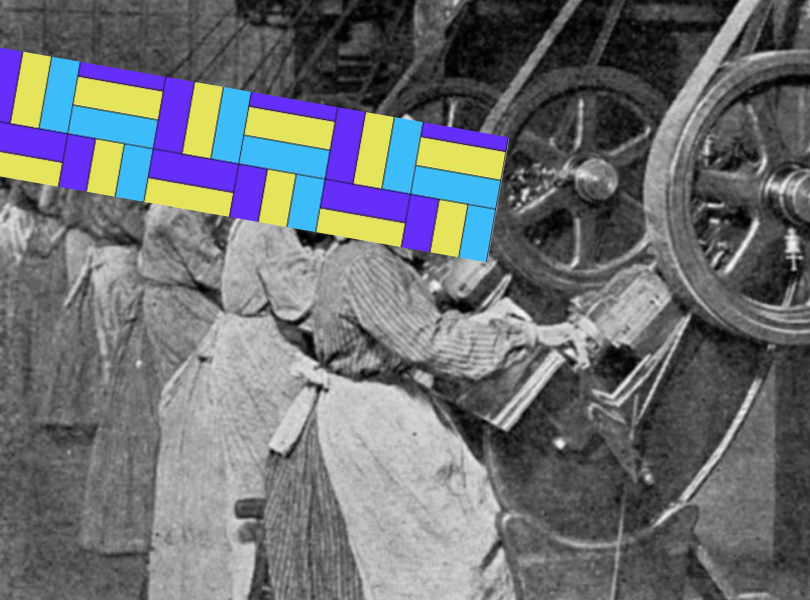
In «Dreimal» werden immer drei Bücher oder Literaturprojekte zusammen vorgestellt. Und ein Zusammenhang aufgezeigt, der mal mehr, mal weniger besteht. Sie entsprechen gemeinsam einer Stimmung, einem Genre oder haben vielleicht Figuren, die sich ähneln. Es sind Bücher, die in der Bibliothek Wyborada eingeklemmt zwischen anderen stehen, Neuerscheinungen oder wiederentdeckte Wälzer. Drei als gute Zahl für ein Leseabenteuer. ///
weiter ...Poledance. In einer Bibliothek weniger aluverpackten Lunch essen, als die Mitarbeitenden. Zuschauen, wie die Tochter in die selbsternannte Bourgeoisie abdriftet, während die Mutter einen Laden schmeisst. Die Erzählstruktur von einer Frau, die arbeitet und (fast) alleine ihre Kinder versucht grösser zu kriegen, funktioniert. Vielleicht weil die Empathie schnell da ist für den Lebensverlauf, der gesellschaftlich nur selten sichtbar gemacht wird.
Es ist einfacher darüber zu lesen, als es zu leben. Ein Buch als Projektionsfläche zu brauchen und solche Leben abzudrucken ist trotzdem kein schlechter Anfang, I think. Wenn wir von vielfältigen Familien sprechen, dann sollten wir nicht die alkoholisierten aber warmen Mamas vergessen. Und all die, die sich in einer Klasse bewegen, der sie zugewiesen wurden. Man muss es nicht «einfach genug wollen und dann kommt es auch», dieses bessere Leben.
Dreimal wird eine Realität von drei verschiedenen Frauen erzählt, ohne sie zu bemitleiden und ihr Leben als eines, das weniger okay ist, darzustellen. Die Stigmata bleiben auf der kalten Bank vor den Block- und Backsteinbauten sitzen, während darin ausgerastet, geliebt und fantasiert wird.
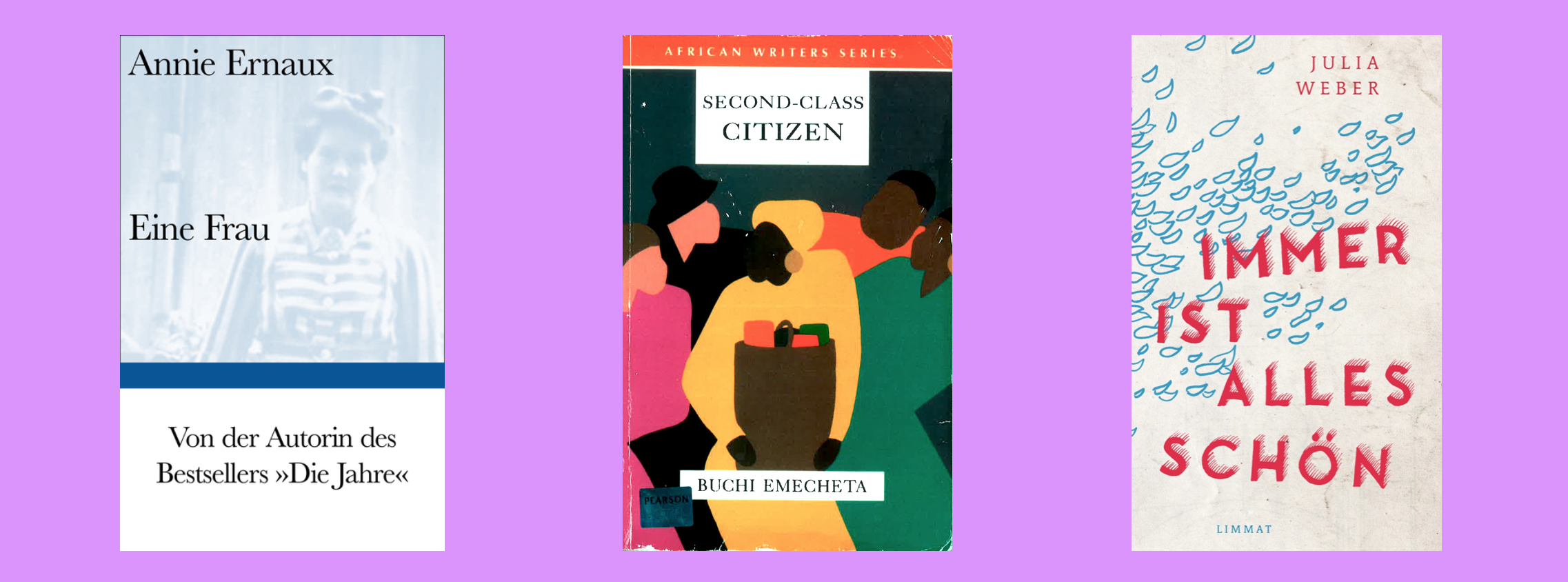
Annie Ernaux, Eine Frau
Annie Ernaux schreibt über ihre Mutter, sie möchte «die Frau zu fassen bekommen, die ausserhalb von mir existiert hat, die Frau, die am ländlichen Rand einer Kleinstadt in der Normandie geboren wurde.» Die Mutter hat als Kind den «hohen Töchtern der Privatschule Schimpfwörter zugerufen» und «sich nicht an die ‹Muschi› fassen lassen.» Als sie älter war weigerte sie sich, auf ihre «niedrige gesellschaftliche Stellung» reduziert zu werden.
Ernaux schreibt öfter mal einen sogenannten roman totale, was heissen könnte, dass eine individuelle Lebensgeschichte mehr ist, als eine individuelle Lebensgeschichte: «Ich versuchte, die Wut, die überschwängliche Liebe und die Vorwürfe meiner Mutter nicht nur als individuelle Charakterzüge zu betrachten, sondern sie in ihrer Lebensgeschichte und ihrer gesellschaftlichen Stellung zu verorten.»
Die Mutter wird zur allgemeinen Arbeiterin des Frankreichs des 20. Jahrhunderts.
Die Mutter eröffnet dann einen eigenen kleinen Laden, die Tochter geht mit dem Erspartem in der Tasche an die Universität und «manchmal stand ihr in Gestalt ihrer Tochter der Klassenfeind gegenüber.» Die andere Stadt und der andere Alltag schafft ein neues Verhältnis zwischen ihnen.
«Ich war mir ihrer Liebe und folgender Ungerechtigkeit sicher: sie verkaufte von morgens bis abends Kartoffeln und Milch, damit ich in einer Vorlesung über Platon sitzen konnte.»
Ernaux schreibt, dass dieses Buch zu schreiben auch ein Luxus ist. Dass sie bis zu ihrem 20. Lebensjahr dachte, dass sie Schuld daran sei, dass ihre Mutter alterte.
«Meine Mutter, die in ein beherrschtes Milieu hineingeboren worden war, das sie hinter sich lassen wollte, musste erst Geschichte werden, damit ich mich in der beherrschenden Welt der Wörter und Ideen, in die ich auf ihren Wunsch hinein gewechselt bin, weniger allein und falsch fühle.»
Suhrkamp, 2019
Buchi Emecheta, Second Class Citizen
«She made a secret vow to herself that she would go to this United Kingdom one day.» Das denkt sich Adah als Kind in Lagos, Nigeria. Im Oktober 2020 wird dort auf Demonstrierende geschossen, dieses Buch bringt uns nun zurück in die 40er-Jahre, wir lesen ein Leben einer jungen Frau, die Träume auf Europa projiziert und nie einen Mann heiraten will.
Das zweite tut sie dennoch und bei ersterem, dem Träumen, bleibt sie. Und Francis, der Mann, geht zuerst nach England: «When husbands left their wives for the UK the wives were all supposed to cry from love. Adah prayed to God the night before to send enough tears to impress her parents-in-law.»
Später reist sie ihm nach, der Rassismus spiegelt sich im Immobilienmarkt. Angekommen wird ihr klar, dass sie back home zur Elite gehören mag, in England dann aber zum secondclass citizen wird. Zweifach, weil Schwarz und weiblich. Sie arbeitet und hat Kinder, für Francis, damit er studieren kann.
Sie fragt sich «why she, and she alone, always felt she was letting those she loved down if she stayed away from work, even for the sake of having a baby. The funniest thing was that she felt it was her duty to work, not her husband’s.» Sie erzählt ihren Mitarbeiter*innen, dass das Kind zwei Monate später kommt, damit sie so lange wie möglich arbeiten kann. Denn er tut es nicht.
Das Leben in London ist ein kaltes in hässlichen Häusern und der Frage, ob der Glaube an Gott mit Adah auf dem Schiff mitgekommen oder Zuhause geblieben ist. Die Liebe zu Kindern und der Wunsch abzutreiben, die Frage, ob das Femidom sitzt. Sich trennen wollen, es dann doch nicht tun. Nur weil die Frau arbeiten geht und der Mann chillt, heisst es nicht, dass die Verhältnisse jetzt verqueert und geil sind.
In der Bibliothek, in der sie arbeitet hat sie irgendwann Freund*innen und liest Marx. Adah «was often quoting to herself that if the worst came to the very worst she would leave Francis with her children since she had nothing to lose but her chains.» Sie hat einen Mann, Kinder und einen Job und stellt sich die Frage, von was sie sich trennt. Nur vom Mann? Auch von den Kindern? Niemals von der Arbeit.
«Writing, to her, was like listening to good sentimental music. It mattered little to her whether it was published or not, all that mattered was that she had written a book.» Und an dieser Stelle wird klar: Wir lesen das Leben von Buchi Emecheta selbst, irgendwie.
Pearson ELT, 1994
Julia Weber, Immer ist alles schön
«Manchmal denke ich, dass Mutter zu gross, zu blond und zu lebendig ist, dann tut es mir leid. Manchmal wünsche ich mir eine Mutter mit mattem Haar, zerknitterter Schürze, sanften, müden Augen. Manchmal vermisse ich Mutter, obwohl sie da ist, und manchmal habe ich das Gefühl, sie sitzt in mir drin. Mutter sagte einmal, wenn man tanze, dann liebe man das Leben, und wenn man tanze, liebe einen das Leben auch.»
Das sagt uns Anais, die Tochter von Maria, der Mutter. Sie und ihr Halbbruder Bruno wohnen mit ihr in einer Wohnung, in der es viele verschiedene Dinge hat. An den Wänden, auf den Regalen, in den Schränken.
«Dann geht die Tür auf, und sie geht an uns vorbei, sieht uns nicht, geht auf den Balkon, zündet sich eine an. Das Windrad steht, kein Sonnenlicht, keine Schatten der Dinge. Es gibt das Geräusch von leeren Flaschen, die auf leere Flaschen fallen. Mutter fährt sich mit den freien Fingern über Hüftknochen und Bauch, als wolle sie sich damit bestätigen, dass sie sich selbst genug ist.»
Die Mutter tanzt und wird angeschaut dabei und kriegt Lohn dafür und sagt ihren Kindern, dass sie aufhört, wenn sie es wollen und dann können sie aufs Land ziehen. Später hört sie auch auf damit und sucht einen neuen Job, sie hat sich «jeweils alles angesehen, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, mich darin zu bewegen in diesen Räumen, mit diesen Gesichtern, diesen Blicken, in dieser Enge.» Das sagt sie über Gemüseläden und Anwaltbüros. Wo also liegt die berufliche Freiheit und kann es diese überhaupt geben? Eine Stange zum Tanzen kann sich freier anfühlen als ein Drehstuhl im Büro.
In den Kapiteln Maria und Mutter wechselt sich Anais’ Perspektive durch die Mutter ab und diese erzählt uns, wie sie sich das Leben früher vorgestellt hat, wie sich so ein Bauch mit Kind drin und all den Erwartungen dazu anfühlte. Maria wird also nicht einfach nur dargestellt, sondern sie kommt selber zu Wort. Erzählt uns, dass man nicht happy sein muss, mit einem Mann zu Hause, der Babyequipment kauft und dir die Vorfreude vor die Füsse legt: «Er kaufte einen Kinderwagen, und wenn wir draussen waren, legte er manchmal seine Hand auf meinen Bauch, als gehörte ich ihm und als wäre mein Bauch sein Bauch.»
Die Dialoge werden nicht durch Anführungszeichen sichtbar, sondern sind Teil des Buchs, wie es Beobachtungen sind. Was die Protagonist*innen denken und was sie sagen, ist nicht immer klar, die Grenzen zwischen Innen und Aussen vermischen und hinter allem die Frage: Wo fängt ein Körper an und wo hört er auf und wird er geformt von der Arbeit oder durch die Liebe der Mutter zu ihren Kindern oder von beidem oder nichts?
Julia Weber, die auf dem Literaturhausblog gerade eben mit Dragica Rajčić Holzner hin und her geschreiben hat, schreibt über ein schweres Thema in einer mega Leichtigkeit.
Limmat Verlag, 2017
über die Autorin
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genau so brutal, wie pathetisch und von unten geschrieben ist.
Bildquellen Collage: Wikiwand.com, blog.bernina.com
Eigentlich gibt es diesen Blog schon länger und das ist nicht sein Startschuss. Cara Roberta. zum Beispiel war vorher da. Ein Projekt, für das sich jeweils zwei Autor*innen, die sich real noch nicht kannten, Briefe schrieben und bei dem wir voyeuristisch und romantisiert mitlesen konnten. Zum Glück bleibt Cara Roberta. Aber einige andere Rubriken kommen hinzu, die vielleicht auch Spass machen, der Gegenwartsliteratur eine Form geben und versuchen, Literatur und Politisches aufeinanderknallen zu lassen: Uni Utopia und Dreimal sollen zeigen, dass bürgerliche Literaturdebatten, die aus der Schlucht einer Universität kommen, nerven und nicht nur dort eingeschlossen gehören. Sondern, dass Diskussionen über Texte und Bücher und all das an einen Tisch gehören, an dem alle sitzen.
Wie kann Literatur ermächtigend wirken?
Wer ist eigentlich diese Wyborada?
Sollen wir die Bücher von ihren Autor*innen trennen?
Was für Bücher gibt es, in denen das Geschlecht der Protagonist*innen egal ist?
Wo hat es coole Bücher mit juicy Sexszenen?
Sag mal, wo ist denn jetzt überhaupt dieses Literaturhaus?
Brauchen wir einen Palast, um darin zu lesen, oder kann es auch eine Hütte sein?
Ist ein Buch nicht eh immer kitschig, wenn das Wort Sommer im Titel vorkommt?
Sind Twitter, Instagram & Co. unsere neuen Bücher mit geilen Leuten, die sie veröffentlichen?
Was machst du, wenn du big im Buchbusiness bist, dich aber als Marxistin definierst?
Soll ich diesen Winter mal wieder einen Roman lesen?
Alles Fragen, die gestellt werden können und keinen Anspruch auf eine totale Beantwortung in diesem Blog haben. Aber vielleicht hier an- und von euch weitergedacht werden. Vielleicht auch nicht. Alles easy.
Uni Utopia
Akademisch soll das sein, was eine Person an einer Uni lernt. Das Wort bedeutet gleichzeitig aber meist Ausschluss. Weil wichtige oder spannende Inhalte nur via Vorwissen verständlich sind. Weil das, was an einer Uni oder in der Schule gelehrt wird, einem Kanon folgt, der von wenigen geschaffen wurde und nur wenige beinhaltet (und zwar oft die gleichen Namen seit Jahrhunderten). Also hier mal alle Scheinwerfer auf Audre Lorde statt Rainer Maria Rilke. Auf Cornelia Goethe statt ihren Bruder. Darauf, dass Literatur viele Geschlechter hat und politisch sein kann. Universität für alle, denn sonst hat sie keinen Wert, non?
Dreimal
In dieser Rubrik werden immer drei Bücher oder Literaturprojekte zusammen vorgestellt. Und ein Zusammenhang aufgezeigt, der mal mehr, mal weniger besteht. Sie entsprechen gemeinsam einer Stimmung, einem Genre oder haben vielleicht Figuren, die sich ähneln. Es sind Bücher, die in der Bibliothek Wyborada eingeklemmt zwischen anderen stehen, Neuerscheinungen oder wiederentdeckte Wälzer. Drei als gute Zahl für ein Leseabenteuer.
Also mal schauen, wie das wird. Schön, liest du mit.
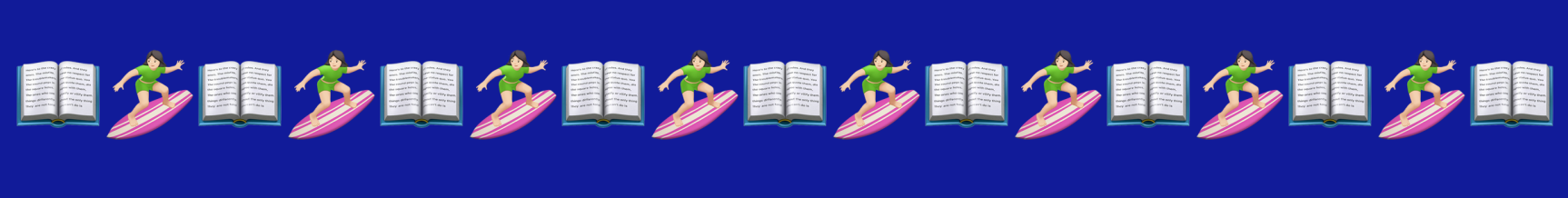
über die Autor*in
Alice Weniger studiert Germanistik und Gender Studies an der Universität Basel und schreibt seit dem Herbst 2020 für den Blog von Literaturhaus & Bibliothek Wyborada. Sie mag Literatur, die verschiedene Sprachen vermischt, genauso brutal wie pathetisch und von unten geschrieben ist.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 10: In der Logik unseres Briefwechsels, einer von mir gefühlten und keiner errechneten …
weiter ...Liebe Dragica
In der Logik unseres Briefwechsels, einer von mir gefühlten und keiner errechneten, hätte dein letzter Brief der Schluss sein können. So fühlt es sich an, ich danke dir für diesen, letzten Brief, aber nun sitze ich wieder einmal hier in der roten Fabrik, sehe hinaus auf den See, der aufgewühlt ist von schwimmenden Kindern über ihm ein Himmel mit weichen, kleinen Wolken und ein junger Mann, der mit sich selber spricht. Ich schreibe dir. Das Gefühl des Abgeschlossenen macht es nicht leicht und dennoch freue ich mich noch einmal nach Worten zu suchen für dich und eine verschwommene Aussenwelt. Dann ist es vorerst vorbei. Eigentlich, so denke ich, dürfte er nicht enden. Danach fahre ich in den Norden von Deutschland, zu den Eltern meiner liebsten Freundin. Dort werden wir unter dem Nussbaum sitzen, wenn die Sonne scheint und in der Stube, wenn es regnet. Ich hoffe auf ein Gewitter. Und auf die Schafe auf der Weide. Auf Boule spielen in Orangenlicht und mit einem Weisswein vielleicht und Nelly und Romy den ganzen Tag um mich herum kriechend, Blätter essend und rennend, Insekten suchend. Ich werde Bilder zeichnen, weil ich für einmal nicht schreiben will. Aber du hast schon recht, wir trocknen schnell aus ohne dem Schreiben. Unter dem Nussbaum noch etwas neues formen mit alten Worten, neue Bilder schaffen für das, was immer wieder auftaucht im Leben, scheinbar schon zu Ende beschrieben.
Ein schreibender Heinz neben mir. Es ist etwas vom schönsten, dass ich ihn habe, der die Sprache auch so braucht, wie ich.
Dass auch ich dir mit meinen Worten etwas geben konnte, bei dem Reichtum, das von dir zu mir herüber kam. Wie du Worte wie Teppiche ausrollst, auf denen ich stehen kann für Momente und in Gedanken wieder zu ihnen zurückkehren, Teppiche, auf denen ich vorher noch nie gestanden bin. Es erfüllt mich eine Sicherheit und gibt mir ein Gefühl, ein feines, mit mir und meinem Kopf am richtigen Ort zu sein. Für einen Moment. Wieder danke ich dir. Und ich befinde mich in einer Vorfreude darauf, was für Teppiche ich vielleicht noch ausrolle. In vollkommen anderem Muster, aber Teppiche, auf denen jemand stehen kann, vielleicht, für Momente und sein, und in all dem Unsinn und nicht wissen, die Füsse logisch darauf ablegen. Ein bisschen wie das Fahrrad, von dem du geschrieben hast, das Fahrrad anstossen und ein Schutz kann dann die Sprache im Fahrtwind sein. Mein Fahrrad fährt in diesen Wochen unseres Briefwechsels, als ob ich noch ein bisschen mehr Sprache habe für das Unsagbare, es umkreisen kann auf meinen Rädern.
Und gerade jetzt habe ich einen Glanz an Humor, weil ich von meinem Atelier aus auf den See blicke und dort schwimmen 20 Plastikbretter mit Menschen drauf und diese Menschen versuchen Segel aus dem Wasser an sich zu ziehen, Segel, die an den Brettern festgemacht sind und es gibt keinen Wind. Und abwechslungsweise und wie von einer Musik dirigiert fallen die Segel und oder die Menschen zurück in den See, dann steigen sie wieder auf und beginnen wieder die Segel hoch zu ziehen. Die orangenen Westen leuchten. Es ist fantastisch und ich staune über diesen Menschen, der wir sind, der sich Dinge ausdenkt, um seine Zeit, die er auf dieser Welt verbringt zu füllen, wo er doch weiss, es gibt keinen tieferen Sinn in seiner Existenz, vielleicht keinen tieferen, als ein Segel aus dem Wasser zu ziehen.
Liebe Dragica, ich kann noch nicht genau fassen, wie alles zusammenhängt, unser Schreiben und die Veränderung, das Schreiben aus unserer Generation heraus. Ich werde alle Briefe noch einmal als Ganzes lesen, es liegt etwas darin. Aber über was ich noch einmal nachdachte ist das Gefühl, du schreibst sehr nahe an deinem Leben, dir als Material, deine Geschichte und deine Geister, deine Seelen. Das mache ich schlussendlich auch, weil man hat ja nur sein eigenes Material, aber ich habe die Sprache, die ich in Biel herausgeschält (ein schönes Wort deiner Bekannten) habe, als etwas benutzt, als ein Werkzeug mich in möglichst Fremdes hinein zu fühlen. Als Werkzeug der Empathie sozusagen. Darüber habe ich nachgedacht, dass ich nun auf dem langsamen Weg bin, mir selbst im Schreiben näher zu kommen. Und der Weg, der sich richtig anfühlt. Als könnte ich mich nun an mich selbst wagen, weil meine Sprache mir Sicherheit gibt, dass ich nicht zu nah komme, nicht Bedeutung mit Kitsch verwechsle, nicht etwas, was nach Innen gehört, nach Aussen drücke und dann liegt es in fremden Händen, wo es nicht hingehört. Und auch das hängt wieder mit dem Fahrrad zusammen, dass ich plötzlich diese Sicherheit habe, dass das Ich als Material etwas sein kann. Denn ich dachte immer, möglichst nicht von diesem Ich schreiben, einem Schweizer Kind, aufgewachsen in vollkommenem Frieden, aufgewachsen in Zürichs Randgebiet mit grossem Garten, mit Insekten retten aus dem Swimmingpool, mit sich von Bienen stechen lassen, damit man nicht zum Klavierunterricht muss, mit Zuckerfröschen essen bis zur Übelkeit und vergrabenen Schätzen, mit Eltern, die Freunde in den grossen Garten einluden und Feste feierten und das Kind, das ich war, das unter dem Tisch sass und den teilweise betrunkenen Freunden zuhörte, ihre Geschichten von Fahrten mit der Vespa nach Indien oder vom Wandern auf der Rigi. Davon sollten meine Gesichten nicht handeln, das muss die Welt nicht hören, dafür ist kein Platz, für diese heile Welt des Kindes, dachte ich mir. Darum das weiter weg. Darum das Schreiben über die Figuren, die einen Platz suchen in der Welt, die keinen finden, an den Rand gedrängt oder zu still. Dann bin ich aber unweigerlich doch bei mir gelandet, zum Glück. Ich bin sie alle auch meine Figuren. Und so heil ist auch meine Welt nicht und die Wunden liegen überwachsen, vielleicht nicht einmal in meiner Generation entstanden, dennoch trage ich sie mit und die Welt hat genug des aufgeschürften und das Schreiben kann Trost sein, das ist ihr Antrieb, Trost innerhalb dessen, das unsagbare zu sagen. Was für eine wichtige Rückmeldung auf dein Buch von dieser, deiner Bekannten. Das kaum Sagbare herausgeschält.
Ich schreibe und denke die ganze Zeit, Dragica wird mir nicht mehr antworten, wo bleiben dann meine Sätze hängen, das ist kein Abschluss, ich warte auf Antwort, denke mir deine Stimme, die ich nicht kenne.
Was ich tun kann ist, ich gehe später in die Volkshaus-Buchhandlung, da kaufe ich alle Bücher, die ich von dir finde. Die lese ich dann, höre dir zu und vielleicht finde ich Briefe an mich darin, die auch Antwort auf diesen Brief sein können. Vielleicht finde ich neue Teppiche, ganz sicher bin ich mir. Ich freue mich sehr darauf. Viele Bücher will ich mir kaufen. Auch noch andere. Gerade lese ich das Buch Menschenkind. Von Toni Morrison. Jeden Abend, wenn die Kinder schlafen, setze ich mich auf den weissen Balkon, trinke Rotwein und rauche und lese von einer Welt, die ich nicht kenne, die meiner so fern ist, die weh tut, die weich ist. Weich ist ihre Sprache und so unglaublich elastisch und wie ein Laubhaufen, hineinspringen und manchmal wie unter Wasser keine Luft. Steine berühren. Und Eisen im Mund. Es tut weh das Lesen, danach gehe ich still zu Bett und in dieser Nacht träumte ich, dass ich in einem grossen Haus allein mit Geistern lebe und die Treppen führten nirgends hin. Ich weiss nicht mehr, was ich sagen wollte. Bin nahe an Tränen jetzt, weil die Geschichten, die literarische Sprache, die verschiedene Welten, Traurigkeiten oder Schönheiten nicht vergleichend nebeneinander stellt. Und das, was ich nicht kenne in mir aufhellt.
Liebe Dragica, du wirst es nicht glauben, es ist wie erfunden vor meine Augen gekommen. Ein riesiges aufgeblasenes Einhorn schwimmt nun in der kleinen Bucht vor meinem Atelierfenster.
Der Mensch, denke ich, der Mensch und aus einem beinahe Weinen wird ein beinahe Lachen. Ich danke dir für diese Zeit, das Hin-und-her-Gehen der Worte, deine, die mich eng begleitet haben.
Bis bald unter den Bäumen
deine Julia
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 9: Svijet je položen vodoravno …
weiter ...Svijet je položen vodoravno
na plamteću jasnoću moje kćeri:
ona nosi na usnama svoju prvu ljubav
još dok izgovara prve rečenice,
ona oprašta posječene šume i
raskrvavljena srca dok još ne vidi horizont
izvan ove topline, ona vjeruje da
taj svijet koji titra usred i izvan nje
u ravnini njenog prkosnog nosa
može biti svijet gdje će
svaka lutka biti pokrivena i voljena
I ništa nije jasnije od moje kćeri
osim možda ljubavi koja se prolijeva
iz moje pospanosti
dok prepričava
namjeru da ja postanem malena
pa mi pokloni svoje tenisice
Die Welt ist eingebettet waagrecht
auf brennende Klarheit meine Tochter:
sie trägt auf ihren Lippen ihre erste Liebe
während sie erste Sätze ausspricht
sie verzeiht uns ausgeholzte Wälder
und blutige Herzen solange sie nicht den Horizont sieht
ausser diese Wärme, sie glaubt dass die Welt
die in ihr wimmert und ausserhalb von ihr
der Welt ist
auf der jede Puppe geliebt wird
und zugedeckt
und nicht ist klarer meine Tochter ausser vielleicht die Liebe
welche sich aus meiner Verschlafenheit ergibt
während sie erzählt
ihr Vorhaben
mich zu verkleinern damit sie mir ihre Turnschuhe
schenken kann
Liebe Julia,
das ist ein Auszug aus einem Gedicht von Monika Erceg, 1990 geboren, Flüchtlingskindheit in der eigenen Heimat, Physikerin, Dichterin heute. Ich bringe dieses Gedicht, weil ich dir ein Zitat aus Musils Mann ohne Eigenschaftenversprochen habe und ich ihr Gedicht als Fortsetzung seiner Gedanken sehe, als eine Weiterführung, die das Thema unserer Briefe immer wieder am Rande streift.
Robert Musil äusserte sich eben auch im Buch gegen das Zitieren: „Es ist unmöglich, den Gedanken eines Buches aus der Seite zu lösen, die ihn umgibt.“
Ich tue es trotzdem.
Sie stellen sich also vor, „daß sie mit Arnheim in eine Art Heiligkeit davonfliegen möchten, […] man muß sich wieder der Unwirklichkeit bemächtigen; die Wirklichkeit hat keinen Sinn mehr! […] Ich war, was Sie nicht glauben werden, ein gutes Kind; so weich wie Luft in einer warmen Mondnacht. Ich könnte grenzenlos verliebt in einen Hund oder in ein Messer sein –“
„Glauben Sie denn wirklich, daß es ein grenzenloses Empfinden gibt?“, fragte Ulrich.
„Oh, es gibt grenzenloses Gefühl!“ erwiderte Diotma […].
„Sonderbarerweise sprechen wir oft davon, aber es ist gerade das, was wir lebenslang vermeiden, als ob wir darin ertrinken könnten.“
Musil, Der Mann ohne Eigenschaften I. Reinbek: Rowohlt, 25. Aufl. 2010, S. 574-575.
Ich habe lange gezögert mit diesem Brief, zum einem weil es mein letzter an dich ist in dieser Form, zum zweiten weil ich unterwegs bin, in der Schweiz, Lesung in Bern, Besuch eines Freundes im Kanton Jura und jetzt mit der Familie zum Abendessen in Zürich, wir feiern einen verpassten Geburtstag und die Auszeichnungen meines Buches. Aber während ich da zögere, sprechen die Blätter der Bäume vor unserem Balkon, darunter eine Blutbuche auch bei uns, und sie wird dunkler, die Blätter rauschen, am Morgen früh kommt die Sonne schräg und färbt die Tanne goldig wie im Herbst, während „unser“ Dieb-Vogel, ein exotischer, sich wie gewohnt meldet. So nah bist du hier, fast einen Steinwurf entfernt.
Also ich schreibe den abgefederten Brief; diese Bezeichnung gibt es nicht, aber ich führe sie ein, abgefedert, damit man nicht wie ein Ei zu Boden fällt, ohne Schutz. Aber ein abgefederter Brief, das wird auch heissen, ihn aus der Hand zu lassen, aufhören und nichts vergessen, den Abschied vor Augen. Ich denke seit Tagen, was noch nicht gesagt ist, was mir deine Briefe beigebracht haben, was anders ist jetzt? Ich las deine Kolumne über die Trauer, welche man versucht ist aus anderen zu vertreiben, so als wäre Trauer nicht berechtigt, in unseren Herzen zu sein, die Trauer braucht Zeugen, hast du geschrieben, sie braucht ein Votum da zu sein im Angesicht eines anderen Menschen, und sobald sie sein darf, dampft sie wahrscheinlich aus, das hast du nicht geschrieben, aber das versteht sich. Wie Recht du hast, aber ich denke, es gibt etwas mehr als Trauer, einen Schmerz des Entsetzens, welches einen Menschen so unvorbereitet trifft und so tief, dass er verstummt vor Scham, dass dies möglich ist zwischen Menschen. Ein Trauma entsteht aus diesem Nicht-berühren-Können dieser Wunde und aus Schweigen, davon handeln meine Bücher Glück und Liebe um Liebe. Und ich merke, vielleicht hast du mir erklärt was die Trauer bringt, Trauer bringt Frieden mit dem alten Schmerz, und bei mir war das Buch dieser Jemand, welcher mit mir getrauert hat, meine eigene Hand, welche mit mir in Worten mich mittröstete, da war. Darum – so Leere nach dem letzten Buch.
Nach meiner Lesung in Bern schreibt mir eine gute Bekannte, ich hätte Passagen gelesen, die mir so nah gingen, nicht weil ich einen ganz persönlichen Bezug dazu habe, sondern weil Du es so beschreibst, dass man direkt in der empfindlichen Haut der Protagonistin ist, mitdenkt und mitfühlt. Mir scheint, Du hast in 17 Jahren das kaum Sagbare herausgeschält mit einer grossen Ausdruckskraft, die im Leser tief mittönt.
Das ist eine Definition der Literatur und der Unterschied zum Kitsch, beim Kitsch fühlt man nur mit.
Ich glaube verstanden zu haben, warum du so schreibst wie du schreibst, weich, klar, liebevoll. Es ist wie ein Dagegenhalten im besten und wärmsten auf der Seite des Mensch-Seins mit dem Blick der Liebe … und das ist etwas Neues und Erstaunliches, dass es möglich wird. Die Bäume – ich dachte, da drin könnte unsere Forscherin forschen, es gibt so viel von den Pflanzen zu lernen, und das war mir in diesem Botanischen Garten ganz klar, und das auch dank unseren Briefen, endlich bin ich in ein Alter gekommen, wo mich Junge Wichtiges im Leben lehren, ich könnte sozusagen nur schauen, lesen, lernen, hören, und es erscheint mir so logisch und klar, es steht mir, uns noch eine so unglaubliche Zukunft bevor, denn diese Jungen sind anders als wir aufgewachsen, das, was sie uns lehren ist wertvoll und anders zwar als wir dachten, aber welche Eltern könnten so weit denken wie die Zukunft für sich denkt. Ich habe einen Film über den Verleger Klaus Wagenbach gesehen, er ist neunzig geworden, sein Leben ist eine Geschichte des Nachkriegsdeutschland. Seine Haltung aber muss man sich selber erarbeiten, und die Konsequenzen tragen. Links sein heisst für ihn, das Herz welches wirklich links ist dort auch zu lassen, weil das rechte Herz den Schwächeren verachtet und das ist dann kein Herz. Das Schönste im ganzen Film ist aber, wie er mit seiner kleinen siebenjährigen Tochter den Aufstieg auf die Berliner Hütte im Zillertal schafft und das Leben so voll lebt in diesen Jahren, so sehr hätte ich mir dies für meine Eltern gewünscht.
In meiner Generation, glaube ich, war und ist das Schreiben dagegen, das Aufzeigen der dunklen Seite nicht nur aber doch mehr als jetzt präsent, weil auch die Welt in den 1960er Jahren heller sein wollte als ihre Wirklichkeit, um den Krieg sagen wir mal wieder abzufedern. Das Gedicht von Monika Herceg, Jahrgang 1990, zeigt das, dieser Ausschnitt der Wahrheit eines Kindes, welches so viel gilt, und ausserhalb vom Naturgesetz ist eine eigene Wirklichkeit.
Die Ronny aus deinem Profilbild schaut zu mir genau so in die Welt, wissend und verständnisvoll. Im Botanischen Garten vor der Lesung, ich sah dort die L. mit ihrem Hund, und sah sie dort forschen in fünfzehn Jahren.
Pawlowna am Place de Escarpe in Paris, Paul Celan hat sie dort gesehen 1949, und später kommt sie in ein Gedicht für die Bachmann oder umgekehrt, so sah ich den Namen. Morgen fahren wir nach Leuk, nicht nur weil ich einmal ein literarisches Reisebuch in Leukerbad gekauft habe, in welchem Schriftsteller die Wanderungen dort beschreiben, wir werden zum Rilke-Grab in Raron gehen, das Wallis kennen lernen. Meine Kinder planen ihre Schweiz-Ferien und geben uns Tipps was wir noch nicht gesehen haben, letzte Woche waren sie in der Bieler Gegend auch. Apropos Biel, ich war am Samstag dort, aus reiner Nostalgie stieg ich aus in Biel, es war wie dass du mit mir gehst, was in Biel auffällt, sind sogenannte Randständige, welche immer an denselben Orten noch nach Jahren auf einen warten, ich lebte ja ein Jahr lang in Biel und hatte vor, einer ganzen Schule schreiben zu lehren, es war ein unglaublich strenges und gutes Jahr, ich durfte alles ausdenken, wie ich unterrichtet habe, und ich bin überzeugt, wenn Kinder erzählen dürften wie sie wollen, und ich bin nur da um dieses Velo in den Händen anzustossen, dann werden sie ihr ganzes Leben keine Angst vor Aufsätzen und vor der Sprache und dem Inhalt empfinden. Doppelte Wirklichkeit durch Schreiben zu bekommen … das sollte doch die Schule können.
Ich eile, weil ich meine Enkelin zum Schwimmen abholen muss, sie wird bald also sie ist schon zehn Jahre alt im August, sie kam aus der Ukraine mit vier Jahren und spricht mit ihrer Mutter Russisch und mit mir Deutsch, aber sie macht Kunstgymnastik und springt überall wie ein Federball leicht. Ich sehe sie zu wenig und bin jedesmal irritiert wie gross ist sie und was sie alles kann. Unsere Pläne, ein Buch zusammen zu machen über eine Lügnerin welche spielende Eltern hat und sie erziehen muss, wartet und ich hoffe wir schaffen es dieses Jahr.
Ihr geht auch bald in die Ferien, und das ist gut so, man braucht ausserhalb auch das Leben, obwohl nach allzu langen Zeiten ohne Buchstaben trocknet man aus (ich, du, … etc.), fast alle welche Kunst treiben und betreiben …
Liebe Julia, ich melde mich, wenn wir aus Leuk zurück sind, und wir gehen unter den Bäumen was trinken und reden, ich freue mich so drauf,
Deine Dragica
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 8: Während du dich von Ort zu Ort bewegst und deine offenen Fenster mich bewegen …
weiter ...Liebe Dragica
Während du dich von Ort zu Ort bewegst und deine offenen Fenster mich bewegen, während ich immer wieder am gleichen Ort mich befinde, um dir zu schreiben. Immer das Fenster zum See und immer ein Wetter. Heute die Klarheit von Sommer und weit hinter dem See die Alpen, die eine mögliche Weite begrenzen. Wie auch ich immer die Alpen in meinem Kopf vorfinde, wenn ich etwas wirklich erfassen will.
Vieles nehme ich in mich auf von deinen Worten. Die Worte zu deinen Eltern, die nicht mehr die Menschen sind, die sie einmal waren. Eine Traurigkeit, die sich in meine innere Wiese, die Hajenka, legt und ich versuche meine Alpen im Kopf zu überwinden, mir vorzustellen, wie das ist. Und denke an meine, die, seit ich wiederum Kinder habe, auch andere für mich geworden sind, aber auf eine, für unsere Beziehung von Kind zu Eltern, wertvolle Art und Weise. Jetzt gibt es zwischen uns noch Lebewesen, die, wie ich es fühle, die Enge, die manchmal durch langes Zusammensein und ihr Wissen über mich, das ich selbst nicht habe, entstehen kann, aufgelöst wurde. Wir können mit diesen neuen Rollen als Mütter und Grossväter und Grossmütter andere sein. Zum Beispiel habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben bei meinen Eltern entschuldigt, dass ich zu streng mit ihnen war. Sie meinten dann, das sei gar nicht schlimm gewesen, dass sie mit mir ja viel länger und viel strenger noch gewesen seien. Das stimmt wohl. Und auch sie sind Grosseltern, die nicht einmal zu langsam stricken, vielmehr stricken sie gar nicht. Aber ich mag ihr Grosseltern-Sein sehr. Weil sie so beschäftigt sind in ihrem Leben und dann Platz freiräumen für die Enkelkinder, wo sie nur können, weil sie wirklich gerne mit ihnen zusammen sind.
Wie wird es sein, habe ich mich nach deinen Worten gefragt und auch schon vorher, das Alt-Werden, das schleichend kommt, aber immer wieder in Augenblicken sichtbar wird. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Moment, als ich zum ersten Mal gedacht habe, jetzt, jetzt werden sie alt. Wir waren im Wald und meine Eltern, die Holz für das Feuer suchten und sie hängten sich gemeinsam an einen morschen Ast einer Tanne, weiter, im Inneren des Waldes. Ich stand neben ihnen und sagte, sie sollten doch nicht so hängen daran, der falle auf sie herab, wenn sie so an ihm hängen würden. Sie lachten und riefen, der muss aber ab, der Ast und dann brach er und fiel meiner Mutter auf den Kopf. Sie weinte und mein Vater entschuldigte sich und als es besser geworden war, sagte ich, habe ich es doch gesagt und sie sassen auf einem alten Baumstamm mit runzeliger Rinde zwischen den Bäumen und sagten gar nichts mehr.
Das war der Moment. Aber natürlich ist das etwas ganz anderes und ich habe Angst gehabt. Wie ich damit umgehen werde, wie es ist, ein Kind zu sein und die Eltern nicht mehr die Eltern wie man als Kind das Kind der Eltern immer ein bisschen bleiben konnte, bis zu diesem Moment. Kraft, will ich dir gerne schicken.
Neben der Geschichte der Körper, von der du geschrieben hast, der Schönheit, die ein Liebenswert sein sollte, gab es noch eine andere. Und es stimmt, es geht nicht um Schönheit, wie der Begriff ein Begriff ist in der Welt und dennoch hänge ich so sehr an ihm, daran, diesem Begriff ein neues Kleid zu geben, ein neues Wesen auch. Aber du hast Recht, es ist das Wort Liebenswert, das besser passt. Nur hat wiederum dieser Begriff ja auch ein Kleid und ein Wesen, das so sehr davon abhängig ist, was andere von einem denken. Liebenswert bedeutet, du bist es Wert, geliebt zu werden. Was aber generiert diesen Wert. Da wird es mir schon unwohl, bei diesem Wort, „Wert“. Und in der Schönheit ist für mich die Möglichkeit vom sich selbst lieben und auch von der Umwelt geliebt zu werden, in dem, dass die Farbe des Asphalts zu einem passt, der Klang der Stadt, die Menschen, die um einem gehen, die Katze in den Büschen und der überquellende Abfalleimer Samstagnacht. Schönheit, das Wort, das es zu befreien gilt. So dachte ich es.
Aber nun bin ich abgeschweift. Es gab noch eine andere Geschichte, die ich gelesen habe im Radio und darin geht es um Olga, die ihrer Mutter gegenüber sitzt und plötzlich so ergriffen ist von dem Gedanken, den sie als Kind manchmal hatte, was wäre, wenn es die Mutter nicht mehr gäbe und die Traurigkeit befällt sie und sie fragt schlussendlich die Mutter, ob sie ihren Kopf auf deren Bauch legen darf, aus dem sie in diese Welt gekommen ist. Und am Ende sagt die Mutter, Olga, es ist so schön, dass es dich gibt. Liegt da vielleicht ein Punkt, eine Möglichkeit von einem Sinn vom Existieren, dass wenn die Person, die einen in die Welt getan hat, auch die ist, die einem diesen Sinn geben kann, in dem sie einen Wert darin sieht, dass es einen gibt. Ich weiss es nicht, ich weiss nur, dass ich beim Schreiben dieses letzten Satzes losgeheult habe wie ein Wolf. Aber das ist wohl meine Geschichte, der ich noch nicht bis an seinen Anfang gefolgt bin und es wahrscheinlich nicht tun werde. Nur pflege und salbe und tröste ich mich selbst, in dem ich davon schreibe. Und, was ich eigentlich schreiben wollte, auf diese Geschichte habe ich die meisten Reaktionen erhalten von der Welt rundherum, und das erstaunt mich nicht. Vielmehr erstaunt es mich manchmal, wie scheinbar selbstverständlich wir die Kinder unserer Eltern und unsere Kinder unsere Kinder sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich sage zu meiner Tochter vielleicht zu oft, dass ich es unglaublich finde, dass sie in meinem Bauch entstanden ist und nun vor mir sitzt und mit mir über das Paarungsverhalten von Seelöwen spricht. Das ist doch verrückt, sage ich. Aber das ist ja bei allen so, sagt sie. Aber trotzdem, sage ich und versuche sie zu küssen und sie rennt weg. Da war ich drinnen, sagt sie vielleicht ab und zu, zu mir und zeigt auf meinen Bauch und ich beginne wieder zu heulen wie der Wolf.
Während ich dir schreibe, es ist schon so normal geworden und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht recht vorstellen, wie es ohne deine Briefe sein wird. Obwohl ich weiss, die Zeit wird diese Stellen auch füllen mit irgendwas, von dem ich aber befürchte, dass es nicht so tief sein wird. Während ich dir schreibe, habe ich bereits ein Gefühl für das, was von dir zurückkommen wird. Ich habe eine Stimme zu deinen Worten, die vielleicht gar nicht deine ist. Weil ich weiss nicht mehr genau wie du klingst.
Es ist eine erstaunliche Nähe, die da passiert. Ich freue mich sehr über sie.
Und das Bild der Hajenka hast du mir geschenkt. Meine Hajenka hat jetzt einige Blumen,
Rosmarin, Lorbeer, Meeresfenchel, Basilikum, selbstgepflanzte Wiesenblumen vom dalmatinischen Balkon mehr.
Ich werde sie beim nächsten Brief zu zeichnen versuchen.
Es gibt ein Glitzer heute auf dem See. Und ein Spatz, ich weiss nicht, ob es immer der gleiche ist, der gleiche, der damals hinter der Milchglas Scheibe erschien, ein Spatz, der immer wieder auf der Fensterbank sitzt und zu mir reinschaut. Dann, wenn er mich sieht, fliegt er fort.
In mir wohnt eine grosse Dankbarkeit für das, was meine Mutter und ihre Generation, also auch die deine, für uns, also meine Generation geschaffen hat. In mir wohnte lange ein Gefühl, dass ich es nicht nötig hätte mich so aufzubäumen und hart in Forderungen zu sein, gegenüber der Gleichberechtigung. Lange hatte ich das Gefühl, ich hätte doch alles, es stimme für mich und das ganze Thema sei erledigt. Dann bin ich älter geworden und habe realisiert, dass ich lange Zeit meiner Jugend damit verbracht habe, wie ein Junge zu sein. Mein Aufbegehren gegen die Ungerechtigkeit, die einem als Mädchen in dieser Gesellschaft widerfährt, bestand darin, das Mädchensein abzulehnen, alles, was damit in Verbindung gebracht wird. Es war einfacher sich als Mädchen, das wie ein Junge ist, durch die Jugend zu bewegen. So ein Irrtum. Und irgendwann habe ich mich bei meiner Mutter für ihre Arbeit bedankt. Für ihren Kampf und ihr Bestehen auf Formen der Weiblichkeit in Gesprächen, die mir manchmal unangenehm waren. Aber natürlich musste sie unangenehm sein und ich ging den einfachen Weg, versuchte ein Junge zu sein.
Etwas kurz gefasst, aber ich merke, dass meine Gedanken wieder etwas weich werden und die Sonne, die mir an den Kopf fällt. Ein Hund, dessen Bellen so hoch und gläsern ist, dass es mir im Kopf weh tut.
Liebe Dragica, wieder ein Gefühl, deinem Brief gegenüber nicht gerecht geworden zu sein. Diesmal aber, weil deinem Gewicht im Geschriebenen über deine Eltern, eine Leichtigkeit aus meinem Leben folgte. Auch dieses Gefühl wiederum hat mit dem Oszillieren dieser Briefe zu tun, innerhalb der Intimität und Öffentlichkeit. Ich freue mich auf deinen Brief, wünsche dir ein gutes Sein und nochmals, danke ich dir sehr für deine Gedanken,
Deine Julia
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 7: Za sve su kriva djetinjstva naša …
weiter ...- Juli 2020, Innsbruck
Vesna Parun (1922 – 2010)
Za sve su kriva djetinjstva naša
Izrasli smo sami kao biljke.
I sada smo postali istraživači
Zapuštenih predjela mašte
Nenavikli na poslušnost zlu.
Iznikli smo pokraj drumova
I s nama rastao je strah naš
Od divljih kopita koja će nas pregaziti
I od kamena međašnih koji će razdvojiti
Našu mladost.
Nitko od nas nema dvije cijele ruke.
Dva netaknuta oka. I srce
U kojem se nije zaustavio jauk.
Starimo. A bajke idu uz nas
Kao stado za ognjem u daljini.
I pjesme su nam takve kao i mi.
Oteščale i tužne.
Für alles sind unsere Kindheiten schuld
wir wuchsen allein wie die Pflanzen
und jetzt sind wir Forscher in zerrütteten Teilen unserer Fantasie
geworden
Wir sind nicht gewöhnt den Bösen zu dienen.
Niemand von uns hat zwei ganze Hände
Zwei unberührte Augen. Und kein Herz
in welchem der Schrei nicht Stopp gemacht hat.
Und gleichzeitig mit uns wuchs auch unsere Angst
vor Pferdefüssen und Steinen, Wänden, welche unsere Jugend zersplittern wird.
Wir werden alt.
Die Märchen begleiten uns
wie die Tierhorden hinter dem Feuer in der Ferne
und unsere Gedichte sind wie wir
schwer und traurig.
Liebe Julia,
Vesna Parun ist die kroatische Friederike Mayröcker, 1922 geboren auf der Insel Zlarin, die erste Dichterin in Kroatien, die von der Dichtung lebte (schlecht); und hier sende ich dir nur zwei, drei Strophen, mehr denke ich kann ich dir senden ohne Brief, oder bei den Lesungen aus den Briefen dazu kleben.
Die Stille zwischen den Briefen löst ein leises Vibrieren der Angst in mir aus, habe ich nicht allzu viel, allzu stark, allzu allgemein, allzu altklug mich eingemischt, gesagt, gesehen, gefragt. Und dann als dein Brief kam wie ein Festessen, eine Tafel wo ich mich hinsetzen kann, wie Muscheln essen und Sauce kosten. Ich lese und tu dort streicheln, dort staunen, dort pflücken, dort riechen, dort denken, nein, nein, nicht jetzt Julia verlieren. Habe dir von dieser Verlustpanik geschrieben, während wir uns gerade auf Distanz und doch in Gleichschrift zueinander bewegen. Dieses Schreiben fördert bei mir Spiegelungen, meine Seele braucht diesen Dialog um sich auf einer «Hajenka» auszuruhen. Hajenka hat mir einmal ein tschechischer Psychologe aus Zürich gesagt, heisst Innere Wieseauf Tschechisch. Ich sah das Foto von deinen Hautzeichnungen für mich wie zum Lüften gekennzeichnete Wiesen (Hajenkas) des inneren Erlebens. Ich erinnere mich an den Anfang von meinem Roman Liebe um Liebe, ich versuchte mir die Textabschnitte mit zwei Worten zu steuern. Atemlos das Glück, kein Atem das Unglück. Diese beiden Rhythmen sollten das Buch tragen. Sphärenklang nennt es Hermann Broch. Er hat doch Gedanken pro Minute berechnet, um den Vergil-Mythos zu schreiben, ein Poem des Übergangs zum Tode, über einen Dichter, der sein Werk vernichten will weil der Staat ihn missbraucht. Er merkt, dass die (heute würde man sagen) Rezeption seiner Worte überhaupt keine Veränderung der Handlungen der Bürger bewirkt. Ich erinnere mich jetzt an deinen Essay über Max Frisch, wo du genau dies sagst, bitte ehrt mich nicht, während die Welt untergeht.
Zurück zu deiner Suche für den Roman der Sprache der Liebe.
Du schreibst über die Unschuld der nichtbestimmbaren Körper in der Umarmung : Mir kommt Nietzsche in den Sinn, der Satz – glaube ich – dass Stil eine Frage der Moral ist.
Übrigens, warum ist Sexualität an diese Moral und Unmoral gebunden oder von ihnen entbunden? Liebe beginnt mit der geistigen Sexualität, aber sobald man Sex sagt, wird der Geist, die Seele wie stillgelegt (scheint es).
Die Frau über welche mein Roman erzählen wird, war Model, durch ihr Model-Sein hat sie die Liebe erworben, durch Sexualität ist Inspiration geworden oder umgekehrt. Ich vertage es noch immer, darüber tiefer nachzudenken, es ist ja Sommer, noch der Anfang des Schreibens.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dieses Hineinfallen in die Augen des Mannes umkehren zu wollen, er soll Modell stehen und sie ihm aus sich so malen, aber das Problem ist, dass es die Frau nicht gibt in dem Sinne, und sie, wenn es sie gibt, doch gewertet wird. Ich hörte deine Radiokolumne gestern, ja, ihr Köper ist schön in seiner Einzigartigkeit aber schön und hässlich sind historische Begriffe, und wenn wir den Körper schön nennen, sollte es liebenswert heissen, so so, und brauchen wir Schönheit wie Brot, welche und warum? Als sie sich trennen, malt er sich als Tod des Mädchens. Wieder ist er die bestimmende Figur des Todes der Liebe. Und sie hängt heute an den Wänden der Museen, was hängt an Wänden? Sein Blick auf sie? Ich weiss (noch) nicht, wie ich mich aus dem neuen und alten Blick der Erotisierung und Liebe hinaushinein schreiben werde, kennst du Paul Simon, das ist ein Maler welcher schreibend malt. Ich bin ihm verfallen, sagt man.
Jetzt ist ein anderer Morgen, ich schau durchs Fenster in Innsbruck, ich habe einen Preis bekommen vor einem Monat, aber der diesbezügliche Brief kam nicht an bis zu mir, also ist meine heutige Freude auch einen Monat zu spät. Wäre der Brief rechtzeitig gekommen, ich hätte an diesem Roman mit mehr Aufschwung gearbeitet, hätte ich doch gewusst, das Jemand an mich glaubt, während ich mir einrede, dass es mit diesem Roman noch nicht Zeit sei hineinzufallen ganz.
Ich habe gestern spät wieder deinen Brief gelesen, ich habe verstanden wie es anders gehen kann ohne meine ständige Bedrohung der Kunst, ich sah mich als Leserin, die, um auf der Welt sein zu können, sich aufseilen muss mit Worten, wenn es sein muss, aber mein Vertrauen in mein «Talent» musste von aussen kommen, es war ein Geheimnis, ist ein Geheimnis, dass ich dieses unbedingte Vertrauen innen und aussen(Grössenwahn) brauchte um am Leben zu bleiben –
Ich fragte in Biel deine Kollegen, was für ein Konzept für das Scheiben sie haben,
und einige schauten mich entgeistert an. Eine sagte, ich setze mich und schreibe wie du in diesem Dachboden, that’s it …
Du siehst, ich eile irgendwohin, statt mich am Boden der Tatsachen festzuhalten, an der sogenannten trockenen Realität. Unterlage meine Traurigkeit. Meine Eltern sind beide in einem Zustand der Fortlaufenden Veränderung, das ist ein schöneres Wort für Überfall der Blödsinnigkeit, sie werden böse, handgreiflich, ihre Worte sind kein Honig sondern Gift, sie tun sich selber, anderen weh, sie fahren auf einer Schiene, aus welcher auszusteigen unmöglich ist, aber ich möchte nicht sie behandeln wie Spielzeuge, ausgefallen aus sich. Ich habe so viel gelesen über Verlust, über Demenz, aber ich kann sagen, vergiss es, es ist eine schmerzende Realität, eine unaufhörliche Schaukel, es ist Selbstgeburt und Wutstation, es ist Unmut und Resignation, es ist ein Kampf mit den Worten und mit der Erinnerung, ein Abschied von Körperlicher Präsenz eines Menschen in Gestalt deiner Eltern, aber du kennst sie kaum mehr oder sie nehmen dich nicht mehr wahr.
Altenpflege – in Kroatien ist sie erst in den Anfängen, die Familien sind sich selber überlassen, immer sind es die Frauen, wie meine Schwägerinnen, welche die Eltern pflegen müssen.
Ich habe sie jetzt fast ein Jahr nicht gesehen, und die Veränderungen sind so massiv, dass ich es nicht so annehmen will oder kann. Wie nimmt man an, dass diese Person, diese Person, welche noch immer denselben Name trägt, Jemand anderer geworden ist, wie eine Geschlechtsumwandlung muss man sich das vorstellen, und du willst die vorherige Gestalt. Ich schaute heute wieder Fotos um mir in Erinnerung zu rufen wie gut es letztes Jahr war, aber ich empfand auch das letzte Jahr als Weltuntergang.
Wenn ich schon letztes Jahr schreibe, weiss ich, es war für mich das schwierigste meines Lebens bis jetzt. Dieses Jahr sieht schon sehr hell aus. Mein Bruder hatte einen Herzinfarkt und hat dadurch einen Krebs entdeckt welcher dann heraus operiert werden konnte – er lebt, hat überlebt als einer von einer Million sagt er, aber wissen wir, ob er nicht als einziger solchen Fall überlebt hat. Ich habe (auf Deutsch) versucht diese Zeit in Worte zu fassen, irgendetwas zu begreifen, greifen, mit ihm sein und bei mir um Kraft zu denken wenn es ihm hilft auf der Erde zu bleiben. Ich erinnere mich, ich war etwa vier, als Grossmutter uns gesagt hat, dass Menschen sterben, dass ich nicht mehr schlafen konnte, ich fiel aus der Erde hinaus, mein Bruder atmete im selben Bett neben mir und ich vergesse nie diese Angst dass er mir sterben würde, ich hatte schon damals seinen Verlust befürchtet und nicht meinen.
Er ist einundeinhalb Jahre jünger als ich, und wenn er nicht da wäre, dann wäre ich halbiert – nur dieses sagte ich zu mir, Augen zu und weiter. Ruth Schweikert lieferte mir den Titel.
Wie helfen, wie beten, es kam immer dieser Drang, mich zur einer Macht zu bekennen welche etwas kann, welche etwas weiss, welche schützt, welche nicht zulässt Unzulässiges, den Skandal des Nicht-auf-der-Erde-Seins aber nicht abstrakt sondern handgreiflich nah. Ich muss was anderes schreiben weil mich diese Zeit gerade wieder dann überfährt wenn ich darüber dir schreibe.
Wie gut du geschrieben hast, welche Ebenen des Schreiben wie die Kletterstangen dir zur Verfügung stehen … darüber habe ich nachgedacht. Warum meine Angst welche ich wahrscheinlich auf dich projiziert habe, das kostbarste was man hat in sich nicht zu «missbrauchen». Ich hätte dir vielleicht das Mädchen mit den roten Schuhen erwähnen können. Ein Märchen welches mahnt, dass man nur in selbstgemachten Schuhen gut tanzen kann. Du unterscheidest die Funktionen des Schreibens, und das finde ich höchst interessant, ich habe ja gedacht, dass es ungefähr jeder so handhabe wie ich. Aber eben nein, ich fange an zu verstehen dass du zwei Arten des Gebrauchs des Talents unterscheiden kannst, ihre Wirkung, ihre Notwendigkeit, und deine Quelle aus welcher sich beide speisen. Viellicht ist das mein Problem wenn ich über das Literaturmachen diskutiere. Es braucht den Dialog, zuhören, stehen lassen, für welchen man heute kaum mehr Zeit aufbringt, annehmen dass es Zugänge und Zugänge gibt zur Kunst und zum Leben. Man kann sie zwar nicht für sich selber «abschreiben», aber verstehen und sich wundern. In meinem Traumtagebuch habe ich einmal das Folgende abgeschrieben von Clarissa Pinkola Estés,
Der Seelenhunger treibt viele Frauen an, nach allem zu greifen, was dem verlorenen Schatz ähnelt. Sie möchten das Versäumte nachholen. Dabei ist die Gefahr groß, sich solche Ersatzbefriedigungen zu suchen, die nur ein schnelles Glück verschaffen kann. Häufig beginnt damit ein Doppelleben. Die eigentlichen Bedürfnisse können jedoch nicht gestillt werden. Eine instinktverletzte oder überdomestizierte Frau hat große Schwierigkeiten damit, diese wahrzunehmen. Sie merkt nicht, wann es Zeit ist zu fliehen, wann Vorsicht und Misstrauen geboten sind, kann nicht um Hilfe bitten usw.
Schatten.
Hat meine Generation der Frauen vielleicht doch ein wenig Verrückung geschafft, dass ihre Töchter und ihre Söhne sich nicht so leicht aus den Augen verlieren? Deine Antwort hat mir das bestätigt, und ich freute mich darüber, die Brille einstellen auf Zeitdenkveränderungen bringt Freude mit sich, wenn man (schwer) aber immerhin lernt zuzuhören. Ich habe ein paar Taschen voll mit Pflanzen mitgenommen, Rosmarin, Lorbeer, Meeresfenchel, Basilikum, selbstgepflanzte Wiesenblumen vom dalmatinischen Balkon, so fühle ich mich in dieser Übergangzeit an die Natur dort gebunden. Nebst diesem Trost haben ich und H. gespielt, wir seien Influencer, wir haben sogar ein satirisches Kurzvideo gemacht. Unsere Firma sollte Beratung in allen Lebenslagen verkaufen. Unsere Qualifikationen sind doch so zahlreich,
es gibt ja tatsächlich kaum etwas, was wir noch nicht verpfutscht haben.
Wir lachten so viel, dass unser Influencer-Dasein schlussendlich stark gefährdet wurde – durch Lachanfälle.
Ich fand in Innsbruck kleine Winterkappen, welche ich in der Corona-Zeit gestrickt habe, sie waren gedacht für unsere drei Enkelinnen, aber ihre Köpfe sind schon herausgewachsen, ich habe mir in den Kopf gesetzt, dieses Grossmutter-Sein mit Stricken und Kuchen-Backen wäre schon voll erledigt, aber die Mädchen wachsen zu schnell und ich bin zu mobil um ständig zu backen und zu stricken. Übrigens, aus bösen Müttern und Vätern können wunderbare Grossmütter und Grossväter werden, nur Schwiegermütter werden keine Stiefschwiegermütter, und gut.
Das Zitat aus dem Mann ohne Eigenschaften habe ich auf dem Tisch, und versprochen, ich sende es dir in unserem letzten Brief. Noch eine Frage hast du mir gestellt, ob man die Tiefe dem Reifer-Werden verdankt … oder habe ich es nur so in Erinnerung, ich kann dir überhaupt nicht darauf antworten weil ich habe das Gefühl dass man nicht hinein wächst wieder zur Kindheit, zur seelischen Reife, welche man «dank» Umständen verleugnet hat, also die Hektik der falschen roten Schuhe, welche unbedingt sein mussten, ist nicht mehr da, so prekär leben zu müssen …
Meine Kinder sind ja gross, du trauerst, lügst dass ihr Abgang supergut ist. Verfolgst aus der Ferne jeden ihrer Schritte und schweigst um die Sorgen, so wie du gelernt hast, dass Sich-Sorgen-Machen Liebe sei, aber vielleicht Vertrauen-Haben ist es auch.
Ganz liebe Grüsse aus Innsbruck, wir gehen bald nach Buch am Irchel und schwimmen im Max-Frisch-Bad und und
werden uns wie die Schwimmer im gleichen Becken immer wieder zurufen, hallo, schwimm gut.
Deine Dragica
P.S. Für Mädchen bringe – nehme ich grad was mit (nicht Foto).
Auf dem Foto mit sechzehn hatte ich alles Bücher der Welt auslesen wollen … und heute trage ich Lorbeer und Rosmarin über die Grenzen.


Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 6: Dein Brief ist mit mir mitgekommen …
weiter ...Liebe Dragica
Dein Brief ist mit mir mitgekommen, in meinem Kopf, meinen Fingern, den Augen durch die Tage und immer auch als ein Schein von Wichtigkeit und auch eine Schwere, auch ein Geräusch von Kieselsteine-werfen-auf-Blech. Wie Worte finden an dich nach diesen, die von dir zu mir gekommen sind? Und so nahe und so tief und so traurig und so grünlich und so ein Gehen in schweren, festen Schuhen über den Boden, so viel Leben und nicht mehr Leben und Flammen der Kerzen, danach, die Geschichten, die dir gehören, ein Land an Erinnerung auch. So dass in mir ein Gefühl mitgetragen wurde, durch die Tage, dir mit meinem kurzen, kleinen Leben nicht recht begegnen zu können. Das stimmt nicht, ich weiss, ich kann dir begegnen und die Briefe sind mir wertvoll. Diese Zeit unseres Austausches. Ich danke dir sehr.
Ich habe den Schmetterling Nelly gezeigt und sie meinte, es könnte ein Schwalbenschwanz sein, aber sie sei sich nicht sicher und auch habe sie wenig Zeit, sie müsse Marienkäfer-Larven finden und die sieben Hunde füttern, es seien schöne Hunde und junge und Handaufzucht und ihr Fell glänze von der Milch, dann rannte sie in den Garten als Forscherin, sang dabei ein Lied, ihr Haar ist fast weiss und eine Weisheit, die gehört ihr auch. Romy hat auch etwas gemacht, als ich ihr das Bild zeigte, aber es ist nicht leicht die Geräusche des Kindes in Worte zu tun. Sie klang wie etwas, das aus tiefem Wasser aufsteigt und aufsteigt und aufsteigt und endlich an die Luft kommt. Sie meinte aber wohl das Leben an sich mit ihrem Geräusch und nicht nur den Schmetterling.
Ich habe heute etwas über das Schreiben geschrieben, vielleicht anstatt zu schreiben. Deine Worte, dass du dich sorgst, weil ich die Aufträge erledige, und der Ort, der das Schreiben sein kann, „lebendiger Ort“ es stimmt, mein Schreiben als Ort des Schutzes und der Lebendigkeit habe ich fast aufgegeben für den Moment. Auch ich sorge mich.
Mein Schreiben, um irgendwie dem Leben begegnen zu können, der Welt, ein Schutz kann das Schreiben sein, weil mein Netz, das mich vor dem Eindringen der Dinge und Nachrichten und Traurigkeiten und Stimmungen und all den Existenzen schützt, hat grosse Maschen. Manchmal sitze ich in der Strassenbahn und versuche die Menschen, die einsteigen, nicht anzusehen, weil alle die Existenzen und Leben mich so sehr angehen, dass ich das Gefühl habe, sie ansprechen und verstehen zu müssen, obschon ich sie nicht kenne. Dann bin ich am Abend ganz aufgeweicht und wie ein Salat zu lange auf der Ablage gelegen. Die Kunst, das Schreiben schützt mich davor, vor dem Eindringen von Welt in mich nicht, eher gibt sie mir eine Möglichkeit, mit all dem Eindringenden umzugehen. Und dieser Ort der Kunst und des Schreibens ist klein geworden, ich aber gleichzeitig auch stumpfer. Ich habe ihn aufgegeben und dafür eine Stimme erhalten, die Tatsache, etwas beitragen zu können, etwas rufen zu können, halt, macht das nicht ihr Menschen, oder nein, es gibt die tausend Farben, die ihr nicht sehen könnt, doch. Erstaunt mich immer noch sehr, aber oft denke ich, was soll ich denn sagen, ich möchte viel lieber graben in mir und in den Dingen, die sich in mir ablagern, weil sie hineinkommen können, weil meine Türen weit offen stehen. Ich möchte mich gerne ein bisschen aus der Welt nehmen, aber die Fenster und Türen sollen offen bleiben. Wind und Welt und Menschen und am Abend einen Heinz, der mit mir auf dem kleinen, nun weissen Balkon sitzt und wir löffeln die Worte aus uns heraus.
Wie machst du das?
Mein Leben ist genau Randvoll. Noch etwas, nur ein Kieselstein, bis das Leben überläuft.
Ich habe heute versucht über Körper zu schreiben, die sich berühren. Ich versuche in meinem Roman eine Körperlichkeit so zu beschreiben, wie ich sie nicht kenne. Sexualität jenseits von Frauen und Männerbildern und jenseits von Pornografie und weg von der Aufklärung und Sozialisierung wie ich sie erlebt habe. Ich habe, weil ich keine Worte fand, angefangen zu zeichnen und plötzlich habe ich gemerkt, dass es mit der Haut zu tun hat. So viel Haut wie möglich aufeinanderlegen, habe ich gedacht und sich ausbreiten wie ein Fell, auf dass jemand sich dann legen kann und sich als Fell um jemanden legen.
Auch ein Selbstportrait habe ich gemacht. Ich schicke die Bilder mit.
Die Lichter und Toten in deinem Leben und auf dem Friedhof und die Toten in deinem Buch. Wie du sie mitnimmst von hier zu da und vom damals ins Heute, hinüberrettest, und wieder musst du dich verabschieden. Wie du schreibst von der inneren Hand, die verformt bis es erträglich wird, wie intensiv dein Schreiben über dein Schreiben ist. Wie es leuchtet, die Flammen von Erinnerung und das Loslassen weh tun kann. Das hat mich tief beeindruckt. Da bin ich noch nicht. Kommt das mit der Zeit? Diese Stärke? Ist es das persönliche, die Geschichten, Menschen, die waren, die nicht nur eine Mischung aus jetzt, früher, ich, Familie, Orte, Sehnsüchte und Ängste sind? Oder, habe ich mich gefragt, als ich das las in deinem Brief, und das ist gefährlich, gehören die Sätze meines Romanes, der entsteht, gar nicht dahin, wo sie sind, gehören sie vielleicht nicht mir? Gerade frage ich mich, bin ich einen falschen Weg gefolgt, zu schnell, weil keine Zeit und irgendwo hinmüssen, so schnell wie möglich von A nach B, und jetzt irgendwo in einer Picknicklandschaft gelandet und weil ich nicht genau schaue, mich nicht genug lange darin aufhalte, die Mülleimer mit lachendem Gesicht und die Plastik-Eiskarte im Wind nicht sehe, merke ich nicht, dass ich in dieser Picknicklandschaft nichts verloren habe.
Die Intensität, die auch mit der Ausdehnung des Raumes zu tun hat.
Die Wirklichkeit, in der man sich aufhalten muss. Einrichten.
Du hast auch von den hängenden Augenblicken geschrieben. Und ich bemerkte, als ich darüber nachdachte, was diese für mich sein könnten, dass es, wie stumpf auch immer ich bin, wie tief der Brunnen und gehetzt meine Bewegungen in einem Tag, immer diesen einen Gedanken an das Schreiben für mich gibt, den ich irgendwann in Biel, auf der Dachterrasse des Hauses, dessen Zimmer im Dachboden ich bewohnte, hatte, ein Gedanke, an meine Fähigkeit und Lust die Gedankenwege so zu gehen, dass sie nicht direkt von A nach B kommen, dass sie Umwege machen und auf diesen Umwegen noch weitere, scheinbar nicht dazugehörige Bilder mitnehmen, die dann eine Wirklichkeit für den Augenblick ergeben. Das tröstet mich. Das macht mein Kopf, weil er nicht anders kann. Und gäbe es die Kunst nicht, ich wäre mit diesen verschwenderischen Wegen meiner Gedanken nicht gut aufgehoben in der Welt.
Über diesem, meinem Kopf spielt ein kleiner Junge in seinem Zimmer. Es ist sein Zimmer, das über unserem kleinen Büro liegt, das wir haben in der Wohnung, um zu arbeiten, wenn die Zeit für den Weg ins Atelier nicht reicht. Heinz und ich teilen uns die Tage auf. Zwei Schichten. Einmal von 9-14 Uhr und einmal von 14-19 Uhr. Es reicht leider nicht ganz, darum kämpfen wir manchmal um halbe Stunden. Das kann humorvoll sein, aber auch nicht. Es kann vorkommen, dass ein Ich noch tief in Gedankenwegen, im Versuch, Körperlichkeit neu zu beschreiben und dann liegt da plötzlich ein Kind in den Armen des Ichs und Heinz verschwindet aus dem Raum. Ich bin dran, ruft er dann. Und weil der Wickeltisch auch im Büro untergebracht ist, steht das Ich dann auf und wickelt das Kind, das sich eine Faust in den Mund stecken kann.
Liebe Dragica, nun habe ich das Gefühl des unorganischen Schreibens in mir. Viel zu viel ich. Und doch keine andere Möglichkeit, als das Material. Vielleicht besuchen wir die Blutbuche gemeinsam. Es wäre mir eine Freude und ich freue mich auf deine nächsten Worte,
Deine Julia


Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten: Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 10: Es ist der letzte, der 10. Brief …
weiter ...Weiler im Allgäu, Dienstag, den 30.6.–1.7.2020
Lieber Hansjörg,
es ist der letzte, der 10. Brief, den wir uns schreiben.
Ich sage ganz einfach nun, den wir uns schreiben.
Aus dem behutsamen Herantasten, Entschlüsseln der Zeichen, den kleinen Wegmarken, …die Spuren zu lesen, wo einer gegangen, ist ein Gehen geworden, ein Gespräch zwischen Ich und Du, dass ein Gespräch wir sind, schrieben Sie einmal.
Ich glaube, wir sind es geworden, ein Gespräch.
Wenn es nur überall so sein könnte, dass wir die gereichten Fäden aufnehmen, ganz gleich, ob sie bruchstückhaft, fadenscheinig, dünn, abgerissen oder farbig sind. Dass so etwas entsteht, wie es gekommen ist! Ich nehme es als Geschenk, als etwas Unerwartetes, aus einem Wagnis heraus, auf das wir uns eingelassen haben.
Es erscheint mir, dass sich etwas Buntes, Fremdes, Vertrautes und Durchlässiges, in der uns gemeinsam anvertrauten Landschaft entwickelt hat,
wie durch Kunst unser Leben zu lesen. Sie nannten u.a. Morandi in seiner Abgeschiedenheit und Stille. Ja, Bologna taucht da plötzlich in meiner Erinnerung auf. Dieses ferne, nahe Licht, dieses nahe, ferne Licht.
Als ich am Morgen erwachte, legte sich das Licht so weich im Gesang der Vögel in die Zweige der Birke und auf die roten Ziegeldächer der Gehöfte. Italien, dachte ich. Der Ruf der Turteltaube ist nicht fern und die Geschäftigkeit des Bauens, das Palaver, das blecherne Geräusch der Stahlgerüste …
Mein Blick geht zum Bücherregal. Ein blauer mit Teeflecken versehener Umschlag eines Gedichtbandes aus dem Lyrikkabinett mit dem Titel: Nimm mein Wort in die Hand, springt mir ins Auge, D.H. Lawrence von Werner Koppenfels ausgewählt und übertragen.
Ich lese erstaunt:
Nicht ich, nur der Wind, der durch mich hindurch weht!
Ein feiner Wind zeigt im Wehen die neue Richtung der Zeit.
Wenn ich mich nur von ihm nehmen lasse, tragen lasse, wenn er mich nur tragen will! …
Die Glocken der Kapellen läuten heute früh ganz anders als sonst, einsilbig, ja, eintönig, als ob sie Trauer tragen um diese ungewöhnliche Zeit.
Halblaut lese ich
O, dem Wunder, das in meine Seele sprudelt,
wär ich ein guter Brunnen, ein guter Quell,
würde kein Wispern verwischen keinen Ausdruck verpfuschen.
Was soll dieses Klopfen?
Was soll dieses Klopfen, des Nachts an der Tür?
Da ist jemand, der will uns schaden.
Nein, nein, es sind die drei fremden Engel.
Lass sie ein, lass sie ein.
Und ich halte Ausschau, wie von einem Leuchtturm aus, staunend auf all die Landschaften der Sprache, die sie mir aufzeigt und Sie mir aufzeigten.
Ihrem Freund möchte ich tröstlich antworten, es kann wieder gut werden, auch mit einem Lungenflügel, in einer achtsamen Verlangsamung, weil ich dies selbst bei einer Freundin erlebt habe.
Meine Seele hört im Sehen –
heisst eine der neun deutschen Arien von Georg Friedrich Händel, gedichtet von dem Barockdichter Barthold Heinrich Brockes.
Was aber bleibet, stiften die Dichter, sagt Hölderlin und spricht uns dies nicht auch der junge Dichter Raoul Eisele ebenso zu. Und das Leben, das plusterndemit dem Duft des Brotes, mit Linas Garten und all den alltäglichen Wunder. Wenn uns die Sprache zum Instrument wird, zur verwandelnden Kraft, den Ton zum Singen bringt vom Sommer, dem alterslos Schönen, auch in diesem Jahr.
Gestern sah ich den Dokumentarfilm über Itzhak Perlman: „Ein Leben für die Musik“. Mir blieben nur die Worte Seele und Schönheit haften. So kann nur einer spielen, der hindurch tönt und eins ist mit seinem Instrument. Da ist auch Itzhak Perlmans entwaffnende Menschlichkeit, seine Leidenschaft zum Kochen, jenes geheimnisvolle Bereiten der Mahlzeit. Ob es mit Worten, Tönen, gutem Essen, gutem Wein und Gesprächen geschieht, mit aller Süssigkeit und Bitterkeit der Kräuter und Gewürze. Dieses sich versammeln um den gedeckten Tisch des gemeinsamen Schicksals. Wir mit unseren Geschichten und unserer Geschichte, wir sind alle mit dabei.
Miriam Pressler schrieb einmal in einem Nachwort einer Sammlung von Gute-Nacht Geschichten, dass Geschichten Mahlzeiten für die Seele sind.
Wir tragen sie in uns, entdecken sie, tragen Schichten ab, fügen neue hinzu, wir rasten, halten Ausschau, verändern den Blick, finden Gefährtinnen und Gefährten.
Es ist früher Morgen. Die Vögel singen um die Wette oder einfach nur so, weil sie da sind?
Ich denke an Beethovens Streichquartett Nr.14 cis-Moll op.131, ein spätes Werk, denke an seine Taubheit an seine drei innigen Briefe für Bettine.
Das Belcea Quartet vor zwei Tagen hörte ich mit der rumänischen Violinistin im Garten mit Kopfhörern, es hat mich zutiefst ergriffen, als Atem, als Sauerstoff, der verwandelt.
Immer sind es doch die Geschichten, die wir miteinander teilen. Es sind nicht die grossen Bauwerke, sie vergehen, sagt ein altes afrikanisches Sprichwort. Die Zunge bleibt in den Märchen und Liedern.
Sie schrieben, dass ein Zwischenboden in Ihrem Atelier eingezogen wird, eine Art Empore, die Veränderung ermöglicht.
Alles Gute für das Atelier, eine Empore ist etwas, was den Blick verändert.
Ich bin dabei meine Korrespondenzen zu ordnen, zu sortieren, zu vernichten, zu behalten, im Gedächtnis zu behalten, was das Herz bewegt.
Eine Schweizer Freundin sagte mir einmal, wir feiern „Gedächtnis“.
Ich kannte diesen Ausdruck und den dazugehörigen Brauch nicht. Jene im Gedächtnis zu behalten, die nicht mehr sind und ich füge hinzu, und jene die sind.
Ich freue mich, Ihnen begegnet zu sein und Ihnen auch bald leibhaftig im Literaturhaus in Liechtenstein zu begegnen.
Danke für Ihre guten Wünsche zum Buchstabieren meiner Stadt, vielleicht wird dieses Buchstabieren nur für mich sein.
Ich schaue aus dem Fenster, verwundert, der Himmel blau mit zarten, weissen, spielerischen Wolken. Das Sfumato ist verschwunden, klar sind die Konturen der Hügel und Häuser.
Alles Wirkliche ist Begegnung, schreibt Martin Buber, es stimmt, füge ich hinzu,
Ihre Antonie
Die Türen des Jahres öffnen sich,
wie die der Sprache,
dem Unbekannten entgegen.
Gestern Abend sagtest du mir:
Morgen
gilt es ein paar Zeichen zu setzen,
eine Landschaft zu skizzieren, einen Plan zu entwerfen
auf der Doppelseite
des Papiers und des Tages.
Morgen gilt es,
aufs Neue,
die Wirklichkeit dieser Welt zu erfinden…
Oktavio Paz
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 10: Heute Morgen, während ich mich bequem im Zahnarztstuhl zurücklehnte …
weiter ...Liebe Barbara!
Heute Morgen, während ich mich bequem im Zahnarztstuhl zurücklehnte, habe ich überlegt, was ich dir auf deinen letzten Brief antworten könnte. Mein Geist ging auf die Reise, zum einen, um sich in das hineinzuversetzen, was du mir geschrieben hast und was ich noch einmal durchgelesen hatte, bevor ich aus dem Haus ging, zum anderen auf der Suche nach einer Geschichte zur Besiegelung dieses unseres Briefwechsels zwischen Unbekannten, der aber vielleicht dazu geführt hat, dass wir einander nicht mehr ganz so unbekannt sind.
Du hast recht, wenn du sagst, dass wir Menschen so beschaffen sind, dass wir uns zwischen Gut und Böse entscheiden können, manchmal wählen wir auch den Mittelweg, oder einfach den bequemsten Weg, der nicht zwangsläufig das Böse sein muss.
Menschen, also unvollkommen, andererseits, wenn wir nicht unvollkommen wären, würden wir letztendlich Götter sein, die famosen Götter, mit denen wir uns mehrmals in unserem Briefaustausch befasst haben. Möchtest du, Barbara, gern perfekt sein? Ich, ehrlich gesagt, nicht, weißt du, wie langweilig das Leben wäre … ich kenne Leute, die überzeugt sind, es zu sein, und du glaubst nicht, wie belanglos und langweilig diese Personen sind! Wenn man Fehler macht, kann man sich wenigsten eines Besseren besinnen, den Fehler zugeben, auch sich entschuldigen… Doch diejenigen, die immer und überall perfekt sind, die werden nie das Vergnügen haben, einen eigenen Fehler eingestehen zu können. Und dann ist nicht zwangsläufig gesagt, dass Fehler immer etwas Negatives sein müssen.
Ich weiß nicht, ob du schon einmal daran gedacht hast, aber das Leben gleicht oft einer Fahrt im Überlandbus, einer dieser langen, nicht enden wollenden Fahrten. Ich meine nicht jene großen Reisebusse, die man ab und zu auf der Autobahn oder vor den Hotels der Ferienorte hier bei uns stehen sieht. Ich meine die Busse, die zwischen Ortschaften verkehren, jene Busse, mit denen nicht nur der Körper auf Reisen geht, sondern auch der Geist. Ich finde, das ist ein besonderer Vorzug der Busse, mit den Zügen zum Beispiel ist es schon etwas anderes.
Die Linienbusse aber sind perfekt, um die Fantasie auf Trab zu bringen. Es mag mit meinem Hang zum Schreiben und zum Geschichtenerfinden zu tun haben, doch Busreisen sind für mich stets eine große Inspiration, zum einen, wenn ich die Landschaften betrachte, durch die die Busse fahren, zum anderen, indem ich mir im Geist, aber auch mit Hilfe von Papier und Bleistift, Notizen mache, und auch indem ich mir Geschichten über die unbekannten Mitreisenden ausdenke, die neben, vor, hinter uns oder auf der anderen Seite des Ganges sitzen, und natürlich auch über den Fahrer.
Wie im Leben, begegnen wir auch im Bus anderen Menschen, Menschen, die das Leben unseren Weg kreuzen lässt, Menschen, mit denen wir uns gut verstehen können, aber auch Menschen, an denen wir keinen Gefallen finden.
Um diese meine Theorie von der Busreise als Paraphrase und Metapher des Lebens zu bekräftigen, möchte ich dir von einer langen Fahrt erzählen, die ich vor Jahren in einem besonders heißen Sommer durch Niederkalifornien unternommen habe. Wir reisten an Bord eines Busses des Unternehmens Tres Estrellas de Oro (die drei Sterne standen für Sicherheit, Komfort und Freundlichkeit), mit Start in Tijuana und Ziel in Mulegé, etwa in der Mitte jener schmalen Halbinsel, die sich über die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko hinweg erstreckt und im Westen vom Pazifischen Ozean, auf der anderen Seite vom Meer von Cortez umspült wird. Das Großartige, Unvorhersehbare, Unerwartete jener Reise zeigte sich ziemlich bald, als uns an der Station Ensenada einer der beiden Fahrer mitteilte, dass gerade ein Wirbelsturm über die Halbinsel hinwegzog, man wusste aber nicht genau, wo, und deshalb würden wir früher oder später anhalten müssen, um auf eine für uns günstige Entwicklung der Ereignisse zu warten. Das bedeutete eine fast zehnstündige Pause im Busbahnhof von Guerrero Negro (wo wir im Schlaf vor Morgengrauen angekommen waren), vor dessen Küsten in den Wintermonaten die Wale ihre Jungen zur Welt bringen. Zu jener Zeit interessierte ich mich aber noch nicht so für Walfische, und da es Sommer war, war ich ohnehin zur falschen Jahreszeit dort, ich glaube aber, dass die Sache trotzdem eine Bedeutung hat.
Für einen einfachen Bus, der den nördlichsten Teil der Halbinsel mit dem südlichsten verband, wartete er mit einer breiten und bunten Vielfalt von Menschentypen auf. Im Besonderen schlossen wir Freundschaft mit zwei typischen Mexikanern, die in die Gegend von Los Angeles ausgewandert waren und die so typisch waren, dass du sie dir nicht anders vorstellen könntest als so, wie sie waren, mit bronzenem Teint und Schnurrbärtchen. Melchiòr und Tio Felipe (er reiste mit seinem Söhnchen und einem kleinen Neffen, der ihn jedes Mal, wenn er sich ihm zuwandte, so nannte). Im Bus waren auch noch sechs Deutsche, drei aus Köln und drei aus Leipzig, die sich grimmig ansahen.
Jedes Mal, wenn sie jemand fragte, woher sie kämen, antworteten die drei aus Leipzig unbeirrt, und zwar in einem noch kläglicheren Englisch als meinem, dass sie aus East Germany stammten, bis schließlich Tio Felipe irgendwann dem Theater ein Ende setzte und sagte, dass es seines Wissens seit einigen Jahren nur mehr ein einziges Deutschland gäbe.
Der Bus fuhr am frühen Nachmittag weiter und nach der Siesta der Fahrer hatte uns ein aus der Gegenrichtung kommender Bus unterrichtet, dass die Straße nun wieder offen wäre: na ja… sie hießen uns alle Sachen aus dem Kofferraum holen, denn entlang des Weges mussten wir ziemlich viele Furten durchqueren und es bestand die Gefahr, dass die Rucksäcke, Taschen und Koffer nass würden. Bei jedem Halt stiegen die Mexikaner und die Deutschen aus, um Bier und Tequila zu kaufen. Melchiòr erzählte Geschichten: er sagte uns, dass er wie einer der Heiligen Drei Könige hieße, dass er zwei Brüder hätte, Balthasàr und Caspàr, und dass – als Krönung des Ganzen – seine Frau Reina hieße, was auf Spanisch Königin bedeutet. Etwas weiter vorn war ein Paar am Schmusen, in der ersten Reihe schwitzte ein Herr mit pomadigem Haar und unvermeidlichem Schnurrbärtchen gleichmütig vor sich hin, ohne eine Miene zu verziehen. Zwei der Jungs aus Leipzig und Tio Felipe waren schließlich ganz schön benebelt, zur Freude der beiden Kinder, die dem schnauzbärtigen Angehörigen zusahen, wie er, über den Sitz gebeugt, sich dem Schlaf hingab und dabei laut schnarchte.
Als wir unser Ziel erreichten, das auch jenes der drei Kölner war, war es erneut fast Nacht geworden und wir mussten noch einen Platz zum Schlafen finden, doch bevor der Bus wieder weiterfuhr, blieb noch Zeit für ein Bier an Bord und dann Umarmungen und Schulterklopfen mit Melchiòr, den drei Leipzigern und Tio Felipe.
Während in der Zahnarztpraxis die Zahnpflegerin meine Zahnreinigung beendete, versuchte ich jene Reise in die heutige Realität zu übertragen. Heute wäre es eine höchst unerfreuliche Reise geworden: ein halbleerer Bus, die Fahrgäste mit Gesichtsmaske und Abstand, keine Umarmungen bei der Ankunft am Ziel. Und darum freue ich mich so sehr über jene Reise, und da die Reise das Leben ist, freue ich mich so sehr über mein Leben, das nicht immer eitel Sonnenschein ist, das, wie alle Leben, auch aus Licht und Schatten besteht. Doch es ist mein Leben und das reicht.
Ich hoffe, ich bin nicht zu weitschweifig geworden, Barbara. Manchmal verliere ich den Faden, das habe ich dir bereits geschrieben, vor allem dann, wenn es ums Geschichtenerzählen geht. Ich möchte noch etwas zu unserer Reise sagen. Denn in der Tat war auch dieser Austausch von Briefen so etwas wie eine Reise, manchmal innerlich, manchmal nicht, eine Reise auf der Grundlage eines Briefwechsels zwischen Unbekannten. Alles in allem würde ich auch sagen, eine schöne Reise. Abschließen möchte ich wieder mit einem Zitat aus der Rockmusik, die ich gern höre, und zwar mit einem Song der Kinks mit dem Titel Strangers, wo es im Refrain heißt: Fremde sind wir unterwegs auf dieser Straße, doch wir sind nicht zwei, wir sind einer… und so ist es im Leben, im Bus, in den Briefwechseln.
Gute Weiterreise, aloha!
Paolo
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten: Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 9: sie beobachten die neugierde des kernbeissers, das aufgeschlagene märchenbuch …
weiter ...24.-29. juni 2020
liebe antonie,
sie beobachten die neugierde des kernbeissers, das aufgeschlagene märchenbuch, fragen, ob man dem sommer trauen kann? die wucht des grüns lindert. schafft ein auf- und durchatmen. sie nehmen mich mit auf einen weg, dem ich gerne folge. inspirierend, wie sie an (der) hand von gedichten gehen, sie erzeugen ein munteres intérieur. ein gehen und aufeinander eingehen, fernmündlich, quellschriftlich. ein binnenweg tut sich auf, begleitet von achtsamkeit in der sprache. ein austausch, den ich schon nicht mehr missen möchte. er geht weit über das «cara roberta…» – briefkontingent hinaus: briefe «in der muttersprache von poesie».
ich komme ins epistolare sinnieren. das „hochzusammengesetzte“, was man von zahlen behaupten kann, zeichnet briefe aus, der wechsel, das momentum, die taktung. sich treiben lassen. gedankensprünge zulassen. – wie sie, habe ich mich sehr über die unverhoffte zuschrift von raoul eisele gefreut, der unserem briefwechsel gefolgt ist, was konturen eines weiteren gesprächs angenommen hat, das unabsehbare kreise zieht. – briefe sind eigentliche sprechversuche. allererste sprechversuche von einer primordialen verfasstheit. die sprachfindung ausgesprochen im begriff «sprechversuch» klingt «sprechen» & «vers» & «suche» an. das briefeschreiben mit der öffentlichkeit im seitenwagen ist vielleicht nichts anderes als das metier des literaten.
das memento mori, die todesfälle von christo und alfred kolleritsch. beides verwandlungs-künstler: christo, der das verhüllen als enthüllen praktizierte. der dichter ganz anders, z.b. durch «die einübung in das vermeidbare».
das leben treibt ein kurioses billardspiel. die kugeln klicken, die impulse sprühen, die winkel treiben ein symmetrisch-assymetrisches spiel. kein wort, keines ist gering genug. man beginnt zu oszillieren, zu pulsieren, möchte auf wege warten, bildhaftiges wieder gewinnnen, empfänglichkeiten und hellhörigkeiten auskosten, warten, bis sich ein oberton einstellt.
ich liebe das poröse in der malerei, das durchlässige bei cézanne, morandi, die chromatische dichte bei vermeer, giorgione, velazquez, sodass einem augen aufgehen für ein schauendes continuum, einer endlosschlaufe gleich.
ihre erwähnung von kirchenfenstern, die aus 1000 lungenflügel-röntgenaufnahmen zusammengesetzt sind, erinnert mich schmerzhaft daran, dass heute einem freund ein lungenflügel entfernt werden muss, mit langzeitfolgen, (wenn er es, so hoffe und wünsche ich es innigst, überlebt). das durchleuchten der lungenkavernen, das durchleuchten generell kann ich darum nicht bloss als gestalterisches prinzip sehen. es bleibt für mich ein persönlicher schatten hängen. so oder so: ohne flügel ist man arm dran. die flügel-obsession, den flügelschlag der erica pedretti kann ich immer besser verstehen.
die erinnerung an die davoser schatzalp mit den bedrängenden räumlichkeiten des lungensanatoriums, öffnet wiederum eine andere assotiationsreihe. das ringen um elementaren atem ist in gewissem sinn ein leitmotiv der epoche. mir kommt jean-henri fabre in den sinn, der formidable insektenkundler und eminente schriftsteller, es gibt einen kleinen essay von ihm zur luft, «die luft.l’air- necessaire a la vie», ein heft, das 2013 in der friedenauer presse erschienen ist. in der ihm eigenen anschaulichkeit schreibt j.-h. fabre: «atmen bedeutet verbrennen. von zeit zu zeit hat man bildlich von der flamme des lebens gesprochen, und es trifft sich nun, daß dieser ausdruck ein genauer ausdruck der wirklichkeit ist. – … das essbare ist das brennbare – le comestible est le combustible. die luft gelangt ihm durch die atmung in die lunge. dort löst sie ihren sauerstoff im blut auf, das plötzlich statt der schwärzlichen farbe, die es zunächst hatte, von einem schönen rot ist. mit sauerstoff angereichert, breitet sich das blut dann mittels der kanäle, die man arterien nennt, durch den ganzen körper aus». (j.-h. fabre, die luft)
es geht in unserem tun eigentlich permanent um sauerstoffanreicherung.
in diesen tagen wurde ich zeuge einer hausräumung eines ca. hundertjährigen stattlichen arzthauses. ich wurde gebeten, die sporadisch-vorhandene bibliothek durchzusehen und das brauchbare bitte mitzunehmen. der unverhoffte fund von 7 kinderbuchklassikern in exzellentem zustand und erstauflagen hat mich besonders gefreut. bücher, die sich so unscheinbar als mit schutzpapier eingeschlagene hefte präsentierten, was den tadellosen zustand erklärt: darunter «blondchen in blüten». bilder von elsa beskow. reime von georg lang», oder «weißt du wieviel sternlein stehen?» nach einem entwurf von anneliese von lewinski und versen von gertrud j. klett, und noch ein anderes hatte es mir besonders angetan: «prinzesschen im walde» von sibylle v. olfers mit dem herrlichen blatt des raben als lehrer:
«auf schwarzer tafel mit goldenem rand
schreibt das prinzeßchen mit emsiger hand.
herr lehrer rabe mit seinem buch,
der macht das prinzeßchen sehr weise und klug.»
die erfahrung, etwas zu finden, das man gar nicht gesucht hat, ist allemal beglückend.
der alltag plustert sich mit einer gewissen erleichterung auf. noch wird man z.b. gebeten „beim marile“, dem winzigen ladenlokal der bäckerei in meiner strasse, einzeln einzutreten. eine fast unsichtbare plexiglaswand wurde über dem ladentisch installiert, schiebt sich vor den duft des brots. der alltag hat leicht klinische attitüden bekommen. man „operiert“ im gewöhnlichen. nur eben: dienst und leben nach vorschrift, behagt keinem, auch wenn es seine bewandtnis hat. man simuliert normalität. – schlitzohrige katzen schleichen ums haus. diffuse geräusche, nachbarsstimmen, ein sorglos knisterndes radio. lina in ihrem wundergarten, der mich an den zöllner rousseau denken lässt. sie lässt es wuchern und verhält sich grosszügig. die geometrie der zugangspfade verleiht der szenerie eine wilde strenge. die ältere frau macht einen verwilderten, geisterhaften eindruck. gut zu wissen, dass da jemand so grosszügig gegensteuert und den garten als oase im dorf bestellt. – man ist gleich etwas nachsichtiger, wenn die nervtötenden rasenmäher rumoren.
endlich komme ich auf die feine bachmann-lesung von helga schubert, en plein air, virtuell aus ihrem garten übertragen, zu sprechen, worauf sie mich aufmerksam machten. für sie in gewissem sinne eine wiederbegegnung, da es konkrete verlagsberührungspunkte gab. – es ist leider nicht immer so, dass kühne texte das rennen machen in der zirkusmanege der kritikerinnen, die sich so gerne kaprizieren und „das männchen“ machen. in diesem fall hat frau schubert zurecht „das rennen“ des preislesens gemacht. schön und gerecht, dass sie überhaupt, diese späte, zweite chance bekommen hat. ihre ruhige, bedachte art, der tonfall ihrer vielschichtigen erinnerungen an die mutter haben mich völlig überzeugt.
so etwas wie eine sommerpause naht.
am mittwoch wird vom zimmermann ein zwischenboden in meinem atelier in form einer empore eingezogen, notwendig gemacht wegen der nicht endenden bücherflut. es geht zentral wieder darum, platz zu schaffen fürs eigene tun, das eigene archiv zu überwinden, so zu tun, als wäre alles noch zu leisten.
ich freue mich, sie persönlich und „leibhaftig“ kennenzulernen, wenn sie am 6ten sept. zu gast im literaturhaus liechtenstein sein werden.
ich wünsche ihnen weiterhin muse, energie und mut für all ihre projekte, insbesondere für das buchstabieren ihrer stadt in ihren düften und gelegentlich bestimmt auch dornen.
sehr verbunden, ihr hajqu

Un epistolario tra sconosciuti. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Quinta lettera / Lettera 10: Stamattina mentre me ne stavo comodamente sdraiato sulla poltrona del dentista, ho cominciato a pensare …
weiter ...Cara Barbara!
Stamattina mentre me ne stavo comodamente sdraiato sulla poltrona del dentista, ho cominciato a pensare a cosa ti avrei scritto per rispondere alla tua ultima lettera. La mia mente si è messa a viaggiare, un po’ cercando di fare mente locale su quello che mi hai scritto tu e che avevo riletto proprio prima di uscire di casa, un po’ in cerca di una storia che potesse suggellare questo nostro epistolario tra sconosciuti che però ha forse finito col renderci un po’ meno sconosciuti.
Dici bene a proposito del fatto che noi umani siamo così, possiamo scegliere tra bene e male, talvolta finiamo anche col scegliere la via di mezzo, o semplicemente la via più comoda, che non deve essere per forza il male.
Umani, quindi imperfetti, d’altra parte se non fossimo imperfetti finiremmo con l’essere degli dei, i famosi dei di cui siamo occupati a più riprese nel nostro scambio di lettere. A te, Barbara, piacerebbe essere perfetta? A me sinceramente no, sai che noia sarebbe la vita… conosco gente che è convinta di esserlo e non hai idea di che futilità e noiosità siano queste persone! Se sbagli hai almeno la possibilità di ricrederti, di ammettere lo sbaglio, di scusarti anche… Ma quelli che fanno tutto sempre alla perfezione, quelli non avranno mai il piacere di poter ammettere un proprio errore. E poi non è per forza detto che gli errori debbano sempre essere negativi.
Non so se ci hai mai fatto caso, ma la vita spesso è come un viaggio in corriera, uno di quei lunghi, interminabili viaggi che sembra non vogliano mai terminare. Non parlo di quelle corriere tipo Gran Turismo che si vedono ogni tanto in autostrada o ferme davanti agli alberghi delle località turistiche della nostra regione. Parlo delle corriere che congiungono un luogo con un altro, quelle corriere con cui si viaggia non solo materialmente ma anche con la mente. Trovo che sia una prerogativa tipica delle corriere, i treni ad esempio sono già qualcosa di diverso.
Ma le corriere di linea sono perfette per far lavorare la fantasia. Sarà la mia propensione per la scrittura e per il creare storie, ma ho sempre tratto grande ispirazione dai viaggi in bus, un po’ guardando i paesaggi attraverso i quali le corriere sfrecciano, un po’ prendendo appunti mentalmente, ma anche con l’aiuto di carta e penna, un po’ costruendo storie sui compagni di viaggio sconosciuti che ci siedono accanto, davanti, dietro o nei sedili sull’altro lato del corridoio, e anche sull’autista naturalmente.
Come nella vita, anche sul bus ci troviamo a contatto con altre persone, persone che la vita ha messo sul nostro cammino, persone con cui possiamo trovarci bene, ma anche persone che non ci aggradano.
Per avvalorare questa mia teoria sul viaggio in corriera come parafrasi e metafora della vita, vorrei raccontarti di un lungo tragitto che ho percorso anni fa attraverso la Bassa California, durante un’estate particolarmente calda. Viaggiavamo a bordo di un bus della compagnia Tres Estrellas de Oro (le tre stelle erano la sicurezza, la comodità e la cortesia), partiti da Tijuana e diretti a Mulegé, all’incirca a metà di quella sottile penisola che si allunga oltre il confine tra Stati Uniti e Messico, bagnata su un lato occidentale dall’Oceano Pacifico e sull’altro dal Mare di Cortez. Il grande, incognito, imprevisto di quel viaggio si manifestò quasi subito, quando alla fermata di Ensenada uno dei due autisti ci comunicò che un uragano stava attraversando la penisola, ma non si sapeva esattamente in che punto e quindi prima o poi ci saremmo dovuti fermare in attesa che gli eventi volgessero a nostro favore. Questo ci portò ad una sosta di quasi dieci ore nella stazione delle corriere di Guerrero Negro (dove eravamo arrivati nel sonno prima dell’alba), al largo delle cui coste vanno a partorire le balene nei mesi invernali. A quei tempi non ero però ancora un appassionato di cetacei ed essendo estate ero comunque fuori stagione, ma credo che la cosa stia pur a significare qualcosa.
Per essere un semplice autobus che congiungeva l’estremo nord della penisola col suo estremo meridione bisogna dire che offriva un vasto e vario tipo di umanità. In particolare stringemmo amicizia con due tipici messicani espatriati nella zona di Los Angeles, così tipici che non riusciresti ad immaginarteli diversi da come erano, con la carnagione abbronzata ed i baffetti. Melchiòr e Tio Felipe (viaggiava col figlioletto e il nipotino che ogni volta che gli si rivolgeva lo chiamava così). Ma sul bus c’erano anche sei germanici, tre di Colonia e tre di Lipsia, che si guardavano in cagnesco.
I tre di Lipsia, ogni volta che qualcuno chiedeva loro da dove venissero si ostinavano a rispondere, in un inglese più scalcinato del mio, che provenivano dall’East Germany, finché ad un certo punto fu Tio Felipe a porre fine alla pantomima dicendo che a lui risultava che da un paio d’anni di Germania ce ne fosse una sola!
La corriera ripartì dopopranzo e dopo la siesta degli autisti, un bus proveniente dalla direzione opposta ci aveva messi al corrente che ora la strada era stata riaperta: per modo di dire… ci fecero togliere tutto dal bagagliaio perché ci sarebbero stati parecchi guadi lungo la strada e si sarebbe corso il rischio di bagnare zaini, borse e valigie. Ad ogni fermata i messicani e i tedeschi scendevano a comprare birra e tequila. Melchiòr raccontava storie: ci diceva che lui si chiamava come uno dei re Magi, che aveva due fratelli Balthasàr e Caspàr, e che, come se non bastasse sua moglie si chiamava Reina, che in spagnolo vuol dire Regina. Poco più avanti una coppia amoreggiava, in prima fila un signore dai capelli impomatati e con gli immancabili baffetti sudava impassibilmente senza scomporsi. Due dei ragazzi di Lipsia e Tio Felipe furono alla fine sopraffatti dai fumi dell’alcol, per la gioia dei due bambini che guardavano il baffuto congiunto ribaltato sul sedile intento a dormire russando rumorosamente.
Quando raggiungemmo la nostra destinazione, coincidente con quella dei tre di Colonia, era quasi notte un’altra volta e dovevamo ancora trovare un posto dove dormire, ma prima che il bus ripartisse ci fu ancora il tempo per una birra a bordo e poi abbracci e pacche sulle spalle con Melchiòr, i tre di Lipsia e Tio Felipe.
Mentre nello studio del dentista l’igienista terminava di farmi la pulizia dentale, ho provato a trasporre quel mio viaggio nella realtà attuale. Sarebbe stato un viaggio bruttissimo oggi: una corriera semivuota, i passeggeri mascherati e distanti, niente abbracci una volta arrivati a destinazione. E allora che felicità per quel mio viaggio, e visto che il viaggio è la vita, che felicità per questa mia vita, che non è sempre rose e fiori, che è fatta come tutte le vite anche di luci ed ombre. Ma è la mia vita e tanto basta.
Spero di non essermi dilungato troppo Barbara. A volte mi faccio prendere l mano, te l’ho già scritto, soprattutto quando si tratta di raccontare una storia. Vorrei dire ancora qualcosa sul nostro viaggio. Perché, diciamocelo, anche questo scambio di lettere è stato una specie di viaggio, a volte interiore, a volte no, un viaggio a base di lettere tra sconosciuti. A conti fatti direi anche un bel viaggio. E voglio concludere, tornando alla mia amata musica rock, con una canzone dei Kinks che s’intitola Strangers e il cui ritornello dice: estranei lungo la strada su cui ci troviamo, ma non siamo in due, siamo uno solo… è così nella vita, sulla corriera, negli scambi epistolari.
Buon proseguimento Barbara, aloha!
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Peter Gilgen & Gabriele Bösch
Brief 5: „Einst war der Strang die klassische Methode des Lynchens. Jetzt ist es die Kugel des Polizisten …”
weiter ...Liebe Gabriele,
„Einst war der Strang die klassische Methode des Lynchens. Jetzt ist es die Kugel des Polizisten. Für viele Amerikaner ist die Polizei die Regierung oder zumindest ihre sichtbarste Vertretung. Wir behaupten, dass die Befunde nahelegen, dass das Töten von Schwarzen zur offiziellen Polizeistrategie geworden ist und dass die Strategie der Polizei der deutlichste praktische Ausdruck der Strategie der Regierung ist.”
Vor ein paar Tagen stolperte ich bei meiner Lektüre über dieses Zitat. Ich übertrug es möglichst genau ins Deutsche, um die Worte nicht nur verstehen, sondern auch das sie animierende, mit fast übermenschlicher Disziplin unter Kontrolle gehaltene Beben fühlen zu können. Nur zwischen den Zeilen wird die Entrüstung, der Zorn der Verfasser hörbar: ein lähmendes Schweigen über ihr eigenes Leiden, das all jenen abverlangt wird, die sich ihr Recht auf amtlichem Weg verschaffen wollen in einer Gesellschaft, die es ihnen vorenthält. Man möchte meinen, diese sachliche Anklage sei unter dem Eindruck der Ereignisse vom 25. Mai 2020 geschrieben, als George Floyd, ein wehrloser und unbewaffneter Mann in Minneapolis am hellichten Tag von drei Polizisten brutal ermordet wurde, während ein vierter lautstark protestierende Passanten auf Distanz hielt. Tatsächlich stammen die Sätze aus einer von schwarzen Bürgerrechtlern 1951 an die UNO adressierten Petition, die unbeantwortet blieb.
Kommentare, die oft in ähnlichen Worten nichts anderes sagen, waren nach Floyds Tod in vielen Zeitungen und im Internet zu lesen oder in Fernseh- und Videosendungen rund um die Welt zu hören. Als wäre es den meisten Lesern, und Hörern und selbst den Schreibenden erst in den letzten Wochen bewusst geworden, dass es diese Zustände noch immer gibt und dass die lange Kette der Unterdrückung sich von der Sklaverei über die gesetzlich verordnete, erbarmungslos durchgesetzte Rassentrennung bis zur weiterhin bestehenden massiven Benachteiligung, sei es im Wirtschafts-, Bildungs- oder Gesundheitssystem, fortsetzt. Als hätte man bisher kaum oder nur schulterzuckend zur Kenntnis genommen, dass schwarze Männer mit erheblich grösserer Wahrscheinlichkeit als ihre weissen Pendants für die gleichen Vergehen jahrelang ins Gefängnis gesteckt oder in einigen Bundesstaaten auch hingerichtet werden. Als hätte man vergessen, dass selbst eine Pandemie unter der schwarzen Bevölkerung hierzulande ein Mehrfaches an Opfern fordert, nicht wegen besonderer genetischer Veranlagungen, sondern aus dem einfachen Grund, dass in diesem Land die ärmere Bevölkerung froh sein muss, wenn sie überhaupt Zugang zu einer funktionierenden medizinischen Versorgung hat. Als hätte man noch nie selbst erlebt, wie eine Person schwarzer Hautfarbe öffentlich beleidigt, gedemütigt und diskriminiert wird. Als wäre all dies nur eine Randerscheinung dieser Great Nation, die sich seit ihrer Gründung als das neue erwählte Volk sieht – so schon Thomas Jefferson, der grossartige Philosoph, Aufklärer, Staatsmann, Gründervater und dritte Präsident der jungen Republik, der sich bis zu seinem Lebensende nicht dazu aufraffen konnte, die Sklaven, die er hielt, in die Freiheit zu entlassen. All dies in einem Land, das für sich in Anspruch nimmt, 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung als erste Nation in der Geschichte auf der Grundlage gleicher Rechte für alle gegründet worden zu sein.
Liebe Gabriele, als ich Deinen genau argumentierenden und meine Gedanken und Argumente zur Coronakrise herausfordernden zweiten Brief erhielt, wollte ich Dir sogleich antworten. Doch zwischen dem Sonntag, auf den Dein Brief datiert ist, und dem Mittwoch, als ich ihn in meiner Inbox fand, liegt jener 25. Mai: Eine Zäsur in der Geschichte dieses Landes, die, so wage ich zu behaupten, derjenigen in den späten 60er Jahren in nichts nachsteht. Man wird einst von der Zeit davor und danach sprechen. George Floyd, der mit der grossen Geschichte nichts am Hut hatte und sich durchschlug, so gut es ging, der von Houston, wo er ein Kleinkrimineller gewesen war, wegzog, um im fernen Minneapolis ein neues Leben zu beginnen, und der sich in den sieben Jahren seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis nichts mehr zuschulden kommen liess – dieser George Floyd wird der historischen Wende, die wir gerade erleben, den Namen gegeben haben. Er war kein Martin Luther King, und wie viele andere von Polizisten ermordete Schwarze, deren Namen uns die Bewegung Black Lives Matter in Erinnerung ruft, hatte er nicht das Glück eines Rodney King, der die auf ihn wie ein ungnädiges Schicksal niedergehende Polizeibrutalität überlebte. Seit Floyds Tod sind schon wieder mehr als ein Dutzend schwarze Menschen unter fragwürdigen Umständen von Polizisten getötet worden, nicht zu reden von den zahlreichen Fällen allein im laufenden Jahr, in denen Polizisten und Ex-Polizisten aus geringfügigen Gründen schwarze Menschen umbrachten.
Vor einigen Tagen las ich, dass in Südkalifornien am 31. Mai und am 10. Juni die Leichen zweier junger schwarzer Männer gefunden wurden. Man hatte sie etwa 80 Kilometer voneinander entfernt an Bäumen aufgehängt. Die Polizei ging von Selbstmorden aus, obwohl die Symbolik und, wie sich mittlerweile herausstellt hat, die Indizienlage eindeutig sind.
Vor achtzig Jahren hatte Billie Holiday mit schmerzdurchdrungener Stimme die seltsamen, im Süden der USA an den Bäumen baumelnden Früchte besungen:
Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black bodies swinging in the Southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Kann dieses Lied, um es mit Kafka zu sagen, etwas anderes sein als „die Axt für das gefrorene Meer in uns”?
Lady Day sang Strange Fruit immer am Ende ihres Sets. Dann ging das Licht aus, und als es wieder anging, war die Bühne leer. Schon nach den ersten dieser Auftritte wurde die Sängerin zur Zielscheibe von Rassisten. Besonders der mächtige Harry Anslinger, der 32 Jahre lang dem Federal Bureau of Narcotics vorstand, nutzte seine Stellung, um Holiday zum Schweigen zu bringen. Er untersagte ihr, das Lied weiterhin zu singen. Als die Sängerin sich seiner Anordnung widersetzte, liess er sie wegen ihrer Drogenprobleme verhaften. Sie sass mehr als ein Jahr im Gefängnis. Nach Ihrer Entlassung wurde ihr die Lizenz für weitere Auftritte in Nachtclubs verweigert. Als Billie Holiday 1959 mit fortgeschrittener Leberzirrhose und herzkrank im Krankenhaus lag, liess Anslinger sie mit Handschellen ans Krankenbett fesseln. Er verbot den Ärzten jede weitere Behandlung. Lady Day starb wenige Tage später. Sie war 44 Jahre alt.
Es ist eine bittere Ironie, dass auch Holidays Vater in einem texanischen Krankenhaus nur für Weisse, in das er als Notfall eingeliefert worden war, die medizinische Behandlung verweigert wurde. In ihrer 1956 veröffentlichten Autobiographie Lady Sings the Blues schreibt Holiday, dass Strange Fruit sie an das Schicksal ihres Vaters erinnerte und dass sie sich jedesmal dazu zwingen musste, das Lied zu singen. Sie habe es nur deshalb getan, „weil 20 Jahre nach Papas Tod das, was ihn umgebracht hat, in den Südstaaten noch immer gang und gäbe ist.”
Seit ich vor mehr als dreissig Jahren erstmals in die Vereinigten Staaten kam, hat der staatlich sanktionierte Terror gegen schwarze Menschen nie aufgehört. Jedes Jahr gibt es Einsätze, bei denen die Polizei versehentlich einen Afroamerikaner tötet, einem verletzten schwarzen Verhafteten keine medizinische Hilfe zukommen lässt oder dunkelhäutige Menschen in Einkaufszentren auf erniedrigende Weise kontrolliert, weil sie angeblich dem Profil irgendeines Verdächtigen entsprechen. Regelmässig sprechen Politiker dann von bedauerlichen Einzelfällen oder geben Beamten die Schuld, die ihre Kompetenzen überschritten hätten und gegen die nun eine Untersuchung eingeleitet werden müsse. Man muss kein besonders geübter politischer Beobachter sein, um zu erkennen, dass in diesem Land die Gewaltbereitschaft der Polizei und der systemische Rassimus zwei Seiten derselben Medaille sind.
Das wollen viele Amerikaner nicht wahrhaben. Ich meine hier nicht die fanatischen Anhänger eines unfähigen Präsidenten, der in Wort und Tat offene Anleihen beim Faschismus macht, um sich als Kämpfer für Recht und Ordnung zu inszenieren und von seinem Versagen in der Coronakrise abzulenken. Bei ihnen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich meine eher Menschen, die sich liberal geben, in vielen Fällen eine gute Ausbildung genossen haben und komfortabel leben – vielleicht ein bisschen zu komfortabel – und die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit mit allerhand sophistischen Argumenten rhetorisch neutralisieren. Doch in dieser Frage gibt es keine zwei Seiten und daher auch nichts, was neutralisiert werden könnte. Neutralität steckt mit der Unterdrückung unter einer Decke. Darin liegt ihre besondere Perfidität.
Soweit wir wissen, wurde George Floyd zu keinem Zeitpunkt gewalttätig. Das erste Polizeibulletin, veröffentlicht, als noch niemand wusste, dass nahezu der ganze Vorfall von mehreren Sicherheitskameras und den Handys einiger Augenzeugen aus verschiedenen Perspektiven aufgezeichnet worden war, war eine Lüge. Man behauptete, Floyd sei wegen Gesundheitsproblemen zusammengebrochen, worauf man einen Krankenwagen angefordert habe. Ich habe mir alle veröffentlichten Aufnahmen immer wieder angesehen. Floyd scheint mit der Polizei zu kooperieren. Erst als er in den Polizeiwagen einsteigen soll, gibt es eine Verzögerung. Es ist möglich, dass er sich widersetzt. Man kann es auf dem Video nicht genau erkennen. Wenige Sekunden später liegt George Floyd bereits am Boden, die Hände hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Er liegt auf dem Bauch und hat keine Möglichkeit sich zu wehren. Ein Polizist drückt sein Knie mit voller Kraft 8 Minuten und 46 Sekunden lang auf den Hals des Verhafteten und reagiert nicht, als dieser röchelt, sich windet und wiederholt bittet: “Please, I can’t breathe, man, please.” Dazwischen ruft der 46 Jahre alte und kräftige Mann auch einmal verzweifelt nach seiner toten Mutter. Der Polizist macht weiter. Dann verstummt George Floyd. Sein Körper erschlafft. Zivilisten in der Nähe flehen die Polizisten an, endlich vom Mann, der sich nicht mehr bewegt, abzulassen.
Es ist, als hätte George Floyd, der mit einem falschen 20-Dollar-Schein Zigaretten kaufen wollte, im Moment seiner Ermordung einen anderen unbewaffneten schwarzen Mann zitiert, der 2014 in New York umgebracht wurde. Ein Polizist hatte Eric Garner, der an einer Strassenecke illegal Zigaretten verkaufte, mit einem verbotenen Würgegriff getötet. In Todesangst rief auch Garner: “I can’t breathe!” Es waren seine letzten Worte.
In einer perfekt konstruierten Geschichte wäre 2008 der Höhepunkt gewesen, an dem sich ein dauerhafte Veränderung ereignet hätte. Man kann sich die unbändige Freude, die Begeisterung und den Optimismus der schwarzen Bevölkerung kaum vorstellen, als Barack Obama zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Doch die reale Geschichte hielt sich nicht an das ideale Drehbuch. Die Rede von der Überwindung des Rassismus war verfrüht und vor allem der eigenen Erleichterung geschuldet. Wir wollten mit aller Macht daran glauben, dass das historische Versprechen der Vereinigten Staaten endlich eingelöst werde: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” (Präambel der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776)
Ein Versprechen, hinter dem die Verbrechen an der schwarzen Bevölkerung, die seit 4 Jahrhunderten andauern, verschwinden sollten: ungeschehen gemacht und durch diese schönen Worte schmerzlos gesühnt. Die ersten amerikanischen Sklaven wurden aus dem Königreich Ndongo im heutigen Angola verschleppt. Sie kammen 1619 in Virginia an. Bis auf den heutigen Tag sind die unveräusserlichen Rechte ihrer Nachkommen etwas weniger unveräusserlich als diejenigen ihrer weissen Mitbürger.
Lassen wir uns nicht täuschen: Es gibt noch immer genug uneinsichtige Polizeivertreter und militante Anhänger des Präsidenten, der von Anbeginn seiner Amtszeit seine Sympathie für Rassisten offen zur Schau stellte. Der 2004 für ein Ministeramt vorgeschlagene ehemalige New Yorker Polizeichef Bernard Kerik meinte in einem Interview mit dem Fox-Fernsehsender zur Ermordung George Floyds: „Solche Dinge passieren halt.” Das wirkliche Ärgernis sei, dass die Proteste vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden angestachelt würden, während im Hintergrund der jüdische Milliardär George Soros die Strippen ziehe. Die Interviewerin fragt ihn mit gespielter Entrüstung: „Können wir das wirklich sagen? Wissen wir das auch sicher? George Soros? Joe Biden? Wissen wir das?” Darauf Kerik: „Nun, dies sind Berichte – von etablierten Nachrichtenquellen verfasste Berichte!” Welche Quellen er damit gemeint haben könnte, bleibt sein Geheimnis.
Um Kerik überhaupt als ausgewiesenen Experten präsentieren zu können, muss Fox auf die Vergesslichkeit seiner Zuschauer hoffen oder darauf, dass sich das Stammpublikum von Verfehlungen und Verbrechen nicht irritieren lässt, solange die politische Richtung stimmt. Denn die zunächst glänzende Karriere Bernard Keriks endete abrupt, als er 2009 wegen mehrfachen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Die beanstandeten Geldzuwendungen waren erfolgt, als Kerik 2003 nach der Invasion vorübergehend im Irak als Innenminister tätig war. Er legte ein Geständnis ab und verbüsste seine Strafe. Trotzdem wurde er im vergangenen Februar nachträglich von Donald Trump in allen Punkten begnadigt, was auch bedeutet, dass sein Vorstrafenregister gelöscht wurde. So wäscht eine Hand die andere, und ein Lügner lügt zugunsten des anderen auf einem Fernsehkanal, der innerhalb von zwanzig Jahren zum Lügenkanal und Propagandainstrument des rechtsextremen Flügels der republikanischen Partei verkommen ist. Den Zuschauerzahlen hat das nicht geschadet. Ganz im Gegenteil: der Markt für Ressentiments und Verschwörungstheorien boomt.
Wie kann sich die Minderheit der Afroamerikaner unter den gegenwärtigen Bedingungen anders Gehör verschaffen als auf der Strasse? Alle anderen Beschwerden und Proteste verhallen seit Jahrzehnten ungehört oder werden unterdrückt. Als während der Spielzeit 2016/17 Colin Kaepernick, damals der Quarterback oder Spielmacher der San Francisco 49ers, begann, beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie zu gehen, um auf die Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam zu machen, wurde er vom Präsidenten der Vereinigten Staaten als “Hurensohn” beschimpft. Viele Sportfans wollten keine politischen Gesten auf dem Rasen dulden. Man warf Kaepernick und den Spielern, die seinem Beispiel gefolgt waren, vor, sie missachteten die amerikanische Flagge und damit die Nation. Es gebe geeignetere Wege, politische Missbilligung kundzutun. Die National Football League tat alles, was in ihrer Macht stand, um den eindrücklichen stillen Protest zu unterbinden. Als Kaepernick sich nicht einschüchtern liess, ruinierte man seine Karriere. Seit die 49ers am Ende der Saison 2017 seinen Abgang erzwangen, sucht er, einer der talentiertesten Spielmacher seiner Generation, vergeblich nach einem neuen Team. Immerhin sah sich die Liga im Februar 2019 gezwungen, mit Kaepernick einen Vergleich abzuschliessen und ihm eine hohe Summe, über die Stillschweigen vereinbart wurde, zu zahlen, um die Weiterführung des von ihm angestrengten Diskriminierungsprozesses zu verhindern. Die National Football League wird es verkraften. Bald danach setzte man das Gerücht in die Welt, Kaepernick habe den Zenith seines Könnens ohnehin überschritten und widme sich lieber anderen Projekten.
Wie in diesem Fall kommt schwarzer Protest auch für manche liberale Weisse, die sich davon unangenehm berührt fühlen, stets zur falschen Zeit. Und nie ist es der richtige Ort, nie die passende Gelegenheit, nie der angemessene Ton. Den Sport will man sich nicht von politischen Fragen verderben lassen. Bei Hollywood-Preisverleihungen wird mittlerweile das Orchester instruiert, sobald eine Rede allzu politisch wird, möglichst laut zu spielen, um den Redner zu übertönen. Bei Campus-Protesten stören sich konservative Studenten daran, dass so etwas gerade in den heiligen Hallen von Wissenschaft und Bildung stattfinden müsse. Und wenn die Protestierenden auf die Strasse gehen, um unübersehbar und lautstark auf ihre Unterdrückung hinzuweisen, wird ihnen gesagt, anstatt zu randalieren, hätten sie sich doch viel eher und ganz zivilisiert bei den entsprechenden Stellen beschweren können, die es im Rechtssystem der Vereinigten Staaten mittlerweile durchaus gebe; man habe schliesslich dazugelernt.
Dass es strukturellen Rassismus gibt, ist für jene, die nicht davon betroffen sind, oft schwer nachzuvollziehen. Als ich vor über 30 Jahren in Chicago lebte, erklärte mir eine afro-amerikanische Studentin, wie sehr ein diffuser Rassismus, für den sich niemand verantwortlich fühle, ihren Alltag präge. Sie erzählte davon, wie man ihr unterschwellig und doch deutlich zu verstehen gebe, dass sie in gewissen Restaurants oder Geschäften nicht willkommen sei, vor allem wenn sie einen weissen Mann begleite. Wenn sie in den exklusiven Kaufhäusern einkaufen gehe, merke sie oft sehr schnell, dass jede ihrer Bewegungen von einem Kaufhausdetektiv beobachtet werde. Ausserdem seien Kosmetika für schwarze Frauen in einer separaten Virtrine eingeschlossen, während sich weisse Frauen ihre Hautcremes einfach aus dem Regal nehmen könnten. Dieser stillschweigende Generalverdacht, gebe ihr das Gefühl, etwas Minderes zu sein.
Ich war verlegen und beteuerte schnell, dass ich als gerade erst ins Land gekommener Europäer nichts davon wisse und nichts damit zu tun habe. Ich muss zugeben, dass ich wohl auch etwas skeptisch war, denn ich konnte mir das Ausmass des real existierenden Rassismus nicht vorstellen. Vielleicht war meine Bekannte besonders empfindlich, weil ihr ein Unrecht widerfahren war? Was tut man nicht alles, um unbequemen Fragen auszuweichen – Fragen, von denen man weiss, dass sie einen angehen, auch wenn man sich selbst umso lauter für nicht zuständig erklärt. Nicht dass ich Zweifel an den Erfahrungen dieser Frau geäussert hätte. Wie hätte ich das als Neuankömmling in ihrem Land auch tun können? Eher war es ein inneres Distanz-Halten: die bequeme Illusion, dass mich all die geschilderten Vorkommnisse nicht betrafen, weil ich Ausländer war – noch dazu aus einem Land, in dem es diese Probleme nicht gab.
War ich wirklich davon überzeugt, dass es in der Schweiz und in Liechtenstein, den beiden Ländern, in denen ich vor meiner Ankunft in den USA gelebt hatte, keinen Rassismus gab? Man wusste schon damals, dass ein Konfekt nicht “Mohrenkopf” heissen sollte, und dass stereotype Abbildungen von schwarzen Menschen auf Kaffeeverpackungen, Bierflaschen und Wirtshausschildern nichts zu suchen haben. Mehr als dreissig Jahre später werden immer noch die gleichen Ausreden angeführt, als ob es geradezu unvorstellbar wäre, andere Namen und Bilder für diese Dinge zu finden.
Wenn ich in den Online-Zeitungen meiner beiden Heimatländer die Lesermeinungen und Kommentare lese, die sich auf die Macht der Tradition und Ähnliches berufen, fallen mir die italienischen Gastarbeiter ein, die in meinem Dorf lebten, als ich ein Kind war. Am Samstag standen sie vor der Telefonzelle beim Postgebäude Schlange, um für ein paar Minuten mit ihren Familien sprechen zu können. Die meisten von ihnen waren sogenannte Saisonniers. Sie waren allein gekommen. Sie durften ihre Frauen und Kinder nicht mitbringen. Erst im Winter, wenn das Baugewerbe ruhte, kehrten sie in den Süden zurück.
Es gab nur wenige Familien unter ihnen: die Frauen und Kinder von Arbeitern, die eine feste Anstellung bekommen und deshalb das Recht auf Familiennachzug hatten. Ein solche Familie wohnte nicht weit vom Haus meiner Grossmutter in einem Gebäude, für das kein Liechtensteiner Miete bezahlt hätte. Die beiden Söhne, Antonio und Domenico, gingen in die gleichen Klassen wie ich und mein Bruder. Als Antonio in der zweiten Klasse zu uns kam, sprach er fast kein Deutsch. Der Lehrer machte von Anfang an klar, dass wir es hier mit jemandem zu tun hatten, der nicht zu uns gehörte. Einmal musste Antonio nach vorne ans Lehrerpult treten, und der Lehrer fragte ihn: “Antonio, wie heisst es: der, die oder das Sonne?” Und Antonio antwortete nach kurzen Zögern: “Der Sonne!” Dann fragte der Lehrer lächelnd: “Heisst es der, die oder das Mond?” Antonio antwortete: “Die Mond.” Der Lehrer wandte sich an die Klasse, zeigte auf Antonio, der neben dem Lehrerpult stand, und sagte: “Seht Ihr, das sind die Italiener! Die sagen il sole und la luna – der Sonne und die Mond. Die wissen es einfach nicht besser!” Am Ende des Schuljahres veranlasste der Lehrer, dass Antonio in die Schule für behinderte und zurückgebliebene Kinder überwiesen wurde, da er Sprachschwierigkeiten habe, beim Rechnen nicht mithalten könne und auch sonst wenig verstehe.
Antonio war oft traurig. Er kam mir zerbrechlich vor. Oft erzählte er mir, dass er eines Tages in sein Land zurückkehren und dort einen Bauernhof mit vielen schönen Tieren haben werde. Er konnte diesen fernen Tag kaum erwarten. Als ich einmal meiner Grossmutter von Antonio und dem Lehrer erzählte, unterbrach mich meine Tante und sagte, Antonio sei eben keiner von uns.
Ich wusste schon damals, dass auch ich keiner von uns war. Mein früh verstorbener Vater war Ausländer gewesen. Am Tag der Hochzeit verlor meine Mutter ihr Bürgerrecht. Erst viele Jahre später erhielt sie es nach einer Gesetzesänderung zurück. Wir Kinder blieben jedoch noch lange Ausländer. Jedes zweite Jahr hatten wir bei der Fremdenpolizei um Verlängerung der Niederlassungsbewilligung nachzusuchen. Als Grund war anzugeben: „Verbleib bei der Mutter”.
Als ich in Amerika ankam, fühlte ich zunächst eine fast grenzenlose Freiheit. Das hatte nicht nur mit den vielen neuen Erfahrungen und der Grösse des Landes zu tun, mit der Intensität von Chicago und zwei Jahre später der landschaftlichen Schönheit und der Internationalität von Kalifornien. In der Bevölkerung der Bay Area um San Francisco, wo ich hinzog, um mein Studium fortzusetzen, sind auf engem Raum mehr Nationalitäten und Ethnien vertreten als irgendwo sonst auf der Welt. Bald erlag ich der Illusion, dass diese bunte, wirtschaftlich und kulturell führende Gegend ein Abbild der Vereinigten Staaten sei. Sonderlinge und Visionäre gab es zuhauf. Es schien, als ob es für jeden eine eigene Nische gäbe. Die Computerindustrie befand sich inmitten eines enormen Wachstumsschubs. Alle Ideen waren gefragt. Jeder, so schien es, konnte sein, was er wollte. Das Leben war leicht. Die Sonne schien 261 Tage im Jahr.
Die Idylle wurde bald durchbrochen. Am 3. März 1991 filmte ein unbeteiligter Mann in Los Angeles von seinem Balkon aus die Festnahme eines angetrunkenen Fahrers. Vierzehn Polizisten waren beteiligt. Vier davon prügelten mit ihren Schlagstöcken, die sie wie Baseballschläger zweihändig hielten, auf den wehrlos am Boden liegenden Rodney King ein. Als das Video veröffentlicht wurde, löste es einen Sturm der Entrüstung aus. Zur anberaumten Pressekonferenz konnte King, ein schwarzer Mann, nur im Rollstuhl erscheinen: Sein rechtes Bein war gebrochen. Sein Körper war von weiteren Frakturen und zahlreichen Schwellungen und Schnittwunden gezeichnet. Im Brustbereich erlitt King schwere Verbrennungen, als ihm einer der Polizisten mit einer Taser-Waffe einen 50’000-Volt-Elektroschock versetzte.
Die vier Polizisten mussten sich ein Jahr später vor Gericht verantworten. Zwölf Geschworene – zehn davon weiss, keiner schwarz – sprachen am 29. April 1992 wider Erwarten die Polizisten frei. Unter anderem war es ihnen nicht möglich, auf dem Video, das mehrmals in Superzeitlupe abgespielt wurde, den genauen Zeitpunkt auszumachen, in dem die Polizeigewalt das erlaubte Mass überschritten hatte. In einem Kommentar für die Los Angeles Times gab der Medientheoretiker Brian Stonehill zu bedenken, dass uns durch die enorme Verlangsamung der Filmbilder der Sinn für die alte Einheit der Zeit verloren gehe. Betrachte man degegen die Aufnahme in Realzeit, dann müsse man nicht fragen, was da geschehe: “In real time, there’s no question what’s happening on the tape.”
Muss man sich wundern, dass die Menschen das Recht in ihre eigene Hand nahmen und tagelang in Los Angeles randalierten? Erst der Einsatz der kalifornischen Nationalgarde und des amerikanischen Militärs vermochte den drohenden Aufstand einzudämmen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit – will heissen: weil es die kompromittierende Videoaufnahme gab – wurden die Polizisten wegen Verletzung der Bürgerrechte Rodney Kings erneut angeklagt. Zwei von ihnen wurden verurteilt, die anderen beiden freigesprochen.
Herb, ein schwarzer Studienkollege, klagte ein paar Wochen später über die rassistische Polizei, weil er bei seiner Fahrt zur Universität von einer Streife angehalten und für zu schnelles Fahren gebüsst worden war. Ich gab zu bedenken, dass er doch die Geschwindigkeit übertreten habe und dies wenig mit Rassismus zu tun habe. “Nein,” sagte er, “da liegst Du falsch. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass ein Weisser an meiner Stelle nicht bestraft und wahrscheinlich nicht einmal angehalten worden wäre.” Herb, den ich kaum kannte, starb wenige Jahre danach an AIDS. Unser kurzes Gespräch blieb mir im Gedächtnis. Zwar war ich von seinen Argumenten nicht überzeugt, hatte aber zugleich unterschwellig das unangenehme Gefühl, dass Herb etwas Wahres benannt hatte. Man muss dazu wissen, dass in den USA ein Polizist einen Fahrer nur aufgrund eines begründeten Verdachts anhalten darf. Es gibt daher keine allgemeinen Geschwindigkeitskontrollen. Ein Polizist muss das fragliche Vergehen selbst gesehen haben, dem fehlbaren Lenker folgen und ihn zum Anhalten zwingen. Den Begriff des racial profiling kannte ich damals noch nicht.
Die entsprechende Praxis hatte ich jedoch schon öfter mit eigenen Augen gesehen. An einem Freitagabend fuhr ich von der Autobahn ab, die Palo Alto, den Mittelpunkt des Silicon Valley, vom heruntergekommenen East Palo Alto trennte, in dem vor allem die ärmere schwarze Bevölkerung lebte. Auf der Überführung hatten Polizisten Barrikaden errichtet. Jeder Schwarze, der die Grenze nach Palo Alto überquerte, wurde aufgefordert, sich auszuweisen, und gefragt, was er denn an einem Freitagabend in Palo Alto wolle. Die Polizisten wussten so gut wie ich, dass es in East Palo Alto nur einen einzigen Reggae-Club gab. Der Drogenhandel florierte auf dem dahinter liegenden Parkplatz, der vom spärlichen Licht, das aus der Tür des Clubs drang, kaum beleuchtet wurde. In Palo Alto dagegen gab es zahlreiche Bars und Clubs, in denen die Leute am Wochenende miteinander tranken und ausgelassen tanzten und sich amüsierten und dazwischen auf den Toiletten ganz unbehelligt von der Polizei eine Prise Kokain schnupften. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, forderte die Palo Alto Police die Überprüften ohne weitere Begründung dazu auf, wieder nach East Palo Alto zurückzukehren. Die Barrikaden und Polizeiwagen mit ihren gespentisch rotierenden blau-roten Lichtern standen jedes Wochenende auf der dunklen Autobahnüberführung. Wenn dies in einer der liberalsten Kleinstädte im liberalsten Bundesstaat geschah, schoss es mir durch den Kopf, wie mochte es dann anderswo zugehen?
Ich wurde in all den Jahren nur einmal angehalten und kontrolliert: als ich bei einem Stoppsignal mein Auto weiterrollen liess, anstatt abzubremsen. Der Polizist erinnerte mich freundlich an die Verkehrsregeln und liess mich dann ohne die eigentlich obligatorische Busse weiterfahren. Dennoch fühlte ich mich ein wenig verletzt, wenn mir in einem Gespräch klar wurde, wie wenig meine guten Absichten als weisser Mann bedeuteten. Es fühlte sich wie ein Angriff auf mein Selbstverständnis an, wenn ich nach langen Diskussionen zugeben musste, dass auch ich von den Privilegien, die der systemische Rassismus Weissen gewährt, profitierte, ob ich wollte oder nicht. Oft dachte ich in den letzten dreissig Jahren an den Mann in Chicago, von dem ich Dir in meinem ersten Brief schrieb. Hätte er mir das Geld auch in die Hand gedrückt, wenn meine Hautfarbe dunkel gewesen wäre? Hätte ich in diesem Land, dem ich viel zu verdanken habe, dieselben Möglichkeiten gehabt, wenn ich aus einer nicht-europäischen Weltgegend gekommen wäre?
Was wüsste man nicht alles gern, und wird es doch nie wissen! Ich weiss nicht, wie es ist, nicht weiss zu sein. Ich weiss nicht, wie es sich anfühlt, wenn man wegen seiner Hautfarbe alle paar Tage bei irgendeiner Routinekontrolle aufgefordert wird, sich auszuweisen und anzugeben, woher man gerade kommt und wohin man will. Am ehesten kann ich diese Erfahrungen nachvollziehen, wenn ich mir ein Interview mit Miles Davis in Erinnerung rufe. Ich muss es zu jener Zeit gelesen haben, nachdem ich eines seiner letzten Konzerte erlebt hatte. Auf die Frage, ob und wann Rassismus einmal aufhören werde, antwortete Miles, der in seiner Musik nie eine Note zuviel spielte: “Dann, wenn ich in Malibu mit meinem Ferrari weiter als einen Strassenzug fahren kann, ohne von der Polizei angehalten und gefragt zu werden, wo ich das Auto geklaut hätte.”
Liebe Gabriele, eigentlich wollte ich Dir einen ganz anderen Brief schreiben. Ich wollte auf Deine treffenden Anmerkungen zur Gefahr des politischen Missbrauchs der Coronakrise antworten, denn ich glaube, dass diese Problematik in Europa und den USA sich auf sehr unterschiedliche Weise manifestiert. Ich wollte Dir auch von einem wunderbaren Gedicht schreiben, das ich am Morgen jenes Tages las, als George Floyd ermordet wurde. Ich übersetzte es und schrieb einen kleinen Kommentar dazu. Aber all das muss warten. Der Brief, an dessen Ende Du jetzt angelangt bist, hat eine andere Tonlage. Ich brauchte lange, um ihn zu schreiben. Die Situation ändert sich täglich und manchmal im Studentakt, und mit ihr das Nachdenken, das sengende, sich selbst nicht ausnehmende. Es bleibt nicht stehen, sondern verdichtet sich zu einer Beklommenheit, für die ich mitteilbare Worte suche.
Das Murmeltier ist seit drei Wochen verschwunden. Max Brod berichtet, dass Kafka einmal zu ihm sagte: “Es gibt unendlich viel Hoffnung –, nur nicht für uns.”
Herzlich,
Peter
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 5: «Ich weiss, dass wir alle uns schwer tun mit dem Denken …»
weiter ...Rogoznica, 25.06.2020
„Ich weiss, dass wir alle uns schwer tun mit dem Denken. Es ist eine schwere Last der Avantgarde, und die Sprachen sind vermischt wie in Babylon. Aber irgendwie wie durch einen Traum ist mir heute klar geworden, dass meine Chemie mich nur dann erfreut wenn sie organisch in mir ist. Sie ist organisch, wenn sie mir Freude bereitet während ich höre auf eine ferne Glocke …, das Bellen der Hunde in der Nacht, ein Zeichen nur für mich.“
Miljenko Stančić
On je sam tumačio: „Ja znam da se svi pomalo domišljamo. Da nam je teško breme avangardizma i jezici pomiješani kao u Babilonu. Ali negdje kroz san i danas mi je jasno da me moja kemija veseli samo kad je organska, a organska je kad me veseli i onda čujem ono daleko zvono…, lavež u noći, ima samo jedan znak za mene.“
Miljenko Stančić
Liebe Julia
Ich sende dir ein wunderbares Zitat von meinem liebsten kroatischen Maler Miljenko Stančić, ein Zauberformel nicht nur für das Malen.
Deine Briefe sind wie Glücks-Spiegel in meinen Tagen hier, Wortstützen, Wortschätze. Ich habe einen Brief ungesandt geschrieben, aus dem «Affekt» sagt man, aus ihm heraus, dieser «Affekt» lag dann flach auf dem Bildschirm und schaute auf mich wie eine unvollständige Beichte. Nein, es handelte sich nicht um den Roten Faden welcher in die Tiefe zeigt sondern umgekehrt, ich lag tief und suchte ein Rotes Seil mich hochzuziehen aus der Traurigkeit, oder ist das Schmerz, welcher sich wieder ausbreitet aus alter Traurigkeit.
Und mit dem obigen Satz ist (glaube ich) der Knotenpunkt allen literarischen Schreibens entdeckt. Es braucht keine Poetik-Vorlesung, es braucht keine Einweisung in kreatives Schreiben, um in den Brunnen zu fallen allein. Du hängst dann auf dem dünnen Seil, es ist keine Schaukel, du musst dich selber herausziehen und darfst andere damit nicht hineinstürzen, du bist roh, authentisch, manchmal peinlich, manchmal berührend schaust du in die Tiefe. In diesen hängenden Augenblicken beginnt das Schreiben nicht, aber die Erinnerung an diesen Moment, wenn du wieder draussen sitzt, musst du behalten.
Du hast mir das Bild aus München gesandt, dieser Augenblick welcher auf mich über geschnappt ist, und so könnte ich mich mit deinem verschenkten Augenblick wieder aus dem Brunnen herausziehen. Fast ständig denke ich über den Satz von Ingeborg Bachmann nach, die „Wahrheit“ sei dem „Menschen zumutbar“, ich frage mich, ob die Wirklichkeit eines Menschen einem anderen zumutbar ist, ohne dass der andere sie verfälscht.
Dass diese Briefe öffentlich sind, macht mir die Sache schwerer.
Die Geschichte könnte so aussehen, es gibt in der Kindertherapie einen Sandkasten, in dem man bauen darf und mit den Figuren spielen.
Einmal gab es ein munteres, schönes, waches Kind, ein Mädchen. Es gab ein anderes Kind, kleiner, mit schönen Augen, und sie liebten sich. Ihre Eltern waren unglücklich und wollten, dass ihre Kinder, wenn sie gross wären, glücklich leben, so haben diese Eltern ihre Kinder mit Schlägen erzogen, ein zukünftiges «Glück» erkauft durch Schmerz.
Die Kinder wurden gross, das Mädchen verliess den Bruder, suchte einen anderen und mussten einsehen, geschlagene Kinder sind einsam, schreiben oder trinken, oder beides.
Viele Jahre später, ihre Eltern sind alt und schwach geworden, sie haben ihren Verstand nur partiell behalten und sind auf Liebe und Fürsorge ihre damaligen Kinder angewiesen.
Diese grossen Kinder waren «ad negativ» diesen Eltern nah, so sie schauen in sich, ob nicht womöglich in ihnen selber die Dämonen der Eltern sich verstecken, mit jedem Blick zueinander erzählen sie Geschichten, welche niemandem erzählt worden sind. Was sie noch immer haben, ist Angst vor den Eltern.
Die Verwandten, die ab und zu in diesen Sandkasten kommen und sich gutmütig benehmen wie der Chor im griechischen Drama, singen den erwünschten Text – es geht uns allen so, Menschen wachsen, sterben, werden krank, sie lieben, weinen, einmal, ein einziges Mal auf der Welt, und verputschen sich das Leben weil sie nicht anders können.
Dann kommt eine Hand, und die Sandfiguren liegen flach, diese gnädige Hand der erzählbaren Geschichte baut aus Worten etwas festere Figuren, die sie vertieft, verflacht, verdunkelt, erhellt, diese innere Hand verformt bis es erträglich wird, oder formt um bis es zerplatzt. Ja, diese Arbeit des Schreibens kann mir niemand abnehmen und ist ununterrichtbar.
Aber nachdem ich das geschrieben habe, ich frage mich immer noch, was ich dir zugerufen habe, aber ich weiss es nicht, obwohl ich mir ständig (lach nicht) um dich Sorgen mache, das ist meine Art das zu sagen, heb die Sorgen … weil ich gesehen habe, wie viel du schreibst, ich hatte Angst, dass dieses berufliche Schreiben ständig die Inflation des «lebendig für sich wollen»-Schreibens überschwemmt, ich wollte dir das sagen aber wer war ich um dir das einfach zu sagen.
Mir ging es so mit Gedichten, irgendwann wusste ich wie ein anständiges Gedicht zu atmen hat, ich kannte die Bild-Metaphern-Gefühl-Zutaten ganz genau, was ich zu vermeiden suchte, war nicht zu wissen und mich im Wasser immer wieder zu ertränken, weil ich «funktionstüchtig» sein musste. Dadurch musste ich innerlich mich von Gedichten, den dichten verabschieden, vor kurzem sagte mir ein Aussenstehender, ich sei in einem Schneckenhaus gewesen. So ein Schneckenhaus wünsche ich anderen nicht.
Noch etwas geht mir diesbezüglich durch den Kopf, wenn ich im – nennen wir es noch immer «Affekt» bin und etwas liefern muss, dann schweife ich herum, wie die Biene über den Pflanzen … Ich werde dann philosophisch.
Wie wäre richtige Temperatur für das Schreiben in sich zu fühlen?
Einige versuchen es mit dem konkreten Gleicher-Ort-Zeitraum-Rezept. Thomas Mann, der sich im Anzug hinsetzt und bis zwölf Uhr sein Pensum jeden Tag abliefert. Er hat wahrscheinlich nie etwas von der Realität des Unter-anderen-Umständen-Schreibens erfahren; kann man sich Thomas Mann in der Waschküche vorstellen oder ein Programm für Wolle suchen, während ein Kind an seinem Hosenbein zieht?
Mein Atmen fällt mir leichter. Ich zeige dir darum meinen vorher fast gelöschten Brief, der seine Gültigkeit wieder sucht.
Drei Tage früher …
liebe Julia
dein Brief kam in der blauen Abendmeerwinddämmerung, Monet pur Stimmung, mein Bruder rief an, um Mutters Geburtstagsfeier kurz zu kommentieren, sie ist heute 81 Jahre alt geworden, wir waren auf drei Friedhöfen in drei Dörfern, haben Kerzen und Blumen gebracht, immer die gleichen Geschichten gehört, über Todesursachen, Schönheit, Armut, Schicksale der Toten halt.
Dann waren wir zum Essen in einem kleinen, für Touristen renovierten Hof; der Besitzer erinnert sich, 1958 war er in der kleinen Baracke, welche meine Eltern hinter dem Berg gebaut haben, er war zehn Jahre alt, er erinnert sich, welch schöne Stimme mein Onkel gehabt hat. Die Mutter erinnert sich an den Vater der Wirtin, der mit meinem Grossvater, dem Förster, befreundet war. Einmal ist eine Wand in Grossvaters Haus eingestürzt, und meine Tante wäre umgekommen, wäre sie dort gewesen, weil ihr Bett dort war, sein Freund, der Förster, der orthodoxe Jovan, half die Wand wieder aufzubauen.
Und so könnte ich dir einen ganzen Brief füllen, aber es ist nicht das, was ich dir schreiben will, sondern – warum ich so traurig bin, es ist so schlimm, weil ich an die Schauplätze, angeblich identische Orte wie im meinem Buch, gereist bin. Es gab Gräber-Marmorsteine, das Grün der Bäume, den Himmel, Tote, welche längst nicht mehr in den Gräbern sind, es gab die eine oder andere Erinnerung an Grossvater, Onkel, Tanten, aber eigentlich waren die Dörfer absolut menschenleer, ich fühlte mich so schuldig und wusste doch nicht, was der Kern meines Schuldgefühls war.
Ich komme zu spät, ich war meine eigene Expedition, aber diese Expedition fand nicht mal eine Spur der Wirklichkeit aus ihren Landeskarten, alles schon vorbei, gestorben, verfälscht, müsste man über das Jetzt schreiben wie Handke, Jetzt, Marmorgräber, Gross, Grau, Weiss, Rasen sehr schön, Familiennamen vergoldet, dort wo die Häuser wie Ställe auf das Vieh warten. Ich habe in einem von diesen Dörfern neun Monate gelebt, Vater und Mutter bauten dann ein besseres Leben hinter dem Berg, am Meer, ich aber blieb mit der Grossmutter, weil zu früh geboren – und um das Mädchen wäre es nicht schade, wenn es gestorben wäre.
Grossmutter lebte dann mit uns hinter dem Berg und erzählte immer Geschichten aus ihrem Dorf, mir und meinem Bruder, wir sind heute noch eine wandernde Enzyklopädie des ersten und zweiten Weltkriegs im Dorf, also Namen, Orte, Verbrechen, Tratsch, alles dies erzählte unsere Grossmutter den kleinen Kindern in der Nacht, weil unsere Türen offen waren und sie musste laut mit sich reden, sie redete, bis wir sie fragten, wie kommen die Kinder in den Bauch oder wo hinaus, ob man lebt, wenn man tot ist?
Du sendest mir diesen roten Strick mitten durchs Bild, mit welchen man sich tiefer stürzt in die geheimnisvollen Abgründe des «wahren» tiefen «Kreativen». Wie schützt man diesen Eingang beim Abseilen. Mit was? Jetzt verstehe ich mein gestriges Schuldgefühl
dieser äusseren Realität gegenüber. Während ich schrieb und diese inneren Orte zu ordnen versuchte, verging das Leben weiter und strafte mich der Unübersichtlichkeit, Verfälschung der Wirklichkeit zugunsten der geordneten Vergangenheit, welche ich so formen durfte, als ich tief nach unten mich bewegte, wie in der unterirdischen Wirklichkeit meines Dorfes.
Und dann sehe ich deinen Mann, wartend auf die Wäsche, und die Stille, eine Pause welche ihn bedrängt aus Tiefe, Tiefe, es doch zu fühlen, ja, ich musste mich abseilen, ja, es war nicht so, ja es ist meine Geschichte und jemandem Unbekannten gibt diese Geschichte Grund für Hoffnung, obwohl ich sie aus Schrecklichem herausschreiben musste, sie darf sein, trotz meiner Zweifel. Ja, während ich dir das tippe, stand ich gestern vor den Namen wirklicher Personen am Grab, sage zu H., im Buch heisst sie so, das ist ihre Tochter, sie kommt im Buch nicht vor, meine Auswahl, und als gäbe es zweimal Tote, einmal hier unten in der Erde und einmal in meinem Buch, und ich, die ich, um sie hinüberzuretten, mich der Fälschung schuldig gemacht habe, ich kam mir vor wie ein Zauberkünstler welcher seine Figuren versorgen muss weil sie zu flach gezaubert sind und beleidigen das Leben der Toten, ihr einziges wirkliches Leben.
Liebe Julia, ich bin heute noch leer, und vielleicht gehört das alles zum Abschied von dem Buch, zur Rückkehr ins «normale» Leben, auch als Übergang zum neuen Buch, über welches ich nur einen Augenblick als Auslöser von dem Buch weiss, ein NEIN. Und um dieses Nein 1915 dreht sich in mir eine unbekannte Welt, in welche ich muss und von der ich nichts weiss, erst muss ich Material sammeln, die Realität aufsuchen, mich begleiten lassen, um nicht eben in die Tiefe zu fallen, weil ich nicht weiss, was ich überhaupt dort suche.
Ich komme zurück zu den Bildern von der Blutbuche, die du mir gesandt hast, über welche ich dann googeln musste. Stell dir vor, die sogenannte Mutterblutbuche stammt aus dem Possenwald nahe der Stadt Sondershausen in Thüringen, ist 1690 geboren und hatte 11 Schwestern drum herum, die haben sich durch die ganze Welt dann ausgebreitet, erst im neunzehnten Jahrhundert.
Ein Ort hat ihren Namen in der Nähe von Zürich. Buch ma Irchel. Legende sagte:
Ein Brüderpaar, als Habenichtse aus fremden Kriegsdiensten zurückgekehrt, wird durch die hier herrschende grosse Hungersnot an den Rand des Todes getrieben. Eines Tages gelingt es ihnen, einer Maus habhaft zu werden. Da jeder diesen Bissen für sich allein beansprucht, geraten sie in ihrem Streit in ein schlimmes Handgemenge, welches einer der beiden nicht überlebt. Das beim Kampf geflossene Blut färbt die Blätter einer am Tatort stehenden jungen Buche rot, die von da an rot geblieben ist. Sie ist 300 Jahre alt, lebt noch in der Nähe des Ortes, einen Ausflug werde ich machen dorthin.
Ich versuche mir wie ein Maulwurf Räume zu durchbohren zur Zuversicht an diesem Tag.
Gerade meine Tochter sendet mir eine SMS zu den Fotos von Omas Geburtstag, sie sehen, schreibt sie, idyllisch aus – wie war’s?
Und ich fühle wie ich meinen Kindern genau dies nicht geben wollte, Empfindlichkeit und ungeheure Skepsis zu den falschen Tönen um sie herum.
Ich schreibe ihr, „Ja, es war so wie auf den Fotos“ – einen Augenblick lang ist das wahr.
Liebe Grüsse nach Zürich, habt eine gute und schöne Woche und bis bald,
Anfang Juli bin ich dann in Zürich, und alles wird schon hier Vergangenheit sein, die Fotos wahrer und wahrer.
Deine Dragica
In der Beilage zwei Bilder von Miljenko Stančić (dem Maler, der in meinem Buch vorkommt, seine Bilder sind eine Kurzzusammenfassung dessen, worüber ich geschrieben habe). Auch einen Schmetterling für deine Kinder und für euch sende ich mit.

Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 9: Dein Brief berührt mich, weil ich glaube, deine Emotionen herauslesen zu können …
weiter ...Lieber Paolo!
Dein Brief berührt mich, weil ich glaube, deine Emotionen herauslesen zu können, und weil ich das Gefühl habe, dich immer besser zu kennen und zu schätzen – als Person, als Mensch, mit deinen Einstellungen und Erfahrungen, Werten und Träumen, Freuden und Verletzungen. Ich spüre instinktiv deine Wut und deine Enttäuschung, wenn du über das schreckliche und scheinbar sinnlose Leiden deiner Mutter berichtest, und die gefühlte Ohnmacht, den Schrecken und den Zorn, wenn du von den furchtbaren Ereignissen unserer Zeiten erzählst – Ereignisse, die angesichts unserer Vergangenheit schon längst nicht mehr hätten passieren dürfen. Und es tut mir unglaublich leid, dass du den Schmerz deiner Mutter miterleben musstest, dafür gibt es keine Worte. Es tut mir leid, dass immer wieder Dinge passieren, die unmenschlich sind, so grausam und schrecklich und dumm. Mich betreffen all diese Situationen genauso, sie machen mich sehr traurig und wütend und nachdenklich. Außerdem bin ich mir meiner Kleinheit natürlich sehr bewusst, ich weiß, dass ich – selbst wenn ich es wollte – nicht all die großen Probleme unserer Welt lösen kann. Und trotzdem – dieser Hoffnungsfunken, von dem du sprichst, er lodert auch in mir und er ist notwendig, um all die kleinen Schritte zu tun, um zumindest im eigenen Einflussbereich auch nur eine positive Veränderung zu bewirken.
Ich persönlich glaube nicht an einen Gott, der den Menschen verdirbt, sondern ich glaube, dass dies der Mensch ganz alleine schafft. Die Freiheit des Menschen sehe ich in seiner Entscheidungsmöglichkeit, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen und auf bestimmte Art und Weise zu handeln. Vereinfacht ausgedrückt, glaube ich, dass sich der Mensch immer zwischen Gut und Böse entscheiden kann. Und das Böse erscheint uns manchmal vielleicht als einfacher, als kurzfristig gewinnbringender. Außerdem ist es „ja gar nicht so schlimm“, denn „jeder“ handelt schließlich so, also warum sollte genau ich anders handeln und mir damit vermeintlich selbst im Weg stehen? Wir sind alle kleine Geschichtenerzähler und wie du schön beschrieben hast, ist es für uns ein Leichtes, uns eine passende Geschichte zurechtzulegen, um alles Mögliche und Unmögliche zu rechtfertigen. Aber – wir wissen es eigentlich besser, wir spüren es, wenn wir an der Wegkreuzung in die falsche Richtung laufen. Manchmal wird es uns vielleicht erst nach einer Weile bewusst, aber dann umzukehren würde ja bedeuten, sich selbst eingestehen zu müssen, die lange Wegstrecke umsonst gegangen zu sein. All die Blasen an den Füßen, der vergossene Schweiß, die
Menschen, die uns am Wegesrand vielleicht angefeuert haben oder die wir zurückgelassen haben. Wer will da umdrehen? Lieber laufen wir stur weiter, in dieselbe Richtung, auch wenn wir schon längst erkannt haben, dass dort drüben nur der Abgrund auf uns wartet. Und doch – manche von uns haben den Mut, trotzdem umzukehren und das Richtige zu tun. Wie wäre es, wenn wir anstatt der vielen negativen Nachrichten in unseren Medien öfters über solche Vorbilder erzählen würden? Wir könnten es ihnen nachmachen. Es zumindest versuchen, immer wieder. Dabei geht es weniger um das Ziel, den göttlichen Heiligenschein als Prämie zu erobern, noch um irdische Lorbeeren, sondern es geht um die Würde unseres Menschseins.
Was du über die Liebe schreibst, beobachte ich auch mit großem Bedauern, manchmal auch an mir selbst. Ist es nicht jedem von uns schon so ergangen, dass wir angesichts eines verletzenden Erlebnisses unser Herz verschlossen haben? Es ist normal und gut, uns selbst zu schützen. Die Schwierigkeit liegt darin, zu erkennen, wann die Gefahr wieder vorbei ist – manchmal liegt sie auch darin, zu erkennen, von dem die Gefahr eigentlich wirklich ausgeht – und dann besteht die große Herausforderung darin, die eigene Angst zu überwinden und sich wieder der Liebe zu öffnen. Du hast recht, wenn du schreibst, dass viele Menschen dazu nicht in der Lage sind. Vielleicht wollen sie es auch einfach nicht. Und jetzt schreibe ich etwas, womit ich meinen Gedanken im vorigen Absatz scheinbar widerspreche, wenn ich von der Wahl schreibe, die jeder Mensch in jeder Situation hat. Natürlich hat jeder von uns diese Freiheit und damit zugleich die große Verantwortung, über unser Erleben und unser Tun zu entscheiden. Aber um diese Entscheidung treffen zu können, müssen wir zuerst um sie wissen – das heißt, wir müssen erkennen, dass wir überhaupt eine Wahl haben. Damit möchte ich dem Einzelnen nicht die Macht nehmen, immer über sein Leben zu verfügen, sondern uns vielmehr dazu auffordern, dem anderen in einer für ihn scheinbar ausweglosen Situation die Hand zu reichen und ihm wieder neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Denn ich glaube, wir erleben alle manchmal Momente, in denen wir diese unsere Wahl eben nicht erkennen und dementsprechend von unserer Freiheit des Wählens auch nicht Gebrauch machen können. Wie schön wäre es, wenn wir uns, mit unserer gewohnheitsmäßigen Lebensweise und unseren konkreten Hilfestellungen im Moment, vermehrt gegenseitig unterstützen würden, unsere Möglichkeiten zu erweitern und von ihnen Gebrauch zu machen? Ein Vogel, der nicht weiß, dass er Flügel hat, kann nicht fliegen lernen. Aber wenn viele Vögel um ihn herum fliegen, kann er sie imitieren. Um wie viel leichter fliegt er dann los! Und wenn der Vogel durch einen Unfall etwa verletzt wird, muss sein Flügel heilen und danach bedarf es der Unterstützung eines anderen Vögleins, das ihm wieder Mut zuflüstert, es nochmals zu probieren.
Ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die mir geholfen haben, meine Flügel auszubreiten – in Momenten, in denen ich selbst nicht daran glaubte, dazu imstande zu sein. Das ist ein großes Geschenk und ich bin unendlich dankbar dafür. Ich hoffe, auch selbst das Glück zu haben, anderen Menschen diesen Dienst erweisen zu können.
Ich möchte diesen vielleicht persönlichsten meiner Briefe mit einem großen Dank an dich, Paolo, beenden – die Begegnung mit dir hat mich verändert, bereichert. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen auf Herzebene verändert und bereichert uns – vielleicht liegt hierin das Geheimnis unserer Wirkungsmöglichkeit auf dieser Welt verborgen – diese Begegnungen zu erkennen, zu schätzen, bewusst zu gestalten, zu feiern.
Es hat mir große Freude bereitet, dich kennenzulernen und mich mit dir anhand unseres literarischen Briefwechsels auszutauschen. Ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute.
Liebe Grüße,
Barbara
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 4: Danke für den Baum …
weiter ...
Zürich, Rote Fabrik, Juni 2020
Liebe Dragica
Danke für den Baum. Danke für deine Worte, die Kreise gemacht haben in meinem Kopf.
Heute, noch bevor ich deinen Brief las, habe ich etwas in mein Notizbuch geschrieben, nachdem ich mich erinnert hatte daran, wie gut das Schreiben, das ziellose Schreiben ist, wie ich es früher viel mehr, eigentlich jeden Tag machte, am Morgen zum Kaffee, als ich noch keine Auftragstexte und Kolumnen schrieb. Und darin kommt auch das Nicht-Leuchten vor.
„Das rote Seil, das scheinbar das Gerüst der Schiffes, das ein Spielplatzschiff ist, zusammenhält. Es leuchtet im Regen, während alles andere hinter Milchglas liegt, in Farbflecken zerlegte Welt.
Ich vor dem Milchglas und hinter dem Milchglas die Welt. Oder umgekehrt. Diese Unschärfe, die gut tut, in diesem Moment. Ich möchte in eine Tiefe steigen mit meinem Kopf und etwas begreifen, ohne dass es scharf gestellt wird. Dann kommt mitten in dieses Absteigen hinein, ein Gedanke an Fusscreme. Und ich kann sie nicht fernhalten, die Gedanken, nicht aufsuchen, die wichtigen. Fusscreme, dann eben Fusscreme in meinem Kopf.
Und mein Wunsch etwas zu begreifen, was tiefer liegt. Und meine Hoffnung, der Regen, das Milchglas vor der Welt, helfe mir. Und die Kindergartenmusik von unterhalb, der kleine Vogel, der auf der Fensterbank sitzt und mich nicht als Lebewesen erkennt, weil die Milchglaswand uns trennt.
So sitzt er und fürchtet sich nicht und ich sehe ihn als braunen, kleinen Fleck, und weil ich weiss, dass es ein Vöglein ist, sehe ich auch die Federn. Er ist schon lange weg. Pappeln sind schräg im Wind, mein Gesicht fühlt sich nass an, obwohl ich nicht weine, obwohl ich im Trockenen bin. Und wo bin ich? Und warum nochmals stellte ich die Dinge um mich so hin, wie sie nun hingestellt sind.
Im Regen geht ein Mann mit Schirm, er hält ihn so, dass seine Füsse im Trockenen sind, aber weil seine Füsse so lang, fällt der Regen ihm hinten in den Kragen.
Stumm flucht ein Fleck im Regen.“
Liebe Dragica, als ich deinen Brief lesend an die Stelle kam, in der du über das Buch von Heinz schreibst, habe ich ihn angerufen. Ich rief ihn an, weil ich wusste, was du da schreibst, über sein Buch und wie du es formuliert hast, die Hoffnung auf unsere Generation, die wachsen kann, das muss er wissen. Denn ich weiss, was ihm die Fragen bedeuten, was ihn umtreibt und wie er kämpfte mit dem Material, mit dieser Geschichte, in dem auch ein Bruder steht, den es gab und eine Welt, die es gibt. Und als ich ihm am Telefon deinen Satz vorlas, verstummte er. Und ich fragte, ob das Tränen sind. Und er nickte wohl, aber das nützte nichts. Aber ich wusste es, an der Art des Schweigens und das Schlucken. Und hinten krächzte Romy vor sich hin, weil ihr der Hals in München entzündete. Und dann kamen die Worte wieder und er sagte, er stehe in der Waschküche und Romy sitze neben ihm in der Wippe und es passe gerade alles zusammen, er sei zu früh in die Waschküche gekommen, die Waschmaschine wasche noch fünf Minuten und nun würde er aus dem Fenster schauen und weil der Raum im Keller sei, er somit von unten nach oben in den Regen schaue, könne er das Aufprallen des Regens auf den Boden von unten sehen. Das passe sehr gut in die Situation.
Liebe Dragica, entschuldige, dass der Brief viel später kommt. Ich hatte eine Pause gemacht und jetzt liegen viel Zeit und Himbeeren und eine Reise nach Biel und Bewegung und Gedanken zwischen deinen, an mich gerichteten, und meinen Worten an dich zurück. Wieder sitze ich im Atelier und sehe den See, kein Regen, helles, scharfes Licht und die Bäume ziemlich gerade, ohne Bücken im Wind. Zwei Menschen, die sich umarmen, ihre Kleidung hat die Farbe des Sees und seine die Farbe vom Kies. So verschwinden sie in der Umgebung. Heute bin ich ganz funktional, kann in den Wolken nur Wolken sehen.
Darum suche ich keine Bilder mehr, gehe und küsse die kleine Romy hinter dem Ohr.
Hoffe deine Leere nach Abgabe des Manuskripts hat sich wieder gefüllt.
Freue mich von dir zu lesen.
Deine Julia
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten: Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 8: Der Juni geht allmählich zu Ende …
weiter ...Weiler, Samstag, den 20.6.2020
Lieber Hajqu,
der Juni geht allmählich zu Ende. Die Bäume stehen im großen Grün. Es ist kühl und feucht, ob noch der Sommer kommt? Dieser Klang des Regens, der schäumende Bach trägt viel Wasser. Am Ende der Hausbachschlucht drehte man, wie man mir erzählte, in den 50ern, „Hans im Glück“. Das alte Märchenbuch liegt seit langer Zeit aufgeschlagen da, als wolle es mir diese Geschichte immer wieder von neuem erzählen.
Auf dem Markt gibt es den letzten Spargel, die letzten geernteten Erdbeeren.
Wir können wieder über die Grenzen reisen ohne Bewilligung, über der Grenze brauchen wir keine Masken mehr. Wir können Besuch empfangen. Die Schule beginnt.
Es sind sehr einfache Dinge der Wahrnehmung. Doch was ist Leben? Die Glocken läuten. Ich denke über das Wort Schellen nach, zerschellen, schellen, läuten. Was bewirkt das Läuten der Glocke? Es gibt dazu eine Geschichte vom Gespräch zwischen Himmel und Erde.
Der Kernbeißer sitzt seit einigen Tagen immer wieder an meinem Fenster und schaut neugierig in mein Zimmer. Sein Blick erinnert mich an das kurze Flötenstück in a-moll von Hans Keuning, an die ersten Sprechversuche, eine Volksweise aufnehmend, an Vogelgezwitscher: da, da, a b b a,
ich bin da, du bist da …
bei Y. Bonnefoy heißt es einmal über Poesie treffend: „Das Gestrüpp entfernen vom dem oder jenem Wort, zu dem man, zufällig, einen Zugang gefunden hat: wie man das Wasser erklingen hört unter dem Schutt und den hohen Kräutern, man kehrt dann zurück dorthin, und legt eine Quelle frei.“
Dafür doch existiert das, das man Kunst nennt?
Sie beschrieben sie als große, not-wendige Möglichkeitsform und Verwandlerin, als leise trotzende Kraft. Ich meine aber, sie kann auch das Gegenteil davon sein, zerstörerisch und entwürdigend.
Raoul Eisele, ein junger Dichter, schrieb so berührend an uns beide zu unserem Briefwechsel, zur Flaschenpost, wie Sie ihn nennen,
dass es nicht die Worte allein waren, sondern auch
die geteilte Einsamkeit von Inspiration und Mitgefühl begleitet.
In seinem Text an uns lese ich
alle sieben Sekunden hörte ich das Mondlicht, hörte es über schwarzes Glas spazieren…
das kurze eifrige Schlagen der Flügel
wo man wie leise einem Vogel die Hand hinhielt, mit den wenigen Körnern vom Boden,
ausgelotet, schweigendurchbrochen, die geliehene Landschaft
wie aus Wolken gehimmelt, aus heiterem Himmel
schneeweiße Pollen… und erst mit deinem Niesen, die Stille, dein Niesen das Schweigen durchbrach und ich dir sagen konnte: pass auf dich auf.
In diesen alltäglich nichtalltäglichen Tagen finden wir neue Formen des Zusammenseins, des Gesprächs.
Heute fand ich in der ZEIT die Todesanzeige von Alfred Kolleritsch mit seinem Gedicht:
„Es spricht mit uns,
dunkel und licht zugleich
Unvergängliches ohne Dauer.“ Alfred Kolleritsch (16.2.1931-29.5.2020)
„Anrufungen, worin der Angerufene außer Reichweite ist, worin er, selbst wenn er beschimpft wird, respektiert ist, selbst wenn er aufgefordert wird zu schweigen, in die Präsenz des Sprechens gerufen und nicht auf das reduziert ist …weil ich ihn, den Unbekannten bitte, sich mir zuzuwenden und als Fremder mich zu hören …
dass es sich nicht um irgendeine Sprache handelt, sondern allein um jenes Sprechen, worin ich in ein Verhältnis zum Anderen eintrete.“ M. Blanchot, Das Unzerstörbare Auch in einer „Flaschenpost“.
Es sind viele Dinge, die mich zurzeit berühren, anrühren, zum einen vermeide ich die Informationsflut, meide ich die Medien und doch kommen mir Nachrichten ins Haus, wie “die Lunge ist das neue Herz“, die Frage nach dem Sinn einer Corona App, weitere Öffnungen und Verhaltensweisen, es kann wieder geprobt werden in den Orchestern, neue Infektionsfälle.
Meine Tage und Nächte sind ausgefüllt mit Verrichtungen, Telefonaten und Mails.
Ich sehe ein Foto in einer Zeitschrift, das mich aufhorchen lässt: die blauleuchtenden Chorfenster der Heilig-Kreuz-Kirche in München-Giesing, lese, dass dort 12 000 Glasscheiben eingesetzt wurden, die aus Röntgen-Lungenaufnahmen entstanden sind, überwiegend von Gesunden, zum Teil von Kranken. Auch Teile des Rückgrats und der Schulter sind zu erkennen, wie zu einem Kreuz geformt. Ich erinnere mich des Besuchs vor Jahren auf der „Schatzalp“ in Davos, Thomas Manns Zauberberg. Aus dem Röntgenraum wurde eine Bar, die Originalliegen für die Lungenkranken gibt es noch. Mit Schlitten wurden die Toten den Berg hinuntergebracht. Ich erinnere mich noch an jenes besondere Ereignis, inmitten des Juni fiel Schnee über Nacht auf die blühenden Lupinen und Bergwiesen, wie eine stille Verheißung.
Ich lese Pressenotizen zu Christos Tod. Ich begreife plötzlich, was „Augenöffner“ sind, dass etwas Bedeutung hat, was über das Augenscheinliche hinaus geht, hinaus reicht, dass etwas hinter der Wirklichkeit ist, was wir mit anderen Augen sehen lernen müssen.
Steckt dies nicht auch hinter jenem alten Spiel des Verhüllens, das Gespür für das Geheimnis, etwas Verheißungsvolles könnte auf uns warten, wartet auf uns?
Erfahren wir da ein existenzielles Berührtsein und zugleich jenen Anruf: „Du musst dein Leben ändern?“ (Rilke) Lernen wir, hinter den Vorhang zu schauen?
Da treffen mich Wortfetzen im zufälligen Gespräch mit Freunden: „Bachmannpreis 2020, Klagenfurt, Helga Schubert, „Vom Aufstehen“, Eine Geschichte über das Leben und Sterben der Mutter.
Vor einigen Jahren war ich Zuhörerin, es waren heiße Junitage, Kühlung und Gelassenheit suchten wir im Wörthersee und in Mahlers Komponierhäusel. Noch immer spüre ich eine leichte Verstimmung, Klagenfurt damals in festliche Stimmung getaucht, dann jener eiskalte Seziersaal, draußen die Hitze, drinnen die Honoratoren, Vertreter der Öffentlichkeit und die Sezierkunst in allen menschlichen Facetten und heiteres, geselliges Beisammensein draußen. Und nun 2020 Bachmannpreis online.
Plötzlich werde ich wach, sehe das kurze Selbstporträt von
Helga Schubert, stutze, der Sprachduktus, ich denke an Christa Wolf, an Sarah Kirsch, den KinderBuchVerlag. Da ist die Spur.
Unaufgeregt, ganz bei sich und authentisch spricht Helga Schubert in ihrem Garten und in dem bleibt sie auch zu Corona-Zeiten. Ich wünsche unwillkürlich Helga Schubert den Bachmannpreis 2020. „Es könnten doch ihre Enkel und Kinder sein, die da mit dabei sind beim Wettlesen am Wörthersee“, sagt sie. Eine eigentümliche Wärme überkommt mich, als ich sie in ihrem Kurzfilm zur Pferdeweide gehen sehe, weit weg von Klagenfurt, die Kritiker in ihren Häusern und sie an einem Tisch auf der Wiese sitzend, ihren Text vortragend.
„Vom Aufstehen“ heißt ihr Text, ja, „Vom Aufstehen“. Ich finde, was ich suche, den Katalog vom KinderBuchVerlag Berlin 1993, da stehen wir beide, sie auf Seite 15“ in der ABC Reihe mit „Bimmi vom hohen Haus“, ich auf Seite 14 mit „Ich bin ich und wer bist du?“.
Da ist der Duft des Rosenöls, die Lektüre von Sartre, die drei Dinge ihrer Mutter, die sie leben lassen, „Salomonis Seide“, Paul Gerhardt, unser gemeinsames Kinderabendgebet, das Kinderlied, das ABC des Erinnerns, sie dort, ich hier.
„Alles auf der Welt existiert, um in ein Buch zu münden“, sagt Mallarmè, in jenes Buch des Lebens.
Ich ertappe mich dabei, dass ich in diesem Monat noch das lang angelegte Wörterbuch, das Buchstabieren meiner Stadt, mit ihren Düften, Ängsten und Erinnerungen beenden wollte
und finde das Gedicht der verstorbenen Dichterfreundin Viola Fischerovà als Vorspruch:
Ist das
noch ein leerer Friedhof?
Oder ein Apfelgarten
von einer Mauer umgeben
Ein Friedhof im Herbst
mit Reihen von Apfelbäumen
Und die Früchte auf den Ästen
haben sie für die Vögel gelassen?
Viola Fischerovà
Was der Wörthersee doch alles zu bewirken vermag. Ich drück Helga Schubert die Daumen. Heute ist ja noch Samstag. Ich werde schon noch auf irgendeine Weise erfahren, ob sie ihn bekommen hat, den Bachmannpreis 2020. Ich freue mich,
Helga Schubert wieder begegnet zu sein und das in diesen Tagen.
Herzlich grüß‘ ich Sie,
Antonie
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 8: In unserer kleinen Welt hast du recht, Träume sind Geschichten …
weiter ...Liebe Barbara!
In unserer kleinen Welt hast du recht, Träume sind Geschichten, die wir uns im Schlaf erzählen. Doch es können kleine Geschichten von großem Wert sein. Ich glaube, mehr denn je wieder aktuell wird der Traum eines großen Mannes, der den Anstoß zu einer Revolution ohne Waffen gegeben hat, um die Welt zu verändern, oder zumindest eine bestimmte Welt. Eine falsche Welt.
„Ich habe einen Traum” … mit diesen Worten begann Martin Luther King seine berühmte Rede beim Marsch für die Bürgerrechte im Jahr 1963 … Ein Traum, der vielleicht vor allem eine Hoffnung war … Aber vielleicht war jener Anstoß nicht stark genug, es sind fast sechzig Jahre vergangen, doch was ich in den letzten Wochen in den Fernsehnachrichten gesehen habe, sagt mir, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.
Wie ist denn das möglich? Es gab eine Zeit, da glaubten wir (meine Generation und die vorhergehende), die Zeiten hätten sich tatsächlich geändert. Aber offensichtlich haben wir uns auf den Lorbeeren ausgeruht. Zu lange. Und das Böse hat das ausgenutzt, um wieder seine stacheligen Wurzeln zu treiben.
Wir sind in einer bequemen Welt aufgewachsen, wir haben das Aufkommen unglaublicher Technologien erlebt, sowohl auf dem Gebiet des Wohlbefindens als auch, leider, auf jenem der Zerstörungswaffen. Ich frage mich oft, was ich tun könnte, um die Welt zu verbessern, die richtigen Antworten aber ignoriere ich lieber, weil ich mir bewusst bin, dass ich meinen Lebensstil ändern, auf Dinge verzichten müsste, die mir lieb sind. Also finde ich Gefälligkeitsantworten, versuche die Welt aus der Ferne zu betrachten, als ob ich auf einem anderen Planeten lebte. Ein Planet, dicht bevölkert von einem Haufen weiterer Leute wie mich, die in einem gewissen Sinn klarsehen, sich aber eine andere Geschichte zu erzählen versuchen. Und das fällt mir, der ich ein leidenschaftlicher Erzähler bin, sehr leicht.
Ich spreche für mich, doch ich habe den Verdacht, dass dieser Diskurs für einen guten Teil der menschlichen Wesen gilt. Jene menschlichen Wesen, Barbara, zu denen du dir in deinem Brief eine Menge Fragen gestellt hast. Ausgehend von der alten Vorstellung des „Homo homini lupus“, die du selbst erwähnt hast: sind wir wirklich solche Bestien? Einige sind es sicher. Ohne die Bestien beleidigen zu wollen, denn nicht alle sind böse Bestien. Wir Menschen sollten uns in diesem Punkt hervorheben, man hat uns ständig die Geschichte vom Flämmchen erzählt, das in uns brennt und das uns von den anderen Tieren unterscheidet. Denn Tiere sind im Grunde auch wir, per definitionem. Das Flämmchen aber sollte uns unterscheiden. Die Seele, oder was immer es auch sein mag. Der Wolf ist ein Wolf, das ist seine Natur, doch wir? Für gewisse Situationen mag der Überlebensinstinkt gelten, gewiss, doch in bestimmten Situationen gibt es keine Entschuldigung: ich denke an die von den verschiedenen Mafiaorganisationen geschaffenen menschlichen Bestien, aber natürlich auch an den Wahnsinn, zu dem Kriege, Gewaltherrschaften und Diktaturen führen.
Wie du siehst, Barbara, bist du nicht die Einzige mit so vielen Fragen ohne Antworten. Doch die Vorstellung von so etwas wie einem Urgefühl namens Liebe, das uns alle verbindet, macht dann tatsächlich den Unterschied aus, auch wenn nicht gesagt ist, dass alle dazu fähig sind… Wie du inzwischen verstanden haben wirst, ist die Musik für mich eine ständige Bezugsquelle, und da gibt es einen schönen Song der Talking Heads mit dem Titel People Like Us, in dem diese Vorstellungen trefflich zum Ausdruck gebracht werden: „… wir brauchen keine Freiheit / wir brauchen keine Gerechtigkeit / wir brauchen nur jemand, den wir lieben”.
Jemand, den wir lieben. Das klingt so einfach, doch wenn ich mich genau umsehe, wird mir bewusst, dass es eine Menge Leute gibt, die nicht wissen, wo die Liebe zu Hause ist. Leute, die völlig liebesunfähig sind und Leute, die Angst vor der Liebe haben. Liebe in weiterem Sinn, aber auch die zu einer bestimmten Person. Ich könnte mutmaßen, dass es sich um eine Fehlentwicklung der gegenwärtigen Gesellschaft handelt, doch wenn ich denke, in wie vielen Kulturen, auch in den westlichen, die Liebe seit jeher malträtiert und an den Pranger gestellt wurde, als ob sie ein Dämon sei, den es abzuwehren gilt. Dann kehre ich zur Ausgangsvorstellung zurück, nämlich dass es im Menschen etwas gibt, das falsch ist, und dass dieses Etwas auf die Religionen gründet, auf jene, die zu Eheschließungen ohne Liebe zwingen, aber auch auf jene, die in der Liebe etwas Sündhaftes sehen, das man meiden muss, worüber man nicht sprechen darf. Und doch lobpreisen eben diese Religionen, an erster Stelle die christliche, mitleidsvolle, barmherzige und gute Gottheiten, die angeblich ihre Geschöpfe lieben, dann aber nicht zögern, sie mit einer Erbarmungslosigkeit zu bestrafen, die der grausamsten menschlichen Bestien würdig ist, die uns die Geschichte der Menschheit und Unmenschheit überliefert hat.
Ich denke, meine Mutter war die liebste Person, die ich kannte, gläubig, aber nicht bigott, respektvoll, bescheiden, intelligent. Und doch habe ich sie stumm sterben sehen, unter unerträglichen Qualen, ohne zu klagen. Und ich gestehe dir, dass ich nicht akzeptieren kann, dass ein Gott wie der ihre, den sie sich auch als den meinen gewünscht hätte, solche Qualen für jemand vorsehen konnte, der, so wie meine Mutter, stets an ihn geglaubt hatte.
Ich möchte mich mit einem letzten Gedanken zum Traum von Martin Luther King verabschieden, mit dem ich diesen Brief begonnen habe, der meiner Kontrolle entgleitet, Barbara: einerseits werde ich immer ratloser, wenn ich sehen, wie sich die Fälle von Gewalt und Intoleranz häufen, andererseits freut sich der optimistische Teil von mir – der stärkere –, wenn ich sehe, wie die Leute, vor allem die jungen, auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, mitzureden, zu zeigen und zu sagen, dass es sie gibt, dass sie gehört werden wollen.
Und was dieses Auf-die-Straße-Gehen noch größer und wichtiger macht, ist die Tatsache, dass sie es an schulfreien Samstagen getan haben; dass man für eine Sache auf die Straße geht, die einem wirklich am Herzen liegt, und nicht nur, um sich einen freien Tag zu machen, hat mich froh gestimmt.
Und es gibt ein unbändiges Bedürfnis nach Dingen, die einen froh stimmen, findest du nicht, Barbara?
Das ist wirklich alles für heute, aloha und bis bald
Paolo
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 10: Briefe schreiben und bekommen, ist in der Tat eine Herrlichkeit …
weiter ...Lieber Christian,
Briefe schreiben und bekommen, ist in der Tat eine Herrlichkeit (um mit deinem geliebten Hrabal zu sprechen), ich habe deinen letzten Brief ganz besonders genossen. Hab Dank! In meiner Erinnerung bleibst du (who is Goethe?) als der größte Briefeschreiber aller Zeiten und Völker. Und ja, lass uns auf einen Kaffee treffen, am besten in der Gösser Bierinsel und am besten im Winter, denn im Sommer verstecken sich dort lauter Nüchterns hinter ihren Zeitungen im Schanigarten, und es wimmelt auch vor Touristen, die, von langem Fußmarsch und Hitze gerädert, vor sich hin starren, während der Riesenschnauzer der alten Wienerin am Nebentisch gerade dabei ist, in einer abgestreiften Birkenstocksandale ein Präsent abzulegen. Die kalte Jahreszeit ist die Zeit, in der ein leidenschaftliches, verhängnisvolles Licht im Inneren der Bierinsel brennt und nur wenige krumme Gestalten an den Tischen sitzen, in ihr derbes Schweigen vertieft. Lass uns dort treffen, wenn die Saatkrähen über dem entblätterten Prater kreisen. Wir werden durchs Fenster den vorbeifahrenden Fiakern zuschauen. Vielleicht verrate ich dir, wie meine Haflinger mit vollem Namen heißen. Ich kann dir jetzt schon ans Herz legen, keine Scheu zu haben und in die Zügel zu greifen, sollte dir einmal ein durchgehendes Pferd begegnen. Auch wenn das Tier mit 20 Sachen durch die Praterhauptallee rast, total aufgebracht und super gefährlich ausschaut, wartet es in Wirklichkeit sehnlichst darauf, von einem Menschen gestoppt und gerettet zu werden. Es hofft, dass sich jemand traut, jemand der (ganz wichtig) keinen Sekundenbruchteil zweifelt. Stell dir vor, du bist drei Jahre alt und hast deine Mama bei der Mai-Demo verloren. Du hast einen Heulkrampf, die ganze Welt bricht zusammen. Wärst du da nicht erleichtert, wenn eine freundliche Tante mit weichem Busen und Glitzerohrringen dich auf den Arm nehmen und nach deinem Namen fragen würde? Also. Wenn du einem trabenden oder galoppierenden Pferd seitlich von vorne in die Zügel greifst, hast du es schon in der Hand. Außer dass es dich einige Kilometer weit mitschleift, kann dir wirklich nichts passieren.
Zu deiner Frage: Nein, ich rauche nicht. In meinem früheren Leben hat es aber eine kurze Phase gegeben, in der ich mich gelegentlich aus Mangel an Selbstbewusstsein an einem Damenzigarillo festgehalten habe. Geschmeckt hat es mir nicht, und besser, schöner, klüger habe ich mich auch nicht gefühlt. Ach, es ist mühsam, erwachsen zu werden. Man tappt ein halbes Leben lang auf dunklen Fluren, und wenn man den Lichtschalter gefunden hat… (bitte ergänzen). Da du scheinbar ein Freund von Zitaten bist, möchte ich jetzt, weil ich es passend finde, etwas aus meinem Repertoire loswerden: Wenn die Jugend wüsste, und das Alter könnte. Ein Kickoff-Spruch mit großer Wirkung, der bei mir früher oft im Einsatz war, wenn ich (meist nach meinen Lesungen) gefragt wurde: „Kennen Sie die berühmte Stelle aus X?“ Oder „Haben Sie das Buch Soundso von Schießmichtot gelesen?“ Warum so viele Menschen davon ausgehen, dass ein Literat oder eine Literatin belesen bzw. informiert sein oder eine Meinung zu allen Manifestationen des Zeitgeistes haben soll, ist mir ein Rätsel. Genauso schleierhaft ist es für mich, wieso die meisten darauf Wert legen, ausschließlich gute Literatur zu lesen. „Gute Literatur“ hat mir menschlich nichts gegeben außer einer Prise Feenstaub. Im schlimmsten Fall wollte sie mich erziehen. Wirklich interessant finde ich gerade schlechte Literatur, denn sie lässt mich etwas über den Menschen lernen, über die Zeit, in der er lebt oder gelebt hat. Du hast mich gefragt, wie ich mit Verrissen umgehe, fällt mir gerade ein. Nun, ich googele den Namen des Kritikers und studiere sein verkrampftes Gesicht. Nein, im Ernst. Es wäre unerträglich langweilig und höchst alarmierend für mich, wenn meine Literatur jedem gefallen würde. Übrigens, vom Zwang, jedem gefallen zu wollen, kann man sich befreien, wenn man angefangen hat, sich selbst zu lieben.
Lieber Christian, ich freue mich auf unsere Begegnung in natura.
Bis dahin nur das Beste
Marjana
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Quarta lettera / Lettera 8: Nel nostro piccolo, hai ragione, i sogni sono storie …
weiter ...Cara Barbara!
Nel nostro piccolo, hai ragione, i sogni sono storie che ci raccontiamo nel sonno. Però possono essere piccole storie dai grandi valori. Credo che mai come in questo periodo stia tornando argomento di attualità il sogno di un grande uomo che ha dato il calcio d’avvio ad una rivoluzione senza armi per cambiare il mondo, o almeno un certo tipo di mondo. Un mondo sbagliato.
“Ho un sogno”… così Martin Luther King aveva iniziato il suo famoso discorso alla marcia per i diritti civili nel 1963… Un sogno che era forse soprattutto una speranza… Forse quel calcio d’inizio non è stato però abbastanza forte, sono passati quasi sessant’anni, ma quello che vedo in televisione quando guardo un telegiornale nelle ultime settimane mi suggerisce che la strada da fare è ancora tanta.
Ma come è possibile? C’è stato un momento in cui abbiamo creduto (la mia generazione e quella precedente) che i tempi fossero davvero cambiati. Ma evidentemente abbiamo dormito sugli allori. Troppo. E il male ne ha approfittato per rimettere le sue spinose radici.
Siamo cresciuti in un mondo comodo, abbiamo assistito all’avvento di tecnologie incredibili, sia nel campo del benessere che, purtroppo, in quello delle armi di distruzione. Me lo chiedo spesso cosa potrei fare per cambiare il mondo in meglio, però le risposte giuste preferisco ignorarle perché sono consapevole che dovrei cambiare stile di vita, rinunciare alle cose che mi piacciono. Allora trovo delle risposte di comodo, cerco di guardare il mondo da lontano, come se vivessi su un altro pianeta. Un pianeta affollato da un sacco di altre persone come me, che in un certo senso sono consapevoli ma cercano di raccontarsi una storia diversa. E a me che sono uno a cui raccontare piace, questo risulta molto facile.
Parlo per me, ma ho il sospetto che il discorso valga per buona parte degli esseri umani. Quegli esseri umani, Barbara, riguardo ai quali nella tua lettera ti ponevi un sacco di domande. A partire dal vecchio concetto dell’ “Homo homini lupus” che menzionavi tu stessa: siamo davvero così bestie? Qualcuno lo è di certo. Con buona pace delle bestie, che tutte bestie cattive non sono. Noi umani dovremmo elevarci in questo, ci hanno sempre raccontato la storia della fiammella che ci brucia dentro e che fa la differenza rispetto agli altri animali. Perché animali in fondo siamo anche noi, per definizione. Ma la fiammella dovrebbe distinguerci. L’anima, o qualunque altra cosa essa sia. Il lupo è lupo, è la sua natura, ma noi? Per certe situazioni può valere l’istinto di sopravvivenza, certo, ma in determinate situazioni non ci sono scuse: penso alle belve umane forgiate dalle varie mafie ma anche, naturalmente, alle follie a cui conducono guerre, tirannie e dittature.
Come vedi, Barbara, non sei l’unica ad avere tante domande senza risposte. Ma il concetto del qualcosa di ancestrale chiamato amore, che ci mette tutti in connessione è poi quello che veramente fa la differenza, anche se non è poi così scontato che tutti ne siano capaci… Come ormai avrai capito la musica per me è sempre una fonte di riferimenti e c’è proprio una bella canzone dei Talking Heads che si intitola People Like Us in cui questi concetti sono espressi alla grande: “…non abbiamo bisogno di libertà / non abbiamo bisogno di giustizia / abbiamo solo bisogno di qualcuno da amare”.
Qualcuno da amare. Sembra così semplice, ma se mi guardo bene attorno mi rendo conto che in giro c’è tanta gente che l’amore non sa dove stia di casa. Gente del tutto incapace di amare, e gente che di amare ha paura. L’amore in senso lato, ma anche quello per una persona specifica. Potrei azzardare che si tratta di un frutto malriuscito della società contemporanea, ma se penso in quante culture, anche quelle occidentali, l’amore sia stato bistrattato e messo alla berlina da sempre, quasi fosse un demone da tener lontano. Allora torno all’idea di partenza, cioè quella che nell’essere umano ci sia qualcosa di sbagliato, e quel qualcosa ha le sue fondamenta nelle religioni, quelle che impongono matrimoni senza amore, ma anche quelle che nell’amore vedono qualcosa di peccaminoso da cui bisogna fuggire, di cui non si deve parlare. Eppure quelle stesse religioni, quella cristiana in primis, inneggiano a divinità compassionevoli, misericordiose e buone, che ci dicono amino le loro creature, ma sono pronte a castigarle con una cattiveria degna delle più feroci belve umane che la storia della (dis)umanità ci ha tramandato.
Penso che mia mamma sia stata la persona più buona che io abbia conosciuto, credente ma non bigotta, rispettosa, umile, intelligente. Eppure l’ho vista morire in silenzio, patendo sofferenze insopportabili, senza lamentarsi. E ti confesso che io non riesco ad accettare che un dio come il suo, come quello che avrebbe voluto fosse anche il mio possa aver sottoposto a tali sofferenze chi gli sempre creduto in lui come ha fatto mia mamma.
Vorrei salutarti con un ultimo pensiero riguardo al sogno di Martin Luther King con cui avevo iniziato questa lettera di cui sto perdendo il controllo, Barbara: da un lato sono sempre più perplesso nel veder moltiplicarsi i fenomeni di violenza e intolleranza, dall’altro la mia parte ottimista predominante gioisce nel vedere scendere in piazza la gente, soprattutto i giovani per manifestare, dire la loro, far vedere e sentire che ci sono, che vogliono farsi ascoltare.
E quello che fa ancor più grande e importante questo scendere in piazza è il fatto che lo abbiano fatto di sabato, con le scuole chiuse; il fatto di scendere in piazza per una causa davvero sentita e non soltanto per prendersi un giorno di vacanza, questo mi ha allargato il cuore.
E c’è un bisogno spropositato di cose che allarghino il cuore, non trovi Barbara?
È tutto davvero, per oggi, aloha e a presto
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 3: Gestern haben wir ein Motiv zum Fotografieren gesucht, für ein Foto für dich …
weiter ...
Rogoznica 16.06.2020
Liebe Julia
Gestern haben wir ein Motiv zum Fotografieren gesucht, für ein Foto für dich, klar war, dass es Blumen werden, aber es sei eine Stunde zu spät, sagte H., und es wird nicht so leuchten, wie es leuchten sollte in der ganzen Schönheit.
Das erinnerte mich an ein Gedicht aus der Schulzeit –
Gle malu voćku poslije kiše von Dobriša Cesarić, welches, glaube ich, jeder Mensch in diesem Land auswendig kann, falls der Dichter Dobriša Cesarić (1902-1980) noch im Curriculum des Literaturunterrichts geblieben ist. Nach 1991 war Stunde O in Kroatien, und alles musste neu zusammengeschneidert werden, so auch die Schullektüre, und nicht nur die Geschichte wurde gesäubert von der Vergangenheit, aber dies passiert hier wie normal, immer etwa nach 50 Jahren beginnt die Geschichte von vorne, im Schatten der Kriege kommen frische Hemden mit.
Gle malu voćku poslije kiše:
Puna je kapi pa ih njiše.
I bliješti suncem obasjana,
Čudesna raskoš njenih grana.
Al nek se sunce malko skrije,
Nestane sve te čarolije.
Ona je opet kao prvo,
Obično, jadno, malo drvo.
Ich übersetze es schnell für dich:
Schau den kleinen Obstbaum nach dem Regen:
Er ist voller Tropfen, die er schaukelt,
und strahlt, mit Sonne bestrahlt
die zauberhafte Pracht seiner Äste.
Aber kaum versteckt sich die Sonne ein wenig
verschwindet diese ganze Verzauberung.
Der kleine Obstbaum ist wie am Anfang
ein gewöhnlicher, armer, kleiner Obstbaum.
Und während ich übersetze, weiß ich, wieso ich fast nie aus dem Kroatischen übersetze,
Voćka ist der Obstbaum, aber weiblich gedacht,
und das ganze Gedicht auf Kroatisch, auch mit Voćka zeigt es
ihre Zerbrechlickeit … mala voćka … also es wird den Wörtern Gewalt angetan.
Das Gedicht lässt mich immer Mitleid empfinden mit mala voćka, denn man weiß, dass es die Sonne ist, welche den Zauber verursacht.
Dein Balkon im Schatten, aber jetzt gemalt, damit wieder die Sonne Farbe zeigt. Ich habe dieses Gedicht immer wieder im Kopf, wenn es einen Abschied gibt, wenn die Festtage zu Ende sind, dieses Umkippen aus dem Glück in sein Ende ertrage ich schon am Anfang des Glücks fast nicht, ich sterbe schon in der Vorfreude mit Blick auf sein Ende.
Ich sehe dich auf dem traurigen Balkon. Das Glück der Stille, Silence, Ruhe, der Unbetriebsamkeit nach der Abfahrt der Kinder ins Lager, damals räumte ich auf, trotz Verbots auch ihr Zimmer, dann auf dem Balkon: Rauchen, Musik hören, Briefe schreiben, damals schrieb man wirkliche Briefe an Freundinnen, dann Lesen, dann Tee trinken, dann durch die leere Wohnung gehen. Stimmlos, verstummt, nur Gegenstände, welche unbeweglich waren, an ihrem Platz, dann leere Töpfe und keine Telefonanrufe, am Abend kein «Geht schlafen, aber jetzt».
Hörte ich irgendwo draußen Mama rufen, zuckte ich zusammen, ich war nicht gemeint. Und von da an sehnte ich mich so sehr nach all dem, was mich Tage vorher unsäglich aus den Nerven geworfen hat. Ich habe diese Zeit damals nur meinen Brieffreundinnen Erica Engeler und Christine Fischer geschildert, weil wir im gleichen Alter waren und alle Kinder hatten und uns in derselben Haut befanden, ich arbeitete immer hundert Prozent neben drei Kindern und ab und zu hatte ich drei Jobs gleichzeitig (nur dass du weißt, woher meine berechtigten Schuldgefühle kommen). Du hast dieses «Selber-Kind-Sein nicht verlernen» erwähnt, die Wahrheit des Schreibens, beides unentbehrliche Werkzeuge aus der Sicht der Welt für die Literatur.
Wie zerbrechlich ist die Gewissheit der großen Wahrheit, wenn mir schon die kleine unter den Fingern zerrinnt, und das Sonnenlicht, welches sie bestrahlt, sich plötzlich verdunkelt. Es kommt auf die Perspektive an, auf die Einstellung der Kamera im Herzen und im Kopf.
Jetzt denke ich, ich hab schon die zweite Seite angefangen, ohne den Rassismus zu erwähnen, ich habe deine Kolumne gelesen und deine Vorsicht verstanden, nicht noch mehr zu zerstören durch nur reden ohne tätig zu sein.
Was ich es zum Schreien finde, ist das: Wie bei MeToo, man wird in einer intimen Weise mit Aussagen der Betroffenen konfrontiert, ach, ja, schau da ist das Holocaust-Opfer, da ist das Vergewaltigungsopfer, da ist der diskriminierte dunkelhäutige Mensch.
Es sollte doch im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein, dass es eigentlich eben nicht gut sei, Menschen zu verbrennen, sie zu vergewaltigen und als Sklaven zu behandeln.
Das passiert in denselben zivilisierten Ländern, welche mit ihrer Politik und Wirtschaft noch immer in jeder Ecke Ressourcen ausbeuten, Ressourcen der Dritten Welt, Schwarz-Geld in den Banken horten, Waffen exportieren, ihre Frauen miserabel bezahlen, ihren Migranten keine politischen Bürgerrechte gewehren-gewähren.
Zur Schwarzenbach-Initiative sagt man, die Mehrheit der Schweizer Männer habe sie knapp abgelehnt; aber seit das Frauenstimmrecht herrscht, hat sich die Ausländerpolitik in der Schweiz nicht besonders geändert, ein Viertel der Einwohner zahlt Steuern und hat nichts politisch zu sagen. Oder wie Max Frisch sagte, es kamen Menschen, aber das wurde gern übersehen.
Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, etwas zu benennen so wie es schon lange da ist, damit man sich eine gewisse begrenzte Zeit schämen soll dies miterlebt zu haben aber untätig geblieben zu sein, und jetzt geht es aufwärts, aus Einzelfällen politische Handlungen abzuleiten, erst auf der Straße, dann in Gesetzen, dann und immer wieder in allen Köpfen.
Ich muss dir sagen, ohne mich bei dir einschmeicheln zu wollen, im Buch von deinem Mann, in den nächtlichen Spaziergängen und Dialogen seiner Figuren durch Münchens Kneipen habe ich das erste Mal seit langem dringliche Fragen so behandelt gefühlt, dass mir die Hoffnung auf eure Generation wieder gewachsen ist.
«Ich bin ja privilegiert», sagen in letzter Zeit viele von uns, und nach diesem Satz kommt ein ABER, und nach ABER eine solche Selbstgerechtigkeit, auf der richtigen Seite sich zu sortieren, dass mir Augen und Ohren weh tun.
Jetzt bin ich von dem Baum ‹Voćka weg und bin nach München gereist und zeitlich in die USA, und Stop.
Inzwischen ist Nachmittag, ein riesengroßer Lastwagen kutschiert durch die kleine Straße vor dem Haus. Diese engen Straßen findest du hier in jedem Ort, die Durchgangswege sind mit Rechthaberei, Streit vor Gericht und mit vielen hungrigen Mündern verbunden, Erde sei hier selten, darum muss man jeden Zentimeter für sich und nicht für die Allgemeinheit behalten. Seit Österreich-Ungarn sind die Grundbücher nicht verändert worden, so liegt jeder mit jedem in mündlichem und oder schriftlichem Streit wegen dem Grundbesitz, viele sind tot, gestorben in den USA, und ihre Nachkommen wissen nicht, wem was wie gehört. Darum, dieser große Lastwagen gehört nicht in eine so enge Straße, es stehen da ein paar Männer, welche ihm aufzeigen, wie viele Zentimeter er noch rückwärts gehen kann oder nicht, es ist unglaublich, mit welcher Geduld er diese Einweisungen ausführt.
So komme ich zum scheinbar schon ausgeschöpften Thema der körperlichen Arbeit und ihrer Wertschätzung. Ich bin ein Kind von Arbeitern und wurde im sogenannten Arbeiterstaat geboren. Diese nur 45 Jahre alte sozialistische Geschichte ist mit dem Jugoslawien-Krieg begraben worden, wortwörtlich, ich selber habe nur 18 Jahre hier gelebt, aber mein Blick auf die Welt ist hier entstanden, und alles, was ich in der ersten Zeit in der Schweiz sah, habe ich in Vergleichen gesehen. Arbeiten sei schmutzig und für die Angekommenen gedacht, putzen, bauen, pflegen, das machten andere, und ich gehörte zu ihnen; aber weil sie Migranten sind, hat man Probleme mit ihrer Kultur und nicht mit ihrer Stellung in der Gesellschaft – so entledigt man sich des Nachdenkens über die Wirklichkeit der schwer Arbeitenden.
Jetzt frage ich mich, was ich dir zugerufen habe, da an dieser Türe in Basel, im Vorbeigehen: einen Spruch, eine Aufmunterung oder eine Absurdität. Es passiert bei mir automatisch, diese Vor-lauter-Angst-Schutzsprüche, welche schweben und manchmal deplatziert sind.
In einem Traum, vor ein paar Tagen, glaube ich, sagte ich, ich bin zerbrechlich, siehst du das nicht; das sagte ich, glaube ich, zu meinem kleineren Bruder, der mich immer als stärkere sah, so fühlte ich mich dann auch ihm gegenüber.
Eigentlich habe ich eine Stelle bei Musil gefunden, welche ich dir noch abschreiben wollte, als Dazugeschenk zum Baum.
Ich werde es bis zum Ende unseres Briefwechsels vielleicht doch schaffen. Gestern habe ich die Fahnen meines Romans nach Berlin geschickt, und ich lag im Bett, leer, traurig, dann dachte ich, wie ich als Kind solche Zustände einfach gefühlt hatte, und dann plötzlich waren sie verschwunden, ja, dann gingen wir das Baumfoto für dich machen.
Entschuldige das Zu-Viel von allem und das Zu-Undeutliche, die Sonne strahlt ganz fest, und wir gehen wieder schwimmen, bis bald, ich freue mich sehr auf deinen Brief und kann ihn kaum erwarten.
Deine Dragica
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 7: Träume sind kleine Geschichten, die wir uns des Nachts selbst erzählen …
weiter ...Lieber Paolo!
Träume sind kleine Geschichten, die wir uns des Nachts selbst erzählen, wenn unser Wächter vor der Pforte des Unterbewusstseins endlich eingeschlafen ist und sich unsere vielen Gedanken und Gefühle in bunte, abstrakte und teils bizarre Bilder kleiden. Die Vorstellung beginnt – wie auf einer 4-D Kinoleinwand wird uns der Film vorgeführt und wir schlüpfen meist selbst in die Rolle des Protagonisten, um alle Emotionen der Seifenoper, der Komödie, des Thrillers, des Science-Fiction-Films oder des Horrorfilms hautnah zu erleben. Diese Geschichten erzählen uns etwas über uns selbst im Speziellen und über den Menschen im Allgemeinen, öffnen sie doch die Tür zu unseren intimsten Wünschen, Erfahrungen und Ängsten. Und so werden diese kleinen Geschichten, unsere Träume, aneinandergereiht wie Perlen auf einer langen Kette, zu einer großen Erzählung – über uns selbst und unsere persönliche Entwicklung sowie über das Wesen und die Evolution der Menschen generell. Ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß, ob jung oder alt – wir sind uns im Grunde doch alle viel ähnlicher, als wir es uns selbst oft eingestehen wollen. In unseren Träumen ähneln wir uns alle. Die Farbe und Beschaffenheit der Bilder ändert sich wohl je nach Erfahrungswelt, doch das Wesen unserer Traumerfahrungen ist identisch. Unsere Träume ermöglichen uns einen tiefen Einblick in das, was uns innerlich bewegt, und in das kollektive Unbewusste des Menschen.
Du schreibst von einem beängstigenden Alptraum, der dich in deiner Kindheit wiederholt heimgesucht hat – auch ich kann mich an wiederkehrende Alpträume erinnern. Ich glaube, im Grunde durchleben wir sie alle – und sie sind sich wieder sehr ähnlich. Unsere intensivsten Traumerlebnisse docken an Archetypen der Menschheit an, an feste Urbilder, die wir verborgen seit Anbeginn der Zeiten in uns tragen, und erlauben uns wiederum eine Analyse unserer menschlichen Natur.
Doch vielleicht klingen dir meine traumpsychologischen Gedanken zu mystisch, Paolo. Und
wenn wir schon über die Wesenheit der Dinge sprechen und damit ohne Umwege zu den großen Fragen der Philosophie vordringen, dann sollten wir uns auch fragen, was denn das eigentlich Menschliche überhaupt ausmacht, von dem ich vorher gesprochen habe und das sich auch in unseren Träumen in mannigfaltigen Bildern zeigt? Was entspricht der wahren Natur des Menschen? Wie ist das menschliche Wesen beschaffen? Ich habe mehr Fragen als Antworten, Paolo. Aber ich glaube fest daran, dass es etwas Urmenschliches in uns gibt, das uns alle miteinander verbindet. Und ich spreche nicht davon, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, was ein sicherlich sehr negatives Bild auf unsere Spezies wirft. Nein, ich glaube, dass das eigentlich Menschliche die Qualität ist, die unser Herz der Liebe öffnet, die unsere Hand dem Nächsten ausstrecken lässt, damit er sie ergreifen möge, und die zugleich den Geist zum Transzendentalen, Göttlichen, Ewigen hin ausrichten lässt, von dem wir alle eine tiefe Ahnung in uns tragen. Wir hören den Ruf der Unendlichkeit in uns, auch wenn er im Alltagsgetöse oft übertönt wird und wir ihn oft gar nicht wahrnehmen wollen. Wir spüren den glühenden Funken in uns, der jeden Tag aufs Neue zu einem lodernden Feuer entzündet werden will und selbst die tiefste Nacht zu erhellen imstande ist. Und diese Flamme brennt, sie brennt so stark in uns, wenn wir ihr Feuer nicht nähren, wenn wir sie verkohlen lassen und verschütten und mit Asche ersticken. Es ist ein tiefer Schmerz, den wir betäuben, mit allem, was uns unser komfortables Leben an Ablenkung bieten kann. Schlechtes Essen, Alkohol, Zigaretten, andere Drogen, fernsehen, Dauerberieselung diverser Form. Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Wovor haben wir Angst? Wieso verwenden wir so viel Anstrengung darauf, diesen Funken in uns zu ersticken? Der Dornbusch, er brennt in jedem von uns! Ist es möglich, dass uns unsere Freiheit und unsere Möglichkeiten, unsere Größe und unsere Macht mehr ängstigen als es Ohnmacht, Kleinheit und Einschränkung tun?
Lieber Paolo, auch in mir brennt es. Aber diesen Schmerz, ich will ihn spüren! Ich will ihm nachgehen, ich will ihn befragen, ihm zuhören und ihm nachgeben. Könnte es sein, dass dieser Schmerz uns auf etwas aufmerksam machen will, auf einen Widerspruch zwischen unserer jetzigen Lebensweise und dem, was unserer wahren Natur entsprechen würde? Ist es diese Diskrepanz, die uns schmerzt und dazu auffordert, noch mehr vorzudringen zu unserem eigentlichen Wesen?
Ist es also wahr, wenn ich glaube, dass das Urmenschliche in uns in Wirklichkeit eine geballte Quelle der Liebe, Kraft, Weisheit ist? Wie immer haben wir die Wahl – die Freiheit zu wählen, dem Feuer in uns nachzuspüren oder nicht, und die Freiheit, unser Wesen so oder anders zu definieren. Und natürlich kann auch ich nur Vermutungen anstellen. Doch ich ziehe es vor, die Natur der Menschen als kraftvoll, liebevoll, leidenschaftlich, mitfühlend und hilfsbereit anzusehen. Nur wenn ich das glaube, kann ich auch ein diesen Werten entsprechendes Verhalten üben und fordern. Und weil wir von Träumen gesprochen haben – wovon träumen wir denn eigentlich? Träumen wir nicht alle dieselben Träume von Freude und Glück, von Gesundheit, Hoffnung, Liebe und Mut? Und wenn dem so ist – was können wir in der Wachwelt tun, um uns in unserer Lebensrealität ein Stück weit diesen Träumen anzunähern?
Lieber Paolo, ich wünsche dir, dass du weiterhin träumst und einen Weg findest, jeden Tag aufs Neue konkret deinen Träumen nachzugehen und so ein Stück mehr Traum für uns alle hier erschaffst.
Ich grüße dich herzlich,
Barbara
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 2: Dein Meer habe ich gehört, in den Zeilen, es gurgelte …
weiter ...Zürich, Rote Fabrik, Juni 2020
13. Juni 2020, Zürich
Liebe Dragica
Dein Meer habe ich gehört, in den Zeilen, es gurgelte und war die Bewegung einer zusammenhängenden Masse und roch nach Sonnenlicht und den Geschichten und dem Schaum, der manchmal auf dem Meer liegt. Danke für diese Worte, die so nahe beieinander sitzen, ein Muster ergeben, ein versöhnliches, auch weil sie kleinste Leerstellen lassen, die ich mit mir selbst füllen kann. Dieses Selbst, also ich, sitze auf einem kleinen Balkon an der Seebahnstrasse in Zürich, hinter mir die Wohnung, in der ich lebe und im Radio eine moosige Frauenstimme, die leider vom amerikanischen Präsidenten spricht. Ich habe diesen, meinen Balkon, in einer Geschichte einmal als traurigen Balkon beschrieben, einen traurigen, rauchenden Mann auf ihm, der seine Zigarette so lange in der Hand hielt ohne an ihr zu ziehen, bis auch der Filter abgebrannt war. Den Balkon habe ich als Ort genommen, weil er so klein, dunkel und Traubenfarben war, so passte er zu der Traurigkeit der Figur, die auch meine war in jener Zeit. Das ist mehr als ein Jahr her, dann haben wir ihn weiss gestrichen, Heinz und Nelly und ich und dann kam Romy zur Welt und alles wurde noch viel heller. Ich sitze hier, Krähen krähen und Wind bewegt die Blätter in der Blutbuche vor mir, etwas vom Schönsten, was es gibt. Das ist auch Heimat, dieses Geräusch der Blätter, die aneinander kommen im Wind. Ein sehr leiser, weit entfernter Applaus, vielleicht. Heinz ist mit Nelly und Romy nach München zu seiner Familie gefahren, weil die Grenzen wieder offen sind und seine Familie ihn und er seine Familie vermisste. Ich bin hier geblieben und die Stille ist meine eigene. Zum ersten Mal seit es Romy gibt, erst neun Monate in meinem Bauch und dann neun Monate ausserhalb, werde ich drei Tage ohne sie sein. Es ist eine Freiheit, die jetzt bei mir ist und auch ein Vermissen, aber ein warmes, eines mit weichem Fell, ein An-jemanden-denken-Können, den man liebt, ohne etwas tun zu müssen, für ihn. Und doch gibt es da, im Kopf ganz weit hinten, unter dem Haar, unter der Schädeldecke, oberhalb des Nackens dieses Stimmchen der Gesellschaft, die Anforderungen oder Meinungen zum Muttersein, die wohnen da irgendwo und sie sagten mir, als ich das Kind küsste, an seinem Haar roch und einmal in die gepolsterte Haut des Händchens drückte, es ins Auto setzte, dass das die Mutter nicht soll, wenn das Kind so klein ist, das Kind ohne die Mutter in ein anderes Land. Das ist eine Schuld, die eigentlich nicht meine ist, die komisch spricht in rosafarbenen, klebrigen Sätzen. Und dein Brief hat mich in einem Moment erreicht, versöhnt, wie du geschrieben hast, dein Fenster zu meinem geöffnet, die Fehlerhaftigkeit der Kindheit und das Schuldgefühl. Gibt es diese Schuld nicht immer? Weil ein Leben in den eigenen Händen liegt? Die niemals es richtig tragen können an immer den richtigen Ort? Weil wir so viel Einfluss nehmen, auf dieses Leben und gar nicht anders können, als auch falsch zu sein, weil wir sind, wer wir sind?
Im Hof, in dem die Blutbuche steht, steht nun auch eine Frau, sie spricht mit einer Stimme aus Gummi. Geschirr höre ich, das vom Tisch genommen wird und irgendwo versorgt.
Aneinander vorbei gegangen sind wir, das stimmt und manchmal hallo gesagt, einmal auch hast du mir etwas zugerufen, vor vielen Jahren an der Buchbasel, aber ich habe dich nicht verstanden, dann warst du weg und ich wusste aber, wer du bist und freute mich über dein Rufen, die an mich gerichtete Energie, von der du, so hörte ich und las ich in deinen Texten, eine Menge hast. Und so braucht es nur so wenige Worte und ein Fenster öffnen und schon ist da eine Vertrautheit. Und in dieser, auf die ich antworte, auf dein Berichten von deinem Meer, ist aber auch ein seltsamer Gedanke an die Mitlesenden. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ein seltsames Gefühl, auch bei mir, ein Reflex, sich zu ducken, weil es vielleicht nicht viele angeht und es aber nicht tun, nicht ducken, weil darin der Wert des Schreibens liegt.
Komische Welt, denke ich. Die Stille. Und ein gutes Gefühl beim Schreiben an dich. Einmal nur die Wahrheit reden, wie deine Tochter dich bat. Das machen wir doch, das ist unser Beruf. Und gerade jetzt, an dich schreibend, liebe ich ihn.
Die Wahrheit ist auch, ich war in Tansania zuhause, aber bin nie dorthin zurückgekehrt. Ich war einmal da, das schon, letztes Jahr und war sehr hell und leicht abwesend mit Seidenhemd (wie schön du das mit dem Sonnenhut geschrieben hast). Es geht nicht. Die Geschichte des Kolonialismus zu schwer und das Fremdsein zu gross. Ich kann darüber nicht schreiben. Habe in der letzten Kolumne zum ersten Mal darüber etwas geschrieben und hatte grosse Angst. Das ist ein Problem.
Bewahrst du dir das Kindsein im Schreiben? Das klingt nach Konfetti auf der Strasse liegen geblieben, im Regen, ich weiss. Aber ich fühle es manchmal so. Man wird älter, die Jahre springen weg (auch so ein gutes Bild), man baut sich immer mehr an sein eigenes Gerüst und auch die anderen Bauen etwas daran und irgendwann ist man schwerer und auch so definiert und als Kind ist da eine Autonomie mit einem im Baumhaus. Und diese Autonomie, diese Welt, in die mir niemand reinkommt ohne, dass ich es will, die bewahre ich mir im Schreiben, so gut es geht. Mit aller Kraft.
In Kroatien war ich auch einmal in einem Meer, aber das prägendste Erlebnis hatte ich im Landesinneren. Im Sommer 2014 fuhren wir an eine Hochzeit nach Mazedonien, hielten in einem kleinen Ort, dessen Name ich vergessen habe, dort schliefen Heinz und Nelly und ich in einem riesigen Hotel, in dem ausser uns aber niemand war. Beim Frühstück machte der Mann, der an der Rezeption gearbeitet, unser Zimmer aufgeräumt, das Frühstück zubereitet hatte, ein Rührei für uns. Und es war so sehr versalzen, das Rührei und es war aber so aufmerksam und freundlich von diesem Mann, dass wir es nicht essen, aber auch nicht stehenlassen konnten. Darum haben wir es in die Zeitung (Die Zeit) eingewickelt, die wir dabei hatten und es mit ins Auto genommen. Bis nach Serbien kam es mit uns mit, das Rührei, versalzen und die Erinnerung an den Mann im Hotel ist immer noch da.
Und nun ist die Frau mit der Stimme aus Gummi verstummt. Ich bleibe noch etwas hier sitzen, denke an meine Kinder, die auf den Bodensee zufahren, denke an dich, wie das Muster deines Kleides, dass du auf dem Bild trägst, das aufgenommen wurde, von deinem Sohn, der Geburtstag hatte, als du den Brief an mich schriebst, zum Muster deiner Worte passt.
Ich lasse ihn grüssen und gratuliere ihm und dir.
Bis bald,
Deine Julia

Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 9: „Entschuldige meinen langen Brief, für einen kurzen hatte ich keine Zeit“ …
weiter ...Ende Mai, Anfang Juni
Liebe Marjana,
„entschuldige meinen langen Brief, für einen kurzen hatte ich keine Zeit“ – das soll Charlotte von Stein irgendwo geschrieben haben. Der Satz wird aber auch Goethe, Voltaire, Churchill, Mark Twain, Blaise Pascal und vielen anderen zugeschrieben. Ich musste kurz nachdenken, um ihn zu verstehen, aber natürlich ist klar, dass in der Kürze die Würze legt und die Länge oft nur ein Zeichen von Disziplinlosigkeit, Konzentrationsmangel und Ausuferung ist. Meiner Mutter, die schon sehr neugierig ist auf den Briefwechsel zwischen dir und mir (sie verweigert das Internet, bekommt nach deinem fünften Brief einen Ausdruck von allen zehn Briefen), habe ich letztens diesbezüglich geschrieben: „Mein vierter Brief ist relativ kurz ausgefallen, dafür wird der fünfte wieder ein überbordendes, mäanderndes, ungestümes Ungetüm! Ich habe schon begonnen damit. Briefe, schöner Götterfunken! Schönes Götterflunkern!“ – Hurra und Heureka, in diesem Brief tummeln sich die Giganten: Götter, Goethe, Beethoven und Scheerbart: „’Na, Onkelchen’, sagte das Nilpferd, ‚wohin willst du?’ – ‚Ich habe mich verstiegen!’, erwiderte ich traurig.“ Wohingegen ich mich nicht versteigen will, lieber stürze ich ab. Goethe ist ein Bergmassiv, ich verstehe nicht, wie er so unglaublich viele Briefe schreiben konnte! Irgendwelche Quellen, die ich nicht überprüft habe, behaupten, dass von ihm 12.000 Briefe erhalten sind, allein an die oben erwähnte Charlotte von Stein hat er ca. 1500 geschrieben … Und er hat ja auch unglaublich viel anderes geschrieben! Wie um alles in der Welt hatte er Zeit für einen Faust, d.h. zwei Fäuste, nicht nur für ein Fäustchen (ich lache gern in selbiges, hihi). Und hierher passt jetzt gut ein Zitat von Werner Kofler, von dem ich gerade das Gesamtwerk gekauft habe: „Ich kann dem Halblustigen schwer widerstehen.“ In meinem Fall ist es oft so, dass ich mich vor der Arbeit drücke, indem ich Briefe schreibe, muss ich selbstkritisch zugeben. Brief ist Freiheit, nix Arbeit, Breif (bitte nicht korrigiren!) darf Fehler haben, muss nix viel gebügelt und überfeilt sein, Wildwuchs ist möglich, Überschwang und Überschnapp, es gibt auf jeden Fall eine Leserin, einen Leser (zumindest eine Person liest, was man schreibt – das ist oft schon viel für jemanden, der schreibt. Her mit der Dose Mitleid!) … Und jetzt habe ich gerade von Rüdiger Görner das Buch Demnächst mehr. Das Buch der Briefe bestellt. Kennst du das Buch Der Fieberkopf von Wolfgang Bauer? Ein grandioser, wilder, durchgeknallter Brief-Roman. Mit meinem Freund Wolferl war ich letzten Sommer in Graz, um beim Droschl Verlag eine Wolfgang Bauer-Sonderausgabe abzuholen (W. bestand auf persönlicher Abholung) und danach das Grab von Bauer zu besuchen (Max Droschl skizzierte uns den Weg dorthin – allein diese Skizze! Ich muss sie dir einmal zeigen). – Was für ein herrlicher Tag das war! Ich muss beizeiten darüber schreiben, auch über die Vorgeschichte … Wolferl hatte übrigens letzten Sonntag Geburtstag, am selben Tag wie Johnny, von dem ich dir im ersten Brief erzählt habe. Ich rief beide an. Wolferl hat eine Freundin, der hat er ein Haserl mitgebracht. Er hat das junge, kleine, schneeweiße Tier vor einiger Zeit in der Bio-Abfall-Tonne gefunden und ihm sofort den Namen Miles gegeben (W. liebt neben den Stones, Neil Young, Lou Reed, Patty Smith, Iggy Pop u.a. auch Miles Davis). Später stellte sich heraus, dass Miles ein Weibchen ist. Die weiße Häsin(?) ist benannt nach einem schwarzen Trompeter … Johnny fragte, ob ich mit ihm auf ein Bier gehe. Wir waren dann in einem Lokal mit dem Namen Zwergerl, wo wir im Freien saßen, zu sechst (zwei davon waren zufällig dazugestoßen, die wussten nichts vom Geburtstag) – auch keine große Feier zum 60-er. Um auf Miles zurückzukommen, denn als du von Arthur geschrieben hast, musste ich sofort an ihn denken, von Fritz ganz zu schweigen, aber darüber später … Zu spät heißt das Buch von Kofler, aus dem ich vorher zitiert habe, das ich schon länger als Einzelausgabe besitze … Arthur! Ich bin beeindruckt, dass du am Körperbau der Spinne erkennen kannst, dass es sich um ein Männchen handelt! Du kennst dich also nicht nur bei Pferden, sondern auch bei Spinnen aus. Die Spinne Arthur und die „Minifliegen“, wie du schreibst! Auf unserem schwarzen Brett (richtig sagt man anders, Pinnwand?) hängt seit einiger Zeit eine altbekannte Karte, darauf ist das Foto eines Lausbuben, daneben steht: „Du fragst mich, was soll ich tun? Und ich sage: Lebe wild und gefährlich, Artur.” – Die Karte sah ich zum ersten Mal bei einem deutschen Künstler in dessen Haus in Civitella d’Agliano im Süden unten … Ich will aufhören zu bafeln, so gern ich das tue! Ich will dir lieber die angekündigten Neuigkeiten von Fritz mitteilen (diesen Samstag wird er übrigens in der Zeitung stehen, im STANDARD. Wojciech Czaja hat ein „Wohngespräch“ mit mir geführt, darin rede ich u.a. über Fritz.), der wieder bei uns ist, d.h. seine Nachkommen, seine Kinder! Wir haben gezählte sieben Fliegen in der Wohnung, die alle Fritz sehr ähnlich sind und sich auch sehr ähnlich verhalten. Es muss sich um seine Kinder handeln! Wahrscheinlich war Fritz weiblich und hat in unserer Wohnung Eier gelegt. Leider kenne ich mich bei Fliegen nicht aus, ich bin kein Ornithologe, hoho. Wohingegen du dich bei Pferden und Spinnen auskennst! Und Goethe hat Charlotte 1500 Briefe geschrieben! Ich fühle mich im Moment ein bisschen unwissend und mickrig. Ich stand einmal vor der mächtigen und auch wegen ihrer hohen Schuhe sehr großen Drag Queen Dusty O., ihren gewaltigen Vorbau vor der Nase, sah zu ihr auf und sagte mit schwacher Stimme: „Ich fühle mich so klein und jämmerlich“, da sagte sie mit verächtlicher Miene: „Das bist du auch!“ Aber immerhin schreibe ich dir, Marjana von Feldblume, wie ich dich jetzt einmal nennen will (wegen Arthur und den Minifliege usw.) fünf Briefe … Und vielleicht, wer weiß … Ich liebe unsere kleinen Drei: Arthur, Miles und Fritz. Wie heißen eigentlich deine Pferde?
Es gibt für mich fast nichts Schöneres als einen Brief zu schreiben, ich bin so frei. „Es lebe die Freihei, tandaradei!“ Wiederholung tut gut, Wiederholung macht Mut … In Tosters, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine Mauer, auf der steht seit ewigen Zeiten ein Graffiti, dabei muss ich immer an F.K. Waechter denken: „Es lebe die Gerech“, steht dort auf dieser Mauer, mehr nich (das bitte nicht korrigieren!). Fritz war ein wunderbarer Cartoonist, Zeichner, Autor, Mensch … „Herr Bauer, ich glaube, ihr Huhn hat Fieber“ oder so ähnlich ist auch von ihm. Daran musste ich gerade denken, weil meine Frau kürzlich, als die sieben Fliegen gleichzeitig aufflogen, meinte: „Das ist ja wie auf dem Bauernhof!“
Weil du nach Kritzendorf gefragt hast: Zorica heißt die Frau, die uns ihr Stelzenhäuschen im Sommer überlässt, damit wir uns um ihre Pflanzen kümmern, damit sie nach Serbien kann, um ihre Mutter und Verwandten zu besuchen. Was Gelsen anbelangt, war ich in Kritzendorf immer positiv überrascht. Die letzten drei Sommer waren kaum welche von diesen Insekten unterwegs (du magst Insekten, hast du geschrieben – sehr sympathisch!), von einer Gelsenplage konnte nie die Rede sein … Und stell dir vor, einmal sang uns auf der Terrasse unseres Stelzenhäuschens eine 15-jährige Ukrainerin ukrainische Lieder vor! Herzergreifend, herzerwärmend. Bei einem internationalen Literaturfestival in Finnland saßen einmal in der Nacht mehrere Autorinnen und Autoren zusammen, da kam die Idee auf, dass alle ein Lied aus ihrer Heimat singen sollten. Ich erinnere mich am deutlichsten an die ukrainische Autorin, weil sie, während sie ihr todtrauriges Lied sang, zu weinen begann … Ich sang übrigens ein Lied von Qualtinger und Heller, das niemand verstand (der zweite deutschsprachige Festival-Teilnehmer Thomas Lang war an dem Abend nicht dabei). Ich sang das schwarze Lied inbrünstig, es kam gut an als gefühlvolles Wienerlied, der Refrain, ins Hochdeutsche übersetzt: „Bei mir seid ihr alle im Arsch daheim, im Arsch dort ist eure Adresse …“ Das goldene Wiener Herz bringt mich wieder einmal zum Golden Molden. Du hast gefragt, ob ich ein Gelsen-Gedicht bieten kann, nein, aber Molden ein Gelsen-Lied, darin die Zeilen (wortwörtlich, buchstäblich aus dem Booklet): „du hosd highaud und ned droffm / und so homs hoed weida gsoffm / vo dein bluad / sog geds da guad“ – Sag, geht es dir gut?
Kein Gelsen-Gedicht, aber ein Erdmännchen-Gedicht habe ich, das ich dir zeigen könnte. Es ist in einem Buch drin, von dem ich letzte Woche überraschenderweise fünf Belegexemplare zugeschickt bekam – ich hatte ganz vergessen, dass ich für die Anthologie was eingereicht habe, das Buch heißt Die Bienen halten die Uhren auf, Untertitel: Naturgedichte, erschienen bei Reclam. Und darin findet sich ein einziges Gedicht von mir, wohl eines meiner besten, hier ist es in voller Länge:
Mann im Zoo
Geht es mir nicht so gut,
gehe ich in den Zoo
und rede dort
mit den Erdmännchen.
Danach geht es mir besser.
Na, wenn das keine Weltliteratur ist, weiß ich auch nicht!
Eines meiner Bücher heißt übrigens Was mir die Erdmännchen erzählen, das wurde von einem gewissen Herrn Nüchtern gnadenlos verrissen. Er schrieb mit voller Wucht, das Buch sei „langweilig und halblustig“ usw. Aber ich habe natürlich schon schlimmeres erlebt. Hast du auch schon Verrisse einstecken müssen, vernichtende Rezensionen, die Boden weg unter den Füßen machen, ums schön zu sagen? Schwamm drauf! Was einen nicht umbringt, blabla.
Jan Larri – das Buch von ihm ist leider nicht lieferbar, zumindest nicht auf Deutsch, hat mir meine Buchhändlerin mitgeteilt, sie habe nur die russische Ausgabe gefunden. Leider kann ich kein Russisch. Mein Sohn kann bissl Russisch, weil er lange mit einer Russin aus Moskau zusammen war. Er war immer wieder in Moskau, auch in Petuschki, wo Verwandte von ihr wohnen (eines meine Lieblingsbücher war lange Die Reise nach Petuschki von Wenedikt Jerofejew, ich konnte einmal viel daraus auswendig …) – sie, Margarita, war immer wieder in Wien (einmal sogar zwei Monate am Stück). Ach!
Wenn du in Wien bist, könnten wir uns doch einmal treffen, nicht? Also ich würde sehr gern. Zum Beispiel in einem schönen Wiener Café, von denen es zum Glück noch viele gibt. Übrigens die Lokale, die ich im vorigen Brief aufgezählt habe, gibt es alle, und ich war auch schon in allen drin, in den wenigsten allerdings in letzter Zeit, sondern in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. In der Blue Box z.B. war ich das letzte Mal vor 100 Jahren. Nur im Gasthaus Zum lustigen Bauern war ich noch nie, aber da will ich im Sommer hin, um dort den Tänzer und Dichter Udo zu treffen, der in der Nähe ein Häuschen gekauft hat, in Muckendorf, nicht weit von Kritzendorf … Vorfreude auf den Sommer, in dem hoffentlich Corona endlich vernichtend geschlagen sein wird, und zwar weltweit und absolut. „Träum weiter!“, sagte mein Sohn früher oft zu mir.
Hätten wir uns mehr über Corona unterhalten sollen? Nein, das haben schon genug andere getan, denke ich scharfsinnig. Meine Friseurin – ja, ich habe endlich wieder eine super Frisur! – hat gemeint, sie habe es satt, über Corona zu reden. Ich pflichtete ihr bei, danach redeten wir über Corona … „Corona, Corona, where have you been so long …“
Jetzt ist gerade eine Ankündigung der „Sommerakademie Schrobenhausen“ hereingekommen. Unter dem Motto „soziale Distanz – poetische Nähe“ wird u.a. ein Kurs angeboten mit Kerstin Hensel, von der ich gerade vor kurzem zum ersten Mal gehört habe: „Der Autor in Welten der Anderen“. Ein Kurs von Norbert Niemann nennt sich: „Ich und Du“. Am liebsten besuchen würde ich den Kurs von Senthuran Varatharajah: „Wie man sein Leben erzählt. Über autobiographische und autofiktionale Praxen.“ – Von Kerstin Hensel habe ich bei meinem ersten Lokalbesuch nach dem Shockdown gehört. – Ein Zeichen?
Hast du von den oben Erwähnten schon Bücher gelesen?
Noch was zu Schrobenhausen: Ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt „Schön schief!“, darin kommt vor: „Briefe schrieb ich / auch viele schiefe / ich schrob sie vielmehr / als dass ich sie schrieb.“ Verschroben sind viele, schrullig auch, ich klopfe mir auf den Bauch. Das schiefe Gedicht ist in meinem vorletzten Buch drin, das letzte kam vor ein paar Tagen angeflogen, setzte sich nieder auf mein’ Fuß, da gab ich ihm einen Kuss … Weil’s auch wirklich zu schön geworden ist, dank der großartigen Raffaela Schöbitz, die wunderbare Illustrationen gemacht hat. Das Buch wurde früher als erwartet fertig, so eine Freude, eine narrische. Es heißt: Gute Reise, Eierspeise!, ein Buch für Kinder, aber nicht nur, würde ich meinen. Ursprünglich hieß es Eierschmeißfeier, aber dagegen gab es vehementen Protest bei der deutschen Vertreterkonferenz, da Eierschmeißen in Deutschland zu Ostern Tradition sei und es sich bei meinem Buch definitiv nicht um ein Oster-Buch handle … Der Verlag rief mich an, es musste eine neuer Titel her, und zwar schnell, am besten einer, in dem Eier vorkommen, damit die Illustratorin keine zusätzliche Arbeit hat, und innerhalb von einer Stunde lieferte ich gezählte 69 Titel, Nr. 67 ist es geworden. Der neue Titel gefällt mir inzwischen besser als der ursprüngliche. Während ich auf Titel-Suche war, rief mich übrigens ein Freund an. Er musste lachen, als ich ihm von meinem Titel-Problem erzählte, und er meinte, es sei schon erstaunlich, womit ich mich beschäftigen würde in meinem Alter. Sein nicht ernst gemeinter Titel-Vorschlag lautete: „Hoden ohne Boden“ …
Ich Ich Ich – Widerl-Ich! Jaja, das Widerl-Ich. Ich will einmal ein Märchen schreiben, dessen Protagonist Widerl heißt. Widerl und die Anderen. Widerl und Du … By the way, kennst du das Buch Ich Ich Ich von Robert Gernhardt? Einem kurzen Text von mir, der schon lange verschollen ist, stellte ich einmal drei Zitate voran: Eines aus dem eben erwähnten Buch Ich Ich Ich von Robert Gernhardt, eines aus dem Text Ich, ich von Daniil Charms und eines aus Ich, der Autobiografie von Franz Beckenbauer. Ich kann mich nur erinnern, dass der Satz von Beckenbauer, dem Fußball-Kaiser, am „poetischsten“ war, ein blumiger, schwülstiger Satz mit einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Apropos Fußball, kürzlich sah ich zum ersten Mal seit ca. drei Monaten ein Fußballspiel. „War das eine Herrlichkeit!“, um schon wieder Hrabal zu zitieren. Manche Sätze sind mir in Fleisch und Blut übergegangen.
Ich schreibe täglich weiter an dem Brief an dich – das erinnert mich an einen Sommer, in dem ich einer Dänin schrieb, die ich in Grauen (wirklich war!) kennengelernt hatte … Ich war zu einer Lesung in Grauen eingeladen, im Rahmen einer Ausstellung der Hamburger Kunstschule Soundso. Der Leiter der Kunstschule, bei dem auch ein Freund von mir Schüler gewesen war, lebte mit seiner Familie in Grauen, wo er ein größeres Anwesen besaß. Mein erstes Buch war erschienen, bei einem großen Berliner Verlag, die Lesung fand am späten Nachmittag statt, in der ersten Reihe saß besagte Dänin, eine der ausstellenden Künstlerinnen – sie wurde vom bezaubernden Abendsonnenlicht beleuchtet, ich las aus meinem ersten „richtigen“ Buch vor, wie manche sagten (das kleine Buch, das vorher bei einem Wiener Kleinverlag erschienen war, zählte für viele nicht), es war einmal, du liebe Zeit, und wie diese Dänin dann mit mir sprach, das erinnerte mich an Vivi Bach, eine Dänin, die ich als sehr junger Mensch in einer bekannten Familienshow immer gesehen hatte, deren unperfektes Deutsch mit dänischem Akzent, diese „süße Sprechweise“ mich erotisiert hatte … In Grauen war es um mich geschehen. Am nächsten Tag besuchte ich die Dänin gleich in der Kunstschule in Hamburg, auf dem Weg dorthin schiss mir ein Vogel auf den Kopf, wir unterhielten uns stundenlang („Das Leben ward noch nie begonnen, wir wollen’s beginnen“, Li-tai-pe, übersetzt von Klabund) und und und … Ich musste wegen Brotberuf, Frau und Kind zurück nach Wien, sie hatte meine Adresse und sagte, sie würde mir schreiben, so würde ich ihre Adresse bekommen, ich wollte dann auf ihren Brief reagieren, aber der Brief kam nicht, er kam einfach nicht, Woche um Woche verging, ich platzte fast vor Mitteilungsbedürfnis. Also begann ich, ihr zu schreiben, immer auf ihren Brief wartend, es wurde eine Art Tagebuch dieses Sommers, der Brief wuchs immer mehr an, „kurz ist das Leben, lang der Brief“, und als dann endlich ihr schönes Brieflein eintraf, das ich so sehnsüchtig erwartet hatte, war mein Brief inzwischen auf über 80 Seiten angewachsen bzw. angeschwollen (handschriftliche), ich schoss ihn unverzüglich ab, und ich muss sagen, als sie ihn bekam, war sie leicht schockiert, auch abgestoßen. Tja, meine Frau hatte es auch nicht immer leicht mit mir. Übrigens, als ich von Grauen und Hamburg zurück nach Wien kam, war ich irgendwie verändert – diese Erleichterung meiner Frau, wir waren damals noch nicht verheiratet, als ich ihr nach einer Woche gestand, dass ich schrecklich verliebt sei. Sie war wirklich erleichtert. Ach so, ja das sei nicht so schlimm, das vergehe schon wieder, soll nix Schlimmeres passieren … Meine scharfsinnige Analyse, warum „die Sache“ so tief ging, stichwortartig zusammengefasst: Vivi Bach, erstes „richtiges“ Buch, Abendsonne, Kunst, große weite Welt (Hamburg, Grauen), Freiheit, nix Brotberuf …
Fast jedes Mal, wenn ich hier bei uns über die Rotundenbrücke gehe, denke ich an das Boot, das früher unten am Ufer angeleint war, eine sogenannte Rettungszille. Damit wollte ich eine Zeitlang zum Schwarzen Meer fahren, nach Odessa. Einmal spät in der Nacht, nach einem arbeitsreichen Tag beim Heurigen und einem bierreichen Feierabend, war ich kurz davor, die Reise anzutreten. Ich hatte schon ein Bein gehoben, um ins Boot zu steigen, da fiel mir ein, dass ich keinen Wein und viel zu wenig Zigaretten dabei hatte, also verschob ich die Reise auf später … Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin, nicht mehr zu rauchen. Rauchst du eigentlich? Hast du je geraucht? Ein Buch, das ich auch vielleicht irgendwann fertig stellen will, schläft den Schlaf des Verschobenen – heia, heia, au weia! Das Material für dieses Buch ist ein Konvolut aus Briefen, die ich während der Zeit verfasste, als eine Katze bei uns eingezogen war (ich wollte keine, aber da mein Sohn meinte: „Wenn ich schon keinen Bruder habe …“) und ich mit dem Rauchen aufgehört hatte, worunter ich litt wie ein Hund. Ich wurde depressiv, konnte nicht mehr schlafen und weil ich auch nicht mehr schreiben konnte, schrieb ich unendlich viele Briefe, die sind ausgedruckt in einem dicken Ordner mit dem Titel: Lieber Nichtraucher und Katzenfreund. Ich muss mir immer wieder sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Jaja, damals machte ich noch einen Unterschied zwischen dies und das, um’s ganz präzise zu sagen.
Mit Johnny habe ich im Zwergerl Geburtstag gefeiert, mit Wolferl traf ich mich Tage nach seinem, also Wolferls Geburtstag (er ist noch nicht so alt wie Johnny und ich) in „unserem“ Kaffee Alt Wien. Die eigentlichen Geburtstagsgeschenke hatte er schon mit der Post bekommen, aber wir schenken uns auch zwischendurch immer wieder was, er bekommt z.B. alle meine Bücher, also bekam er natürlich auch das gerade erschienene Gute Reise, Eierspeise, selbstverständlich mit Widmung, und darin habe ich u.a. einen Satz geschrieben, der auch in einem Lied des von Wolferl so sehr geliebten Neil Young vorkommt (mit kleiner Änderung zum Schluss): „There’s more to the picture than meets the Ei.“ – Von Wolferl bekam ich das Buch IGGY POP open up and bleed von Paul Trynka. Außerdem überreichte er mir Fotos, auf den Miles zu sehen ist! Der Hase Miles und die Katze Carlo. Was für süße Tierchen! Und wie jedes Mal bei unseren Treffen machte Wolferl mit seiner Sofortbildkamera ein Foto von mir und ich machte eines von ihm. Die Fotos legte er auf den Tisch, wo wir aus der schwarzen Fläche durch die Lichteinwirkung mit der Zeit langsam hervortraten (Ausdruck mangelhaft). Er schreibt dann jedes Mal mit schwarzem Stift darunter: Ort, Datum, Uhrzeit. Es gibt inzwischen sehr viele Fotos von uns. Er nimmt mein Foto mit, ich seines. Jemand habe ihn vor kurzem gefragt, ob ihm nicht fad war während der Corona-Zeit (er konnte, weil Vorerkrankung usw., nicht zur Arbeit), da habe er ihm geantwortet: „Heast Oida, ich hab über 4000 Schallplatten, da wird einem nicht fad, ich hab ausgesorgt …“ (So in etwa sagte er.)
Miles ist ein süßes, wuscheliges, schneeweißes Tierchen, und Carlo sieht aus wie unsere verstorbene Katze, und Carlo heißt eine Hauptfigur in einem weiteren meiner halbfertigen, verschobenen Bücher mit dem Arbeitstitel Wir waren eine kleine lustige Gruppe …
Mit Johnny im Zwergerl war es auch großartig! Bei „Zwergerl“ musste ich jetzt an „Kathedrale“ denken … Nur Geduld, es klärt sich gleich auf.
Ich habe eine neue Frisur, der Wildwuchs wurde endlich gestutzt. Nach dem Haarschnitt durch die erfrischende, humorvolle, urliebe Friseurin gehe ich in ein Geschäft und frage den Herrn an der Kassa nach einem Camping-Kocher (wir wollen Mitte Juni eine Woche lange zelten gehen!). Er ruft nach einem Mädchen, sie solle mir das Gewünschte zeigen. Das Mädchen trägt eine Rapid-Maske, so haben wir gleich was zu reden. Ich sage ihr, dass ich am Vortag das erste Mal seit ca. 3 Monaten wieder ein Fußballspiel gesehen habe. Sie gleich: „Die Bayern haben leider gewonnen!“ Ich, ganz Experte: „Ja, schade, jetzt ist die Liga ist nicht mehr spannend.“ Sie: „Wie war das Spiel?“ Ich: „Hm, die Freunde, mit denen ich es angeschaut habe, sah ich zum ersten Mal seit langem, also wir haben viel gequatscht …“ Eine spanische Zeitung schrieb über den Bayern Spieler Kimmich, der das einzige Tor des Spiels geschossen hatte: „Das Duell zwischen Lewandowski und Haaland hat Kimmich gewonnen. Er ist ein Fußballer so groß wie eine Kathedrale.“ – So groß wie eine Kathedrale, ein Fußballer, alle Achtung vor diesem Vergleich! Ja, ich war endlich wieder mal Fußball schauen, mit Antonio und seinem Schwager Dominik. Von Antonio wird im Sommer ein Theaterstück in Klagenfurt aufgeführt und ein neues Buch erscheint auch von ihm: Nachrichten aus einem toten Hochhaus – in der Titelerzählung geht es u.a. um das „tote Hochhaus“ in Pécs, das mich dort auch sehr beschäftigt hat. Inzwischen ist das Hochhaus, das lange leer stand und verrottete, abgerissen worden. Ich erzähle ihm von dem Titel-Theater wegen meinem „Eierspeise-Buch“, dass bei den 69 Titel-Vorschlägen auch dabei gewesen sei: Mach es wie die Eieruhr, den Titel hätte ich dann zur Sicherheit gegoogelt und sei draufgekommen, dass er schon vergeben war. Das letzte Buch von Antonio heißt so, hoho. – Immer lustig, immer froh, hoch lebe der Antonio!
Liebe Marjana, ich hoffe, ich langweile und ermüde dich nicht. Ein Freund hat mir vorgeworfen, ich würde dich mit meinen Briefen erschlagen … Das will ich auf gar keinen Fall, dich erschlagen, ich will niemanden mit Briefen erschlagen, das wäre mir gar nicht recht, ich weiß, andere haben anderes zu tun als elendslange Briefe zu schreiben … Ich erwarte nie und nimmer Antworten in ähnlichem Umfang, meine Mutter, der ich seit Anfang 2018 Briefe schreibe wie blöd, hat mir z.B. noch nie geantwortet. Aber sie ruft nach jedem Brief an, den sie von mir bekommt … Anfang Jänner 2018 hatte sie ihren 80. Geburtstag (sie wollte von ihren vier Kindern keine Geschenke, höchstens ein Buch, und sie verbat sich irgendwelche Überraschungsfeierlichkeiten). Während der Zugfahrt zu ihr kam ich auf die Idee, ihr 80 Briefe zu schenken, die ich ihr im Laufe des Jahres schreiben würde. Was in der Folge passierte, überraschte uns beide, denn die Briefe waren dann nicht selten 20 Seiten lang, insgesamt waren es am Ende des Jahres über 700 Seiten (solche Seiten wie diese hier), und damit wir beide nicht Entzugserscheinungen bekommen, schenkte ich ihr zum 81. Geburtstag wieder Briefe, nur diesmal mit der Einschränkung, dass keiner länger als eine Seite sein darf (daran hielt ich mich dann auch brav, meistens zumindest), und 2020 bekam sie wieder Briefe, diesmal sollten es mehr fiktive, autofiktionale sein (so war zumindest der Plan, der bald über Bord geworfen wurde), und nur einer pro Woche (Seitenzahl wieder unbegrenzt). – Das war eine der besten Ideen, die ich je hatte, ihr Briefe zu schreiben, auch wenn dabei natürlich einiges an Schreibenergie und Schreibzeit draufgeht. Aber das ist es mir wert. Mein Schreiben führt zu Reaktionen, und noch dazu meistens zu sehr schönen! Mutter ruft mich nach jedem Brief an, wie gesagt, sie freut sich darüber, muss oft lachen (ich muss diszipliniert sein und mir ständig vor Augen halten, an wen ich schreibe, also depressives Gejammer oder schlimmeres verkneife ich mir) – ja, sie muss lachen, liest die Briefe mehrmals, einmal hat sie gemeint, sie habe mich jetzt erst richtig kennengelernt, eigentlich sei ich vorher für sie immer noch der 18-jährige gewesen, der damals von zuhause auszog … Warum ich auf die Idee kam, ihr zu schreiben, erzähle ich dir vielleicht ein anderes Mal, wenn es sich ergibt, jetzt genug davon.
Dein heiß ersehnter Brief (lass mich das so sagen) ist gerade gekommen, ich bin entzückt! – Ich habe gelogen, dein Brief ist noch nicht da. Ich werde obigen Satz erst schreiben, wenn er da ist. – Wie mich das alles an diesen Sommer mit der Dänin erinnert: „S-prich doch mal österreichisch, du!“, hatte sie zu mir gesagt …
Im STANDARD dieses Wochenende bin ich groß drin, im Immobilien-Teil. In einem „Wohngespräch“ rede ich über unsere kleine Wohnung, träume von einem eigenen Hochhaus: 10 bis 12 Stockwerke würden mir genügen, sage ich, jedes für was anderes: Musik, Lyrik, Roman, Kinderliteratur, Brief usw., natürlich vergesse ich nicht auf Kochen, Essen, Schlafen usw. Wenn es dann soweit ist, werde ich mir das alles genauer überlegen. Antonio schreibt über das tote Hochhaus von Pécs, ich träume von einem höchst lebendigen eigenen Hochhaus.
Die sieben Fliegen, Kinder von Fritz! Seit Tagen schon sind sechs von ihnen verschwunden, eine einzige ist bei uns geblieben. Wir vermuten, die anderen sind beim Lüften durchs Fenster entwischt. Untreue Seelen! Ich beneide dich um Arthur.
2002 hatte ich auch eine exzessive Briefschreib-Phase. Ich hatte beim Brotberuf-Heurigen aufgehört, wollte dort nicht mehr arbeiten, wollte mich nur noch aufs Schreiben konzentrieren, mein Freund P. trennte sich von seiner Freundin E., d.h. die beiden trennten sich voneinander, da war der Weg wieder frei für mich (ohne konkret zu werden, zehn Jahre zuvor glaubte ich, meinen Freund für immer verloren zu haben, was eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens war, nämlich etwas partout nicht wieder gutmachen zu können), er zog in eine andere Stadt, wir verloren uns aus den Augen, kein Kontakt mehr, dann nach fast zehn Jahren schüchterne Annäherung, und auf einmal war alles wieder gut, so wie vorher, und Briefe ohne Ende. Ich war damals endlich freier Schriftsteller, genoss meine Freiheit, und was tat ich Trottel? Ich schrieb Briefe, vor allem an P., und zwar hunderte von Seiten. Es galt u.a. 10 Jahre nachzuholen, in denen wir uns nicht gesehen hatten … Tja. Schön war’s. Alles unveröffentlicht. Das alte Lied mit der langweiligen Melodie.
Ernst Molden singt in einem Lied: „Schwarz, schwarz, schwarz brüllt der Wienerwald …“. Ich schreibe eigene Lieder, singe Lieder von anderen, vertone Gedichte, übersetze, mache nicht nur „Kofferversionen“, sondern auch „Vollkofferversionen“, streue bei Auftritten zwischendurch gern einen Satz von Valère Novarina aus Die eingebildete Operette ein: „Hier liegt ein Lied begraben, liegt ein Lied begraben … das nix taugt … was nix taugt … das besser klingt, wemman’s nicht singt!“ (Übersetzung von Leopold von Verschuer, den ich vor Jahren nach einem Auftritt in Gmunden kennenlernte – sehr sympathischer Mann, Mann! Ein anderer Mann, mein lieber Bruder, der ernsthafte Komponist, hat es nicht so gern, wenn ich Musik mache. Wir werden so schon oft genug miteinander verwechselt, und wenn ich auch noch vermehrt als Musiker in Erscheinung trete, ist das Durcheinander perfekt, und er will, vor allem was Musik anbelangt, auf keinen Fall mit mir verwechselt werden. Bei einem meiner ersten Auftritte mit (absichtlich) verstimmter Gitarre bot er in der ersten Reihe einen Anblick, den ich nie vergessen werde: Während ich beschwingt und hemmungslos vor mich hin sang und klampfte, hatte er sein Gesicht mehr oder weniger zwischen seinen Knien und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu.
Ehe ich’s vergesse, wir hatten gerade unseren 15. Hochzeitstag. Wir beschlossen, einen „Corona-Tag“ zu machen, da durfte nicht fehlen: ein eineinhalb bis zweistündiger Spaziergang durch den Märchenwald zur Donau und zwei Folgen unserer aktuellen Serie. Wir haben übrigens in Hamburg geheiratet. Wo du?
Hast du Reisepläne? Mein neues Reisziel heißt: Christian County in Missouri, Verwaltungssitz ist Ozark (die Serie, die so heißt, sehen wir derzeit. Es kommen darin dermaßen brutale Szenen vor, dass ich schon mehrmals brutale Träume hatte, meine Frau meinte, wir sollten danach weniger brutale Serien schauen, weil sich die brutalen so brutal auf meine Nächte auswirken). Städte in der Nähe von Ozark sind Chicago, Kansas City, Springfield, Memphis Tennessie … Aber es wird wohl eher Kiel werden, d.h. Kiel, Hamburg, Bremen, Augsburg, Berlin, Mainz … Ich habe ja zum Geburtstag ein Interrail-Ticket für Deutschland bekommen, das ich bald einlösen sollte. Das Buch Netzkarte von Sten Nadolny habe ich auch gerade wieder einmal gelesen, darin kommt ein Ort namens Sterbfritz vor – wirklich wahr, dass es möglich ist! Sterbfritz ist ein Ortsteil der Gemeinde Sinntal im hessischen Main-Kinzig-Kreis – dort muss ich natürlich auch hin!
Als Wolferl im Alt Wien mal am Klo war, sah ich mich um (das Lokal war übrigens so gut wie leer, das haben wir vorher noch nie erlebt!), da fielen mir unter den vielen Plakaten, die an den Wänden hängen, drei auf, über die allein ich stundenlang erzählen könnte:
Hermann Nitsch (ich war einmal auf einem der Dreitagefeste seines „Orgien Mysterien Theaters“, ich sage nur: quasi drei Tage durchgemacht …)
Helmut Qualtinger (ich durfte für Deuticke das Buch Best of Qualtinger präsentieren, ich konnte damals urviel von ihm auswendig – ging meiner lieben Frau total auf die Nerven damit …)
Die Strottern (Neues Wienerlied-Duo, wir hatten mehrere Auftritte zusammen, ich las dabei immer aus meinem Buch Frau Grete und der Hang zum Schönen …)
Schluss! Aus! Basta!
Wie geht es weiter?
Treffen wir uns einmal im wirklichen Leben?
Die Welt geht unter, der Brief nicht.
Von Courtney Barnett singe ich auch gern Lieder, aber jetzt höre ich mir lieber eines von ihr an – das mit dem Text: „I feel stupid / I feel useless / I feel insane …“
Während ich dir schreibe muss ich zwischendurch immer wieder an ein Zitat von Nora Ephron denken: „Den Tiefpunkt des Alters, das Reich der Anekdote habe ich noch gar nicht erreicht, bin aber auf dem besten Weg dorthin.“
Ich habe in meinem Leben Briefe geschrieben, immer wieder, nach denen ich dachte, jetzt kann ich sterben, in dem Sinn: es ist vollbracht, mehr geht nicht.
Das noch: Unser Sohn war zu Besuch, es gab Suppe und Flammkuchen, er erzählte u.a. davon, dass er geritten sei. Eine seiner Freundinnen hat ein Pferd, das wohnt in einem Stall in Süßenbrunn … Es war das erste Mal, dass er geritten ist, er habe auch „gekuschelt“ mit dem Pferd, also Kopf an Kopf gedrückt. Die Freundin hat auch einen sympathischen Hund, mit dem ging unser Sohn während der Corona-Zeit immer wieder spazieren. Ich habe letztens einmal überlegt, was für Tiere mir in Wien quasi in freier Wildbahn schon begegnet sind: Fliege, Biene, Wespe, Gelse, Spatz, Krähe, Weberknecht, Hund, Katze, Spinne, Maus, Marder, Biber, Fuchs, Ratte, Reh, Rehbock, Feuerkäfer, Dachs, Eichhörnchen, Wildschwein, Falke, Pferd, Ente, Fisch, Schildkröte, Schwan, langweiliger Aufzähler …
Beim Bügeln hörte ich die Kinks, und als in einem Lied die Zeile kam: „There’s to much on my mind and there is nothing I can do about it“, sagte ich laut: „Me too!“ Ich bügle gern, Iggy Pop tut lieber Staub saugen, wie er in einem Interview meinte, der wilde Hund … Wolferl erzählte, den härtesten Gig, den er je erlebt habe (und er hat ca. 100.000 Gigs erlebt, und zwar weltweit: England, USA, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich usw.), sei einer von den Kinks gewesen. Deshalb hörte ich die Kinks zum Bügeln … Ich trage mich mit dem Gedanken, W. irgendwann zu seinem Leben zu befragen, mit eingeschaltetem Aufnahmegerät. Er hat viel erlebt, er kann pointiert, witzig, originell und scharf formulieren … Die Köchin unseres Heurigen, die Frau Grete, habe ich damals auch interviewt und daraus das Buch Frau Grete und der Hang zum Schönen gemacht … Wolferl würde ebenfalls sehr viel hergeben. Vielleicht, vielleicht, dann würde ich es besser machen als bei der Frau Grete, weil da habe ich’s ein bisschen vermasselt – man hätte viel mehr daraus machen können. Leider, leider, da habe ich eine Chance vertan, obwohl manche sagen, das sei mein bestes Buch (Ahhhh!!!!), aber das würde jetzt zu weit führen, und der Brief soll doch nicht zu lang werden. Vielleicht sollte ich bald das Märchen vom Widerl schreiben …
Marjana, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
In Zukunft werde ich wieder mehr meiner Mutter (82) und meiner Nichte (13) schreiben, und all den anderen …
Vielleicht bekommen wir auch heuer wieder das Stelzenhäuschen in Kritzendorf, das ich gern Kritzeldorf nenne (weil ich dort viel kritzle) oder Kratzendorf (wegen der Gelsen) – aber wie gesagt, die Gelsen waren nie besonders störend – kein Vergleich zu den Heuschrecken in Afrika, du meine Fresse! Hast du von diesen Heuschreckenschwärmen gehört, die alles wegfressen, Schwärme, die z.T. eine Fläche haben so groß wie Vorarlberg … Unglaublich! Also dagegen sind die Gelsenschwärme in Kritzendorf ein Witz (Witzendorf zu schreiben, verkneife ich mir).
Ich sollte an meinem neuen Buch arbeiten!
* * *
Dein heiß ersehnter Brief (lass mich das so sagen) ist gerade gekommen, ich bin entzückt! – Nein, immer noch nicht. Aber ich warte gern, das erinnert mich alles an diesen Sommer vor vielen Jahren …
An einem Sonntag vor kurzem im Garten meiner Schwestern in Fischamend:
Wir schossen mit Pfeil und Bogen. Mir gelang ein Meisterschuss, den kein Meisterschütze je wird wiederholen können: Ich schoss neben Zielscheibe, Styroporplatte und Holz voll in die Mauer und von dort prallte der Pfeil ab und flog in einen Baum, wo er mit der Spitze nach oben an einem Ast hängen blieb. Ich habe den historischen Treffer fotografisch dokumentiert. Was ist dagegen schon ein Treffer ins Schwarze?
Aus dem Buch Demnächst mehr – Das Buch der Briefe, das ich inzwischen bekommen habe, hier was von Gottfried Benn, das er ans Ende eines Briefes gesetzt hat: „Langer Brief! Noch viel zu viel Worte! Was für Wesen noch um dies alles! Wie vergangen das Ganze! Musik bleibt wohl länger wie Worte, nur Musik! / Herzlich: / Ihr / Benn“. U.a. deshalb werde ich mich bald auf meine musikalische Karriere konzentrieren und endlich voll durchstarten. Ein junger Shooting Star werde ich wohl nicht mehr, aber was ich unbedingt noch schaffen will: Gigs im ganzen Land und darüber hinaus, anfangs allein, aber bald schon mit Band und und und. – Ein alter Jugendtraum, den ich mir jetzt verwirklichen werde, da fährt der Tourbus drüber, yeah! Demnächst mehr beginnt übrigens so: „Geehrte Leserinnen und Leser, wann haben wir unseren letzten drei-, gar fünfseitigen Brief geschrieben?“ Ich musste schmunzeln. „Von Hand, versteht sich …“ Und da musste ich an einen Brief denken, den ich vor vielen Jahren meinem Bruder geschrieben habe, der damals bei der Militärmusik war. Er öffnete das Kuvert, holte den mit Schreibmaschine getippten Brief hervor, worauf gleich einer seiner Zimmergenossen, der gesehen hatte, dass der Brief nicht handschriftlich war, ausrief: „So ein unpersönlicher Brief!“, worauf ihm mein Bruder gleich den Anfang meines Briefes vorlas: „Lieber Gerald, welcher Idiot sagt da, ein getippter Brief könne nicht persönlich sein …“ Eines meiner Lieblingslieder der letzten Jahre war Military of the Heart von naked lunch – ich weiß nicht, wie oft ich das Lied gehört und noch viel öfter selber gesungen habe. Ja, ich will in Zukunft vermehrt mit Gitarre auftreten und singen aus voller Brust. Mein Bruder wird keine Freude damit haben, ich könnte mich Fucek nennen, damit es zu keinen Verwechslungen kommt.
Rüdiger Görner: „Lange oder kurze Briefe – das ist eine Frage des Mitteilungsbedürfnisses oder des Taktes (wie viel soll man Anderen von sich selbst zumuten?)“ – Da war doch was mit Taktgefühl, was war das nur?
Rahel Varnhagen 1828 am Schluss eines Briefes an die Fürstin von Pückler-Muskau: „Fast möchte ich mich sehr dieses langen Schreibens wegen entschuldigen.“ – Schön gesagt.
Ich will ein Märchen schreiben über Arthur, Fritz und Miles, Arbeitstitel: Die glorreichen Drei.
Ich will auch eines schreiben über jemanden, der sehr gern Briefe schreibt und dessen Traum in Erfüllung geht: dass er für das Schreiben von Briefen bezahlt wird. Manche zahlen pro Seite, andere zahlen einen Fixpreis für fünf Briefe im Monat, wieder andere zahlen für einen Brief erst ab Seite 20 etwas …
Er schreibt auch Briefe zu besonderen Anlässen.
Jedenfalls schreibt er täglich Briefe von früh bis spät, denn er ist nicht ganz bei Trost.
* * *
- Juni
Dein Brief ist gekommen, ich bin tief entzückt! (Das „denn er ist nicht ganz bei Trost“ oben habe ich erst nach der Lektüre deines Briefes hinzugefügt.)
Und ich bewundere dich! Und ich beneide dich! Und ich will dir unverzüglich antworten:
Dass die Gösser Bierinsel einmal dein Lieblingslokal war, ist ja unglaublich! Ich war immer wieder dort, habe aber leider nie dich getroffen, sondern nur z.B. einmal den schon erwähnten Herrn Nüchtern, der seine Nase in eine großformatige deutsche Zeitung steckte und mir durch seinen Anblick den ganzen Tag verdorben hat … Hinweg mit dir, böser Nüchtern! Da fällt mir ein, eines meiner „Fliegen-Gedichte“ ist in der Bierinsel entstanden, es hat den Titel Gustiöse Männer im Hochsommer und ist recht unappetitlich … Schön, was du über die Winterabende dort schreibst! Ich nehme mir vor, diesen Ort so bald wie möglich wieder einmal aufzusuchen.
Arthur geht es gut, das freut mich! Und was vor ihm liegt, klingt auch gut: Gisela, Loulou oder die Philosophin der letzten Geheimnisse – ich würde Arthur entscheiden lassen. Aber vielleicht wird es ja eine Melange à quatre, ich meine natürlich Ménage!
Ich beneide dich um Arthur – ich hätte auch gern einen Arthur! Zu unserer neuen Fliege habe ich keinen Draht gefunden, sie auch nicht zu mir, wir leben gleichgültig nebeneinander her …
Ich bewundere dich, weil du ein Pferd eingefangen und dadurch Unheil verhindert hast! So ein berauschendes Erfolgserlebnis hätte ich auch gern, aber ich war eigentlich immer ein Angsthase, eine Memme …
Schreibe wild und gefährlich, Artur.
Vom braven Anton musst du mir auch einmal erzählen.
Ich habe gerade das Buch Ich erwarte die Ankunft des Teufels von Mary MacLane gelesen. Gegen Ende des Buches schreibt sie über das Lied „Mariana“ (so ein Zufall!) von Alfred Tennyson: „Den ganzen Tag kreist und schwimmt dieses das Herz krank machende Lied von Mariana in meinem Kopf herum. Ich wache früh am Morgen damit auf, und jetzt zur späten Stunde ist es immer noch in mir.“ – Sie zitiert aus dem Lied, ich will aber was anderes zitieren aus dem Buch, in dem ich viel angestrichen habe: „Ich bin meiner selbst müde. Immer ich, ich, ich. Aber es geht nicht anders.“ Und vielleicht das auch noch: „Ich schreibe der Anemonendame eine Menge Briefe. Manche schicke ich ihr und manche behalte ich mir, um sie selbst zu lesen. Ich lese gerne Briefe, die ich geschrieben habe – besonders die, die ich ihr geschrieben habe.“
Weil ich meinen ersten Brief an dich mit dem Anfang deines Buches Annuschka Blume begonnen habe, dachte ich mir, schau doch, wie das Buch endet, und da war ich schon wieder entzückt und dachte, das passt doch gut an das Ende meines fünften Briefes an dich: „Ich bleibe liegen, die Backe an den Brief gepresst, an wen schreiben? Und was? Und wie? Mein Gott. Das Zimmer schwimmt, und Fische wirbeln wie im Traum umher, im Traum, im Traum, im Traum!“
Falls wir mit dem Zug in die Berge fahren …
Es war mir eine große Freude!
Mit einer Blume in der Hand für dich,
Christian
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten: Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 7: naiv beobachte ich …
weiter ...10.– 12. Juni 2020
liebe antonie
naiv beobachte ich: wenn läuse im holder überhandnehmen, kommen früher oder später marienkäfer und holen sich die läuse. ich neige dazu, an ein prinzip der resilienz zu glauben. widerstand, der zuerst abseitig aufflackert und sich mit zunehmender unwiderstehlichkeit luft verschafft. die zwei sätze «i can’t breathe» und «i want you to panic» haben sich einem tief ins herz eingebrannt. der mord an george floyd war def. einer zuviel: die bürgerrechtsbewegung «black lives matter» gegen rassismus und polizeiwillkür in den USA wird sich durch keine «law and order»-doktrin unterdrücken oder aufhalten lassen. die wucht der strasse tut das übrige. der kniefall ist zu einer geste des protestes geworden. – die niederträchtige politik von trump, bolsonaro & konsorten, die sich trotz virulenter krise hemmungslos um nichts anderes als den eigenen machterhalt kümmern, wird bald ein ende haben. diese hoffnung hege ich. die pandemie nehm ich gleichzeitig wahr als die unerbittliche, selbstverschuldete nemesis für das, was dem planeten im anthropozän zugemutet wurde. noch verschlimmert die eklatante unfähigkeit der entbehrlichen demagogen die lage. die zwei sätze jedoch pochen auf veränderung und entscheidung. der kippzustand ist erreicht. wir werden sehen.
«il faut cultiver notre jardin». was bleibt uns anderes, als den eigenen garten zu bestellen? resilienz zu üben? phantasie zuzulassen? sich um die elementare flamme zu kümmern, gegenstrategien zu kultivieren? ich frage, was vermag kunst auszurichten? in welcher reichweite? wo ansetzen? – wenn kunst anderes sein will als ein blosser kommentar. mit der vergeblichkeit von kunst zu kokettieren, kommt mir nicht im traum in den sinn. den verlorenen posten gibt es nicht. für wen wäre kunst vergeblich? im gegenteil, al rovescio, sie hat mit bewohnbar- oder urbarmachung zu tun.– ich betrachte sie als grosse, notwendige möglichkeitsform + verwandlerin, als leise trotzende gegenkraft zur gravität des faktischen, als opposition und dezidierte dissidenz, freilich mit andern mitteln. sie „operiert“ als zauberkunst im umfassenden sinn, sie legt hand an, sie verwandelt, was sie berührt, flickt am zerrissenen tuch des humanen, stopft nicht bloss löcher, sondern öffnet subtile gegenwelten, erzeugt con ostinato rigore selbst noch unter dem vorwand der reparatur verheissungsvolle sinnbilder. gerhard meier fand den paradoxen satz: «kunst ist auf einem schwarzen schimmel zu reiten».
ich beobachte den regen und verscheuche mir die schafskälte mit lektüre: «nicht müde werden, sondern dem wunder, leise, wie einem vogel die hand hinhalten» (hilde domin). lesen als vergewisserung des eigenen stands. zum beispiel die gedichte von marion poschmann: wie sie es anstellt in der «geliehenen landschaft», im untertitel als «lehrgedichte und elegien» bezeichnet, in leichtem anflug, aufgewühlter in «nimbus», ihrem jüngsten lyrikband, gletscherschwund + artensterben als innewohnenden klimawandel auszuloten. in selbstinklusion, ohne dringlichkeitsappelle. sie tut es mit bedacht, genau, in der radikalität und stillen insistenz von lyrik. poesie, von der johann georg hamann in seiner «aestetica in nuce» souverän behauptet: «Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Gartenbau, älter als der Acker: Malerey, – als Schrift: Gesang, – als Deklamation: Gleichnisse, – als Schlüsse: Tausch, – als Handel». marion poschmann zitiert diese passage vor dem gedichtzyklus «Bernsteinpark Kaliningrad».
wir begannen unser gespräch mit blühenden birnbäumen. das gespräch über bäume ist wieder möglich, auch wenn uns bald anderes blühen dürfte. es fällt einem schwer, von keinem verschwinden zu berichten. die schwindenden
ereignisse begleiten einen auf schritt und tritt. man kann es nicht einmal mehr als begleiterscheinung des älterwerdens beschwichtigen. die zäsuren sind da, ereignen sich in tagtäglicher beobachtung. es ist nicht gesagt und jedenfalls keine selbstverständlichkeit, wenn sich raupen noch verpuppen. der boskop in der hausbündt, der uns letztes jahr mit einer unerhörten fülle von äpfeln beschenkte, lässt heuer aus. er hatte kaum blüten. kunststück, wir haben ihm einen februar-schnitt verpasst. nun, der baum wird sich hoffentlich erholen und zu erneutem (biennalen) wurf ausholen, davon möchte ich ausgehen.
gestern, an fronleichnam, – in der kindheit gabs an diesem landläufigen feiertag die schier endlose prozession auf die felder, wo (fast) jedes feldkreuz gesegnet wurde – was am ende belohnt wurde durch das verteilen eines knusprigen „püürles“ der bäckerei lingg in schaan – , gestern also, haben wir eine ausfahrt nach appenzell unternommen, haben in der «ziegelhütte» die ausstellung von EMMA KUNZ besucht. appenzell, eine abgründig-idyllische gegend, eine landschaft kreisender linien, die immer wieder unvermutet in tobeln mündet.
ein zugänglich, unzugänglicher kanton mit archaischen bräuchen wie dem silvesterchlausen und kauzigem dialekt. durch die tiefliegenden wolken fletschte gelegentlich der alpstein.
ein wort zu emma kunz, die zu lebzeiten als heilprakterin bekannt wurde: sie pendelte und entdeckte das heilgestein des würenloser römersteinbruchs. ihre grossformatigen „kraftfeld“zeichnungen auf millimeterpapier sind eine eigenartige posthume entdeckung, blätter, die sie niemandem zeigte. emma kunz verstand diese arbeit als eigentliche feldforschung, die sie obsessiv betrieb. zu kunst wurden diese zeichnungen posthum von kuntkritikern deklariert. nicht zu unrecht. aber über den status dieser zeichnungen, die in geometrischer form von menschbeherrschenden, bestimmenden kräften, figuren und polaritäten zeugnis ablegen, über diesen status lässt sich trefflich raisonnieren. fraglos sind sie eine kapitale entdeckung. es war kein zufall und ebenso instruktiv wie witzig zu beobachten, wie mir erzählt wurde, als während einer der ersten ausstellung dieser feldzeichnungen von emma kunz im dez. jänner 1975/1976 im CENTRUM FÜR KUNST UND KOMMUNIKATION (CCC) in vaduz, bauern vom grabser berg mit gewundenen villiger-stumpen und mit rucksäcken in die avantgarde-galerie wundern und schnuppern kamen: diese leute kannten emma kunz nur von ihrer heilpraxis …
sie erwähnten gerhart baumann als lehrer ihres leider verstorbenen mannes, sprachen von dessen leuchtenden erinnerungen an celans legendäre lesung am 24. 7. 1967 im audimax von freiburg in gegenwart von martin heidegger. wenige tage später entstand celans gedicht TODTNAUBERG, das von der enttäuschenden begegnung zwischen heidegger und celan spricht, das von einem verfehlten gespräch handelt. der philosoph vermied bei ihrem treffen auf der hütte von todtnauberg ein klärendes, persönliches wort an celan. der philosoph wich aus, als der dichter ihn auf seine naziverstrickung ansprach. heidegger hatte sich öffentlich nie davon distanziert, er blieb unnachgiebig. die schmerzhafte ambivalenz des gegenseitigen verhältnisses wurde umso deutlicher: celan und heidegger lasen einander, aber ihr persönliches verhältnis blieb unnahbar und papieren. ich weiss nicht, ob celan je sein gedicht TODTNAUBERG öffentlich las. es ist im jänner 1968 als exquisiter „primdruck“ in der edition brunidor, paris, herausgegeben von robert altmann, in einer auflage von 50 exemplaren erschienen. die edition kam nie in den handel, wurde unter freunden und einige bibliotheken verteilt. celan sandte heidegger ein exemplar zu. celan zitiert im brief vom 2.2. 1968 – lichtmess bei uns – an robert altmann die zentralen sätze aus heideggers brief vom 30. Januar an celan, wie der philosoph auf den erhalt der sendung von TODTNAUBERG reagierte: «Das Wort des Dichters, das ‚Todtnauberg‘ sagt, Ort und Landschaft nennt, wo ein Denken den Schritt zurück ins Geringe versuchte – das Wort des Dichters, das Ermunterung und Mahnung zugleich ist und das Andenken an einen vielfältig gestimmten Tag im Schwarzwald aufbewahrt. [……] Seitdem haben wir Vieles einander zugeschwiegen.
Ich denke, daß einiges noch eines Tages im Gespräch aus dem Ungesprochenen gelöst wird.»
die schlichte und kostbare edition von TODTNAUBERG hat briefcharakter. robert altmann, mit dem mich eine nachhaltige freundschaft verband, schenkte mir im tausch gegen eine eigene arbeit ein exemplar davon, die nummer 33, signiert vom dichter.
ich war leider zu jung, um celans lesung am 10. aug. 1968 in vaduz mitzubekommen. damals steckte celan, wie er franz wurm schrieb, in seiner „zweitbesten haut“. was wir von robert altmann persönlich erfuhren: celan war den ganzen tag verschwunden, bis zuletzt blieb unklar, ob er überhaupt zur lesung erscheinen würde. für den gastgeber robert altmann war celans aufenthalt in liechtenstein desavouierend bis heikel, ein eigentlicher eiertanz. aber lassen wir das.
…
schön zu erfahren, dass sie einen imker in der nachbarschaft haben, der sie mit honig versorgen wird. ich bewundere leute, die etwas vom imkern verstehen.
passion dafür scheint mir die grundvoraussetzung. – überhaupt, alles von wert, hat wohl diese grundvoraussetzung.
– ich bin erleichtert, dass ich meine gouachen gemalt habe. Ich sende ihnen gelegentlich eine aufnahme davon. – die edition von «der mann in der blüte» beschäftigt mich nach wie vor. ich arbeite am entwurf weiter.
Ich grüsse sie herzlich bei föhnsträhnig mildem tag hinaus ins allgäu.
ob der föhn soweit reicht?
herzlich, ihr hajqu
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Dragica Rajcic Holzner & Julia Weber
Brief 1: Seit gestern Abend weiß ich, dass du meine Briefpartnerin sein wirst, das erfuhr ich ausgerechnet am Geburtstag meines Sohnes, der im gleichen Jahr geboren ist wie du …
weiter ... 12.06.2020 Rogoznica, Kroatien
12.06.2020 Rogoznica, Kroatien
Liebe Julia
seit gestern Abend weiß ich, dass du meine Briefpartnerin sein wirst, das erfuhr ich ausgerechnet am Geburtstag meines Sohnes, der im gleichen Jahr geboren ist wie du, du in Tansania und er in der Schweiz. Man könnte sagen, ihr seid Kinder von Migranten – wann hört man auf Kind zu sein oder Migrant? Ich schreibe auch deswegen du obwohl wir nie eine Sekunde glaube ich geredet haben, nur lächeln im Vorbeigehen erkennen dass man sich kennen sollte durch Bekannte, oder habe ich vor lauter Aufregung in Biel am Literaturinstitut nur die Gesichter meiner Klasse später erkannt? Es ist auch lange Zeit her seit dem, Jahre springen schnell weg.
Ich zögere indem ich die Rahmen stecke, ich habe heute Morgen große Angst öffentlich zu schreiben, vor allem zur Generation meiner Kinder. Das Schuldgefühl irgendwie etwas gut machen zu wollen, irgendwie aus dem eigenen Ungenügen entweder belehrend oder unterwürfig zu werden, sie verkennen oder erkennen aber aus Feigheit lieber sich ducken als das Gedachte zu sagen. Zum anderen öffne ich mit Briefen meine Fenster zu deinen, um auch meine Kinder besser zu verstehen, ohne die ganze Fehlerhaftigkeit ihrer Kindheit als Bumerang fühlen zu müssen. Jetzt sagt eine Stimme, aber Julia ist Schriftstellerin, Mutter, Ehefrau, Freundin, sie selber. Als meine Tochter mich am Radio, wo ich ein Interview gab, hörte, sie war glaube ich sechzehn, sagte sie, kannst du einmal nicht die Wahrheit reden auch am Radio? Die gut formulierende Frau, aber die Mutter, verfremdet durch den Radioapparat, Stimme reduziert nur auf Gedanken ohne umfassenden Blick in unsere Realität, welche im dalmatinischen Dialekt sich abspielte. Aber ich bin Schriftstellerin im Radio, hätte ich sagen sollen, oder habe ich es gesagt?
Ja, wie soll ich auf diesem Seil, falls es ein Seil ist (wenn ich so was schreibe, sage ich, du bist über sechzig), als wäre das eine Formel für irgendetwas Bedeutendes was mich schützen sollte. Gestern schwamm ich im Meer, nicht in irgendeinem Meer, sondern in „meinem“ Meer, nur dreißig Minuten trennten mich vom Meer meiner Kindheit. Ins Meer, bedeutet immer noch für mich, zum Touristen zu werden, jemand anderer, welcher ans Meer kommt um der andere zu sein, leicht, abwesend, mit Sonnenhut. In diesem Ort, wo wir eine kleine Ferienwohnung haben, glauben viele, ich sei Ausländerin, weil ich Deutsch spreche mit H. und blonde Haare habe, wie halt so meistens Ausländerinnen haben.
Ich hab als Kind, bis ich zehn war, bevor wir umgezogen sind, glaube ich, fünfmal im Meer gebadet, jedes Jahr nur einmal. Es lag daran, dass unser Haus auf der Makadam-Straße drei Kilometer vom Meer entfernt war und die Eltern viel zu arbeiten hatten.
Ich war fünf, und mein Bruder drei, der Vater hat ihn auf das Velo vor sich hin gesetzt, und sein Fuß verletzte sich, im Fahrrad eingeklemmt, Blut, Mutters Schreie, eine Ohrfeige bekam sie sofort, die einzige welche ich gesehen habe. Sie eilten zur Ambulanz, und ich blieb mit Großmutter allein zuhause, ich habe meinen Bruder so gehasst weil er mir das erste Mal Im-Meer-Baden versaut hat, später als er zurückkam mit dem Fuß im weißen Verband versteckt, mit geschwollenen Augen vom Weinen, schämte ich mich meines Egoismus. Nicht dass ich damals gewusst hätte was Im-Meer-Schwimmen überhaupt bedeutet, alles Wissen kam nur aus dem Mund der Erwachsenen, und dieses Wissen war nicht verarbeitet für Kinder-Ohren, so musste ich notgedrungen meine Fantasie aufschwellen lassen als ältere Schwester. Das Meer war auch nicht verfügbar für uns wie für diejenigen später aus der Schulklasse, welche durch Fenster zu ihm hin sahen. Meine Eltern kamen in den neuen Ort, vom alten etwa zwanzig Kilometer Luftlinie entfernt, waren Nachfahren der Kleinbauern und Viehtreiber, diese Dörfler konnten nicht schwimmen, schwimmen war für dokoni, dokoni, sagte meine Großmutter, seien die, welche Zeit, Langeweile haben, normale Menschen haben immer was zu tun um am Leben sein zu können.
Du siehst wie ich durch Abwesenheit im Ausland mich dazu zähle zu denen, welche schwimmen sich erlauben dürfen, weil sie nicht Einheimische sind.
Aber jetzt wo die Strände praktisch leer sind, schwimmen die Einheimischen nicht im Meer weil es zu kalt ist, 20 Grad C ist für sie kein Schwimmwasser und wäre H. nicht aus Tirol, käme mir nie in den Sinn, ins Wasser zu steigen. In der Limmat, ich habe zehn Jahre in der Wasserwerkstrasse gewohnt, habe ich selten geschwommen, ich behauptete ich mag die Farbe des Wassers nicht, grün, und ich komme vom Meer, sagte ich, als wäre das ein Qualitätssiegel, wie „Essen Sie nur Biologisches aus der Schweiz“.
Also, ich werde Musilisch – immer im Sommer wenn wir hier sind lese ich den Mann ohne Eigenschaften so stückweise, anders kann man es nicht, wie dass beim So-viel-des-Guten der Kopf aufgeht, er wird schwer, wenn man zu viel von dem auf einmal liest.
Was wollte ich noch mit Schwimmen sagen? Ich bin im Meer zu dir geschwommen, denke, während ich schwimme, über diese Umwandlung des Realen in diesem Meer jetzt mit dem Meer von gestern. Es kam mir in den Sinn was ich dir schreiben könnte – die Heimat dem entsprechend wäre eine Landschaft, aus der ich leichter die Illusionen, Fantasien, Kindheitsbilder herholen, herunterladen kann. Der Dialekt, die Lieder, das Vogelgezwitscher, alles dies sei eine Erinnerung, was ich gedacht, mir vorgestellt habe. Es ist handgreiflich nah und für immer fühlbar, nicht Suche nach der verlorenen Zeit sondern Suche nach dem Erwachen der gleichen Sehnsucht nach einer Zukunft welche sich in einer anderen realen Zukunft aufgelöst hat. Sich sehnen …
Wenn ich nach St.Georgen die Treppe hoch steigen würde, würde ich an das Baumhaus denken welches mein Sohn und Miguel dort gebaut haben noch in der Unterstufe, um sich vor allen zu verstecken bevor jemand sie heruntergerissen hat. St.Gallen ist der Ort der Kindheit meiner drei Kinder, und dort versuche ich mich in sie damals einzufühlen, ja Melinda Nadj Abonji hat mir die Kindheit meiner Kinder nahe gebracht, genau das Verschwiegene, was ich nicht wissen wollte und konnte …!!!??
Liebe Julia, wie immer am Morgen schreibe ich automatisch diesen Brief, damit ich nicht aufgebe, automatisch heißt nicht kopflos, sondern ich versuche nicht Gedanken gerade zu biegen aber ich bin erleichtert über den ersten Brief hindurch gekommen zu sein. Ich stelle mir sehr lebhaft deinen, euren Alltag vor, und es braucht wenig Fantasie zu wissen dass du schön, gut, intelligent, schnell mir antworten wirst, die Rationalität der vorhandenen Zeit zum Schreiben wird deinen Sätzen diese Prägnanz geben welche ich mir mit so viel Zeit wünsche, aber meine Hände sehnen sich auch nach dieser Zeit mit meinen kleinen Kindern, wo ich die Sätze im Kopf glaubte zu speichern für morgen … und jetzt, wo sind sie, vielleicht mit dir kommen sie zurück …
Bis sehr bald,
Deine Dragica

Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 8: Hast du all die schönen Lokale in der Zwischenzeit abgeklappert?
weiter ...Lieber Christian,
hast du all die schönen Lokale in der Zwischenzeit abgeklappert? Die Gösser Bierinsel vor den Toren der Galopprennbahn Freudenau war mal früher mein Lieblingslokal – wegen der Fiaker, Fiakerinnen, Stallknechte & co. Wenn ich das Glück hatte, ihnen an manchem Winterabend bei der Einnahme geistlicher Getränke zuzuschauen, kam ich mir vor, als wären wir alle im 19. Jahrhundert steckengeblieben, als wäre der vorfahrende 77A-Bus eine fata morgana.
Die kleine Spinne Arthur ist übrigens doppelt so groß geworden, hat mehrere Vorratskammern, einen Balkon und einen Tennisplatz. Wenn es so weiter geht, sitzt der gute Arthur bald mit am Esstisch und isst mit Messer und Gabel.
Nun ja, ich stelle fest, 3,5 Monate Isolation bringen mich auf unsittliche Gedanken: Ich möchte Arthur mit einer Gisela oder einer Loulou verkuppeln, und wenn es funkt, einen Spinnenharem für ihn anlegen. Bei uns im Stall habe ich schon ein einsames, rundes Weibchen über dem Lichtschalter gesichtet, das ich mir gut an Arthurs Seite vorstellen könnte. In meiner Bibliothek gibt es auch eine Kandidatin, eine geerdete Philosophin, die ihr Zelt im untersten Regal über dem dicken Bildband „Die letzten Geheimnisse unserer Welt“ aufgeschlagen hatte. Ich hätte sie vermutlich nie entdeckt, wenn meine Katze ihr nicht einen Haarballen „vor die Tür“ ausgewürgt hätte. Ein Wink des Schicksals? Welches Mädchen soll ich nehmen?
Apropos Schicksal. Letzten Sonntag habe ich ein fremdes Pferd eingefangen, kurz bevor es auf die Autobahn rennen konnte. Später hat die Besitzerin erzählt, dass sie mit ihm in den Feldern spazieren war, als sie einer auf sie zugaloppierenden Kuhherde begegneten – ein Graus. Da wäre selbst mein braver Anton abgehauen. Jedenfalls hatten der durchgehende Wallach und einige Verkehrsteilnehmer an diesem Tag sehr viel Glück und ich ein berauschendes Erfolgserlebnis. Zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, ist alles, kann Leben oder Tod bedeuten. Es hat mich schon immer erstaunt, dass der Mensch trotz der Erkenntnis der Unkontrollierbarkeit des Lebens und seiner eigenen Ohnmacht es irgendwie schafft, den Augenblick zu genießen, im Zuckergoscherl eine Melange zu trinken, mit Freunden zu chillen oder zu streiten, Briefe zu schreiben, Pläne zu schmieden und überhaupt bei Trost zu bleiben.
Auf deine Zeilen freue mich und grüße dich herzlichst
Marjana
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale.
Brief 6: Wenn ich deinen Brief lese, sehe ich, dass ich nicht der Einzige bin …
weiter ...Liebe Barbara!
Wenn ich deinen Brief lese, sehe ich, dass ich nicht der Einzige bin, der sonderbare Träume hat. Der Unterschied ist, dass du dich daran erinnerst!!! Ich hatte eine Zeit, so zwischen zwanzig und dreißig, wo ich jede Nacht komische Träume hatte, einige waren regelrechte Filme, verrücktes Zeug bisweilen, aber mit einer klaren Handlung. Und das Überraschendste war, dass ich sie am Morgen beim Aufwachen so präsent hatte, dass ich sie schnell in einem Notizbuch festhielt, einem so wie Moleskine, das ich immer bei mir trug. Ich notierte auch andere Sachen, zumeist visionäre Geschichten, aber auch Ideen für Songtexte. Ich kann eigentlich kein Instrument spielen, aber ich hörte gern Musik. Und das tue ich immer noch…
Ich habe Freunde, die Musiker waren oder die gern und gut Gitarre spielten, einige hatten auch gute Ideen für Akkorde, zu denen man einen Text machen konnte, ich hatte die Gabe des Schreibens (einverstanden, dass es eine Gabe ist, oder, Barbara?) und so hatten wir unseren Spaß daran, Songs zu schreiben, die letztendlich nur wir und noch ein paar Freunde anhörten, die großmütiger als andere waren.
Vorbilder? Damals mit Sicherheit Bruce Springsteen, als er noch nicht kommerziell war, aber auch andere. In den Notizbüchern – vier oder fünf davon bewahre ich in einem Flügel des Bücherschranks im Arbeitszimmer auf, aus dem ich dir schreibe – finden sich neben den Texten dieser Songs auch meine Träume, ja, ich denke, dass in einigen Fällen die Träume mit den Songs identisch waren. Später hat der eine oder andere Traum auch in meine Erzählungen Eingang gefunden, weil die Handlungen so spannend waren; mit der Zeit aber konnte ich mich immer weniger daran erinnern! Beim Aufwachen, in der morgendlichen Trägheit, sind vielleicht noch Spuren da, doch die verblassen mit Lichtgeschwindigkeit, jedenfalls habe ich bald einmal aufgehört, sie in meinen Notizbüchern zu notieren. Eines der letzten Male, dass ich einen Traum verwendete, um daraus eine Geschichte zu machen, ist über fünfzehn Jahre her; dieser Traum hatte sich mir so stark eingeprägt, dass ich ihn, glaube ich, tagelang sedimentieren ließ: Die Geschichte ließ mich nicht mehr los, sodass eine lange, ausgefeilte Erzählung daraus wurde, etwas für die Psychoanalyse. Das heißt, ich wandte mich schließlich an einen befreundeten Psychologen, um ihn zu fragen, ob das, was ich da schrieb, irgendwie plausibel war, auch wenn ich keine Ahnung von der Materie hatte. Er versicherte mir, dass die Geschichte okay war.
Da habe ich sie niedergeschrieben, sie dann aber in der Schublade gelassen und nur einen ganz kleinen Teil davon verwendet, eine Geschichte für sich in einer größeren, umfassenderen Geschichte.
Ein andermal – eigentlich das letzte Mal, dass ein Traum von mir als Grundlage für eine Geschichte diente – hatte mich ein befreundetes Paar zu einem Wochenende im Apennin von Parma eingeladen, und ich war am Morgen der Abfahrt mit einem verrückten Traum aufgewacht. Um ihn nicht zu vergessen, sagte ich ihn während der ganzen Hinfahrt vor ihnen her. In der folgenden Nacht verbrachte ich Stunden damit, die Geschichte im Notizbuch niederzuschreiben, wobei ich bereits eine Erzählung daraus machte, indem ich andere Elemente hinzufügte. Eine komische Erfahrung, da meine Geschichten, abgesehen von den Sachen mit den Notizbüchern, immer auf einer Schreibmaschine und später auf der Tastatur eines PC entstanden. Auch diese Geschichte blieb in der Schublade, ich glaube aber nach wie vor, dass es eine sehr gute Geschichte ist. Das Problem ist, dass ich, um sie zu veröffentlichen, noch ein paar andere solche schreiben muss.
Ich rede zu viel über das Schreiben.
Um auf die Träume zurückzukommen, es hat mich erstaunt, dass du ausgerechnet kurz davor von den Orcas geträumt hast, als ich dir über Wale zu schreiben begann. Ich kann dir verraten, dass ich oft von ihnen und davon träumte, neben ihnen herzuschwimmen, vor allem zu den Zeiten, wo ich auf Whale-Watching-Tour ging. Ich träumte aber nicht von Orcas, sondern von Buckelwalen, die bekanntlich keine Zähne haben und uns nicht in die Beine beißen können!
Was der Traum bedeuten könnte, den du hattest, da kann ich dir, glaube ich, nicht weiterhelfen, auch wenn es sicherlich damit zu tun hat, dass wir Menschen unvollkommene Wesen sind (wie wir uns bereits geschrieben haben) und uns als solche sehr beeinflussen lassen, auch wenn wir uns einer Sache sicher zu sein glauben. Du bist offensichtlich von Natur aus nicht misstrauisch. Du spieltest nämlich mit den Orcas, als ob es das Natürlichste der Welt gewesen wäre, doch es genügte, dass die Personen, mit denen du zusammen warst und die du übrigens nicht kanntest, in Panik gerieten, um dich misstrauisch zu machen, in Angst zu versetzen.
Das hängt nicht von dir ab. Das ist die menschliche Natur. Ich erinnere mich, wie eines Abends, als ich noch klein war, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, ein mit meinen Eltern befreundetes Paar zu uns nach Hause kam: Es war die Nikolausnacht und als sie kamen, erzählte mir der Freund meines Vaters, dass sie unterwegs dem Nikolaus und dem Krampus begegnet waren. Die Beschreibung, die er vom Krampus gab, war dermaßen glaubhaft und fürchterlich, dass ich in jener Nacht lauter Albträume von richtig bösen Teufeln hatte, die mir wehtaten. Es war eine schreckliche Nacht, an die ich mich auch noch nach über einem halben Jahrhundert erinnere!
Ebenfalls als Kind hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum: Das Haus, in dem wir wohnten, war eines jener typischen Häuser aus den Sechzigerjahren, mit langen Fluren und den Zimmern, dem Bad und der Küche, die alle zur gleichen Seite des Flurs hin lagen. Mein Kinderzimmer war das erste gleich hinter dem Wohnungseingang, jenes meiner Eltern das letzte. Sie hatten mir immer aufgetragen, vorsichtig zu sein, mich nicht auf der Straße aufzuhalten, in ihrer Nähe zu bleiben, denn es trieben sich Kinderräuber herum. Das ging mir nicht mehr aus dem Sinn, sodass ich eine Zeit lang träumte, dass sich die Eingangstür öffnete und ich eine schwarz gekleidete Gestalt sah, in der ich im ersten Augenblick eine Tante von mir erkannte, die Nonne war. Wenn ich ihr dann entgegenging, wurde mir bewusst, dass sich die Konturen veränderten und nicht sie es war, die das Haus betrat, sondern eine schwarz gekleidete Frau, die mich mitnahm. Da begann ich laut nach meinem Vater zu rufen, der jedes Mal aus dem Bett sprang und herbeieilte, um mich zu trösten. Irgendwann war der Albtraum so beständig und deutlich geworden, dass die Frau in Schwarz schließlich überhaupt nicht mehr wie die Tante aussah und gleich beim ersten Erscheinen eine Kinderräuberin war.
Ich komme ins Plaudern … und womöglich sind diese Geschichten überhaupt nicht interessant, doch mit dem Lesen deines Traumes ist ein Unterholz von Erinnerungen und Gedanken in Bewegung geraten, das mich hierhergeführt hat.
Bevor ich dich grüße, möchte ich dir jedenfalls sagen, dass ich nach wie vor träume. Die Pandemie hat meine Träume sicher nicht vertrieben. Nicht nur, ich glaube, es waren immer nur Träume, niemals Albträume, obwohl man sie angesichts der Zeit, die wir gerade durchleben, als solche hätte einstufen können. Natürlich kann ich mich an die Handlungen nicht erinnern, doch eines kann ich versichern, Barbara, es waren Träume voll mit Menschen, übervoll, zweifellos bedingt durch die Zwangsisolation, der wir uns unterziehen mussten.
Es ist Zeit, mich für heute zu verabschieden, Barbara, pass weiterhin auf dich auf.
Aloha und bis bald,
Paolo
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Terza lettera / Lettera 6: Leggendo la tua lettera vedo che non sono l’unico …
weiter ...Cara Barbara!
Leggendo la tua lettera vedo che non sono l’unico a fare sogni strani. La differenza è che tu te li ricordi!!! Io ho avuto un periodo, tra i venti e i trent’anni, in cui facevo sogni pazzeschi tutte le notti, alcuni erano veri e propri film, strampalati a volte, ma con una trama ben precisa. E la cosa più sorprendente era che al mattino quando mi svegliavo li avevo così bene impressi nella mente che mi affrettavo a scriverli su un quadernetto, tipo Moleskine, che mi portavo sempre appresso. Scrivevo anche altre cose, per lo più cose visionarie, ma anche tentativi di canzoni. In realtà io non so suonare niente, ma mi piacevano le canzoni. E mi piacciono ancora…
Ho degli amici musicisti, o che semplicemente si dilettavano suonando la chitarra a buon livello, un paio avevano anche delle buone idee di giri di accordi su cui mettere un testo, io avevo il dono della scrittura (sei d’accordo che sia un dono, vero Barbara?) e così accadeva che giocassimo a scrivere le canzoni, canzoni che alla fine venivano ascoltate solo da noi e da qualche amico più magnanimo degli altri.
I modelli? Di sicuro a quell’epoca c’era Bruce Springsteen, che non era ancora commerciale, ma anche altri. Sui quadernetti, ne ho quattro o cinque conservati in un’anta della libreria dello studio da cui ti scrivo, insieme ai testi di queste canzoni ci sono anche i miei sogni, anzi credo che in un paio di casi i sogni siano coincisi con le canzoni. In seguito qualche sogno è finito pure nei miei racconti, tanto la trama era avvincente; poi però ho cominciato a non ricordarmeli più! Magari al risveglio, nel torpore mattutino, qualche traccia resta ancora ma sbiadisce alla velocità della luce, e comunque ad un certo punto ho smesso presto di trascriverli sui miei quadernetti. Una delle ultime volte che ho usato un sogno per costruirci su un racconto è stato più di quindici anni fa, era un sogno che mi era rimasto impresso talmente tanto che credo di averlo fatto decantare per giorni: la storia ce l’avevo così appiccicata addosso che ne è venuto fuori un racconto lungo, elaborato, roba da psicanalisi. Nel senso che ho finito per chiedere consulenza ad un amico psicologo per sapere se le cose che stavo scrivendo potessero essere plausibili in qualche modo pur non avendo io nessuna cognizione della materia. Mi rispose che la storia ci poteva stare.
Così l’ho scritta, lasciandola poi però nel cassetto, usandone solo una parte minima, una storia a sé all’interno di una storia più grande e articolata.
Un’altra volta, in assoluto l’ultima in cui un mio sogno è divenuto la base di una storia, è successo che una coppia di amici mi avevano invitato a trascorrere il fine settimana sull’Appennino Parmense e la mattina della partenza mi ero svegliato con un sogno pazzesco. Per tutto il viaggio di andata gliel’ho raccontato per non dimenticarlo, nella nottata successiva, armato di penna e quadernetto ho passato delle ore a trascrivere la storia, facendola già diventare narrazione, inserendo altri elementi. Un’esperienza curiosa visto che a parte le cose dei quadernetti le mie storie sono sempre nate su una macchina da scrivere e in seguito sulla tastiera di un PC. Anche questa storia è rimasta nel cassetto, ma continuo a credere che fosse molto buona. Il problema che per metterla in volume devo scriverne altre così.
Sto parlando troppo di scrittura.
Tornando ai sogni, mi ha colpito che tu avessi sognato le Orche proprio poco prima che io cominciassi a scriverti di balene. Ti confesserò che a me è successo spesso di sognarle e di nuotarci a fianco, soprattutto a ridosso dei periodi in cui ho avuto occasione di fare whale watching. Però non sognavo le Orche, bensì le Megattere che notoriamente non hanno denti e non possono mordere le gambe!
Quanto a cosa possa significare il sogno che hai fatto, non credo di poterti essere d’aiuto, anche se sicuramente ha a che fare col fatto che noi esseri umani, non essendo perfetti (come ci siamo già scritti) siamo molto influenzabili, anche quando pensiamo di essere determinati nel pensare una cosa. Tu evidentemente, per la tua natura, non sei una persona diffidente. E infatti giocavi con le Orche come se fosse stata la cosa più naturale del mondo, ma è bastato che le persone con cui eri, per altro degli sconosciuti, si siano messe in allarme per renderti più diffidente, per impaurirti.
Non è una cosa che dipende da te. È la natura umana. Ricordo che da bambino, potevo avere quattro o cinque anni, una sera venne a casa nostra una coppia di amici dei miei genitori: era la notte del Nikolaus e quando arrivarono, l’amico di mio papà mi raccontò che per strada avevano incontrato il Nikolaus e il Krampus. La descrizione che fece del Krampus era talmente credibile e terribile che quella notte feci solo incubi con diavoli cattivissimi che mi facevano male. Fu una notte tremenda che ricordo ancora ad oltre mezzo secolo di distanza!
Sempre quando ero bambino mi capitava di fare un incubo ricorrente: la casa in cui abitavamo era una di quelle case tipiche degli anni sessanta con i corridoi lunghi e le stanze, il bagno e la cucina che si affacciavano tutti sullo stesso lato del corridoio. La mia cameretta era la prima che si incontrava entrando nell’appartamento, quella dei miei genitori l’ultima. Loro mi avevano sempre raccomandato di stare attento, di non fermarmi per strada, di stare vicino a loro perché in giro c’erano i ladri di bambini. La cosa mi era entrata in testa così prepotentemente che per diverso tempo ho sognato la porta d’ingresso che si apriva e vedevo entrare una persona che vestita di nero che lì per lì identificavo con una mia zia suora, poi mentre le andavo incontro mi rendevo conto che i contorni mutavano e non erano lei ad entrare in casa, bensì una donna vestita di nero che mi portava via. Allora cominciavo a chiamare forte mio papà che puntualmente balzava giù dal letto e mi veniva a consolare. Ad un certo punto l’incubo era diventato talmente ricorrente e definito che la donna in nero aveva addirittura smesso di avere le sembianze della zia ed era fin dal suo primo apparire una rapitrice di bambini.
Mi sto dilungando un po’… e magari queste storie non sono nemmeno interessanti, ma leggere il tuo sogno ha messo in movimento un sottobosco di ricordi e di pensieri che mi ha condotto fin qui.
Prima di salutarti ti dirò che comunque continuo a sognare. La pandemia non ha fatto certo sparire i miei sogni. Non solo, credo siano sempre stati solo sogni, mai incubi, nonostante il periodo che stiamo attraversando li avrebbe potuti far classificare così. Ovviamente le trame non le ricordo, ma posso assicurarti una cosa Barbara, erano sogni zeppi di persone, affollati, sicuramente determinati dall’isolamento coatto a cui siamo stati sottoposti.
È tempo di salutarti Barbara, per oggi, continua ad aver cura di te.
Aloha e bis bald
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 6: Sollten wir nicht Voltaires Worte befolgen? …
weiter ...Weiler im Allgäu, den 4.6.2020 nach Pfingsten
Lieber Hansjörg,
sollten wir nicht Voltaires Worte befolgen?
… il faut cultiver notre jardin“,
heute Morgen riefen die Wildtauben früh, es ist kühl, ebenso die Farbigkeit der Landschaft in ein fremdes Grün getaucht.
Auffahrt und Pfingsten sind vorüber. Pfingsten – früher mit dem weißen Blütenwehen und jetzt schon die Pfingstrosen verblüht!
„Es wird nie mehr so sein wie vordem…“, ist zu lesen, zu hören.
Natürlich wird es nie mehr so sein! Trotzdem mahnt mich die Trockenheit auch hier im Allgäu, der Verlust der Vogelarten, der Insekten…
Wohin gehen wir mit unseren täglichen Entscheiden? Wohin wollen wir gehen?
Läuse find ich zuhauf an den Rosen, ein toter, auf dem Rücken liegender Maikäfer auf dem Gartentisch, der erste den ich wiedersah nach Jahren, der aufgebrochene Wolkenhimmel über den Hügeln, pastos, zerbrechlich wie der Anschlag der Tasten auf dem Cembalo. Wird Regen kommen?
Wird wieder eine sogenannte Normalität sein? Öffnet sie uns die Tür und tritt sie ein?
In der Tageszeitung sind heute Joe Bidens Worte abgedruckt, als er die Schutzmaske vom Gesicht nimmt und in die Kameras blickt: „Ich kann nicht atmen“. Die letzten Worte George Floyds. Wie ein Echo treffen sie ins Herz!
Ich denke an Hölderlin und Celans Worte:
„Und was du hast, ist Athem zu holen.“
„Atem, das heisst Richtung und Schicksal.“
Umso mehr ist da dieser Drang, den Ort zu wechseln, in Kommunikation zu treten mit etwas, das Hoffnung verheißt.
Damit das Viele uns nicht mehr erdrückt, der unhörbare Ruf der Taube hörbar wird und das Verstummen der Vogelrufe endet…
Alles hat seine Zeit, sagt Kohelet.
Und wie ein Echo erscheint mir Heideggers Randbemerkung zu Celan:
„Warum nicht endlich sagen, Wirklichkeit will gesucht und genommen sein.“
Es kommt Licht ins Wolkengetümmel, das Grau weicht dem Himmelsblau.
Sie schrieben „white matter: white matters!“
Dann die „Augenweiden“ Ihrer Landschaft mit den Magerwiesen, den intakten Bergdörfern, dem Heuduft, den alten, erhabenen Sakralbauten, den Steinmauern, wanderten mit Ihrer Büchergabe auf den weißen Gartentisch und eröffnen mir Ihr Tun in dem Namen Eupalinos und Ihre Freundschaftskultur, die mir auch in dem wunderbaren Film von Bruno Monguzzi lebendig wird. Ich holte die Bücher Hans Brockhages hervor. Wir lernten uns kurz nach der Wende kennen.
Sie schrieben, wer im Sichtbaren arbeitet, muss sich seiner Mittel bewusst sein, und setzten dazu Koroliovs Spiel in Verbindung und ich Brockhages Worte, dass ein Stück Holz
vor allem eine Idee ist, ein Ruf sein kann – ein Rezitativ:
„Es kann vom „Lied der Hirsche“ erzählen – von dichten Wolken, die den Raum durchqueren und ihm widerstehen.
Eine Kraft sein, unnachgiebig wie eine Form, ein Ding, ein Ziel.
Ein Ziel oder das Zielen. Wie ein Bogenschütze – um ins Schwarze zu treffen.
Man muss lange sein Material herausgefordert haben – vertraut sein den Schnitten und Netzwerken, den Formen und Rhythmen der Natur, sagt er.
Geschieht dies nicht auf ähnliche Weise in jeglicher Kunst, und erfahren wir dabei, dieses Eintreten in die Zeit diesseits der Zeit, wie Blanchot sagt? In den Ur-sprung?
Wie geht es Ihren Projekten? Konnten Sie das „Herzblut“ spenden und die Edition fertigstellen zum „Mann in der Blüte“?
Ihrem Altmann Projekt Quaderno III, das ich wie verzaubert am Pfingstmontag las, wollte ich noch eine persönliche Notiz hinzufügen. Gerhart Baumann war der Lehrer meines verstorbenen Mannes. Er erzählte mir des Öfteren von jener legendären Lesung Celans im Auditorium maximum am 24.7.1967.
Sind es nicht doch immer auch die Orte, wo man niemals ganz dort ist? Vielmehr an mehreren Orten zugleich, und malt sich der Mensch von diesen verschiedenen Orten nicht ein Bild oder zeichnet er nicht auch eine Landkarte, in der er wohnen kann? Marbacher Magazin /2001
Nun ist die Schafskälte da, nicht nur die äußere, auch die innere. All die Geschehnisse sind da, die man nicht fassen und fühlen kann.
Die Grenzen öffnen sich heute zu Italien hin, Grenzen sind sehr sensibel, wenn man sie zur Unzeit übertritt, wie den Gartenzaun, dann spürt man jene Zerrissenheit bis hinein ins Körperliche.
Der Regen ist gekommen, der angekündigte.
Auf dem Garagendach meines Nachbarn sind seit heute Bienenstöcke aufgestellt. Er gesteht mir seine Leidenschaft zu Bienen. „Nächstes Jahr, vielleicht, gibt es Honig“, sagt er, „die Bienen sind jetzt noch zu jung, nächstes Jahr!“ Und eine Freundin bringt mir noch gegen Abend ein Glas Honig vorbei, ebenfalls von einer Freundin, die Imkerin ist.
„In diesen Zeiten brauchen wir doch allen Honig, wir alle!“, sagt sie und lächelt.
Über die geöffneten Grenzen hinaus,
grüß ich hoffnungsvoll hinüber nach Schaan,
Antonie
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 5: Nur das Wissen über die Vergangenheit lässt uns die Gegenwart verstehen …
weiter ...Lieber Paolo!
Nur das Wissen über die Vergangenheit lässt uns die Gegenwart verstehen und die Zukunft bewusst gestalten. Das Erzählen von Geschichten, wie du es dir zu deiner ganz persönlichen Lebensaufgabe gemacht hast, ist mehr als nur ein unterhaltsames oder informatives Weitergeben von Persönlichem und Informativem – es ist die Essenz dessen, was wir Menschen seit Millionen von Jahren machen, um das Wissen und die Erfahrungen der älteren an die jüngeren Generationen weiterzugeben, somit einen Überlebensvorteil zu schaffen und die Grundlage jeglichen Fortschritts überhaupt erst zu ermöglichen. Museen sind Orte der Erinnerung und des kollektiven Bewusstseins, die uns das Reflektieren unserer Wurzeln, aber auch unserer heutigen und künftigen Lebensrealität lehren. Ich finde, du hast einen sehr schönen und äußerst wichtigen Arbeitsplatz, Paolo.
Keine Geschichte ist wichtiger als die andere – im Flussbett befinden sich viele kleine Kieselsteine und mancher Felsbrocken, doch alle gemeinsam bestimmen sie den Lauf des Wassers. Wenn wir das nur endlich verstehen würden! Das ist der Grund, warum auch ich es wage, von einer farbenfrohen „Post-Corona-Zeit“ zu träumen. Aber darüber hatte ich schon geschrieben…
Du erzählst von Walen, diesen faszinierenden Giganten des Ozeans, die trotz ihrer Größe scheinbar mühelos durch das Wasser gleiten, lautlos elegant an die Oberfläche kommen und dann wieder in die Tiefe hinabtauchen. Das erinnert mich an einen Traum, den ich vor einigen Wochen hatte. Ich war im Wasser, zusammen mit ein paar anderen Personen, von denen ich nicht weiß, wer sie waren. Wir schwammen irgendwo im Freien, nahe des Ufers, das Wasser war tief, ich fühlte mich sehr wohl. Plötzlich tauchten vor unseren Augen drei Schwertwale auf, die spritzend aus dem Wasser sprangen und fröhlich miteinander spielten. Ich war unglaublich fasziniert von diesen herrlichen Geschöpfen und verspürte ein unbändiges Glücksgefühl. Noch nie in meinem Leben hatte ich einen echten Orca gesehen und auch im Traum war mir noch niemals einer begegnet. Gebannt schaute ich den spielenden Tieren zu und war völlig hingerissen von deren Schönheit und liebevollen Umgang miteinander. Es war mir, als könnte ich deren Gesänge hören und in das heitere Geplänkel miteinstimmen. Da schwammen die Wale zu meiner großen Freude auf uns zu, für mich war es eine Einladung zum Spiel, ein neugieriges Annähern, und mein Herz pochte selig erregt, als ich neben einem dieser imposanten Tiere
herschwimmen durfte. Es war ein Gefühl unendlicher Freiheit und absoluten Glücks, das ich selbstvergessen genoss.
Einen Augenblick später drang das kreischende Schreien der anderen Personen zu mir – ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie beim Annähern der Wale die Flucht ergriffen hatten. Sie fürchteten um ihr Leben und schwammen panisch davon, sie waren auch schon recht weit weg von mir, riefen mir nur irgendetwas zu. Da wandelte sich plötzlich mein Gefühlszustand, ich blickte auf die Orcas neben und hinter mir, auf ihre weiß-schwarzen Flecken, und auf einmal erschienen mir diese Tiere als bedrohlich, ja lebensgefährlich. Die Angst durchzuckte meinen Körper wie ein Blitz, weg waren die innige Freude und die unerklärliche Vertrautheit mit diesen Walen, die ich soeben noch empfunden hatte, die anderen Personen, mit denen ich seelenruhig im Meer geschwommen war, waren weit vor mir, auf ihr eigenes Fortkommen bedacht, sie konnten mir nicht zu Hilfe eilen. Ich war alleine, mit drei riesigen Orcas, und ich wusste, dass ich ihnen mit meinem lächerlichen Geplantsche nicht entkommen würde. Blitzschnell und eiskalt schoss mir die ausweglose Situation ins Bewusstsein – ich war wohl die Beute dieser Tiere, da gab es kein Entrinnen. Panisch versuchte ich davonzuschwimmen, ich schrie nach Hilfe, doch da sah ich schon einen Orca hinter mir auf mich zukommen und ich spürte gerade noch, wie er mich ins Bein zwickte.
Dann wachte ich auf. Irritiert. Ich konnte mich an alles haargenau erinnern, als ob ich es tatsächlich soeben mit allen Sinnen erlebt hätte. Der Traum war so schön gewesen! So unglaublich schön und beeindruckend. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis, die Wale zu sehen, beim Spielen zu beobachten und dann sogar mit ihnen zu schwimmen, ganz vertraut und tief glücklich. Doch dann, ganz zum Schluss meiner fantastischen Traumreise, hatte sich alles gewandelt. Meine Freude wich der wachsenden Panik, mein herrlicher Traum war zu einem Alptraum geworden. Ich versuchte, den Traum zu analysieren und zu verstehen und ließ die Geschichte nochmals Revue passieren. Im ersten Moment, als die Personen die Flucht antraten und mir zuschrien, konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen und ich dachte mir noch, dass die Wale uns Menschen doch nicht angreifen würden. Dann aber erfasste mich doch die Angst, ich ließ mich mitreißen und meine Einschätzung der Situation war nun eine völlig andere. Wie konnte es sein, dass ich mich zuvor so sicher gefühlt hatte und nun dem Annähern der Wale eine völlig konträre Bedeutung zuschrieb? Und wer hatte eigentlich recht – die anderen, welche das Auftauchen der Orcas nur zum Zwecke des Angriffs und Tötens interpretierten, oder ich in meiner ursprünglichen Annahme, die Meeresgiganten luden uns zum Erleben eines einmaligen, unvergesslichen Momentes der geteilten Freude ein, indem wir uns voller Vertrauen und
Neugierde einander näherten, zusammen spielten und lachten und in dieser wunderbaren Kulisse der unberührten Natur gemeinsam das glückliche Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher, aber doch so ähnlicher Spezies feierten? War ich vielleicht zu naiv gewesen, hatte ich die Situation komplett falsch eingeschätzt und dadurch meinen eigenen Tod herbeigeführt? Oder hätte ich meiner Intuition vertrauen und nicht auf die anderen hören sollen? Hatten wir am Ende vielleicht beide recht? Entscheidet die Auffassung der Situation selbst über deren Erleben und Ausgang?
Ich weiß es bis heute nicht, Paolo. Dieser Traum hat mich lange beschäftigt. Ich empfand es auch als ungewöhnlich, von Schwertwalen zu träumen, wo ich doch wie du mitten in den Bergen sitze und diese Orcas mitten aus dem unbewussten Nichts heraus an die halbbewusste Oberfläche meines Traumerlebens gestoßen sind, ohne dass ich dessen Botschaft bis jetzt jedoch ganz hätte entschlüsseln können. Vielleicht hast du ja einen Hinweis für mich.
Ich wünsche dir einen schönen Feiertag und nachts einen geruhsamen Schlaf, liebe Grüße,
Barbara
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 4: Da bin ich wieder …
weiter ...Liebe Barbara!
Da bin ich wieder.
Und wo bist du denn, dass du Delfine siehst? Die Sache macht mich richtig neugierig … ich dachte, du wärst hier, in den Bergen, so wie ich!
Wahrscheinlich bist du das auch, denn wer kann in dieser pandemischen Situation, die sich zwar etwas entspannt hat, uns aber weiterhin belastet (und zwar noch lange, wie ich fürchte), schon verreisen? Ich nehme also an, dass sich links von deinem Schreibtisch ein Foto befindet, auf dem Delfine in einem Hafen spielen. Wenn ich nach vorn schaue, sehe ich das Grab von Jimi Hendrix auf einem Foto von vor drei Jahren, das meinen brüderlichen Freund Patrick und mich in Seattle zeigt, wo wir als Rockpilger unterwegs waren.
Schön das Bild mit den Delfinen, das sind zweifellos hochintelligente Tiere: ich habe einmal einen Schwarm gesehen, auch wenn ich eigentlich auf der Suche nach Walen und nicht nach Delfinen war!
Denn die Wale, liebe Barbara, sind gemeinsam mit den Bären und den Hunden meiner Partnerin meine Lieblingstiere. Ich weiß nicht, ob du schon einmal einen Wal in natura gesehen hast, es ist ein großartiges Erlebnis, aufs Meer hinausfahren und die größten Tiere der Schöpfung in ihrer natürlichen Umgebung bewundern zu können, völlig frei, ohne Grenzen, Käfige, Gehege oder was immer ihre Bewegungsfreiheit einschränkt. Ein aufregendes Gefühl, wenn man die Fontäne sieht, die sie beim Auftauchen ausstoßen, bevor sie wieder ins Meer tauchen und mit ihren riesigen Schwänzen auf das Wasser schlagen.
Weißt du, dass auch die Wale springen und spielen wie die Delfine? Nicht alle natürlich, die Buckelwale aber tun es, diese Wale mag ich am liebsten und ich hatte das Glück, sie ein paar Mal zu beobachten, das erste Mal aus der Ferne, in einer Gruppe, auf den Hawaii-Inseln, das zweite Mal an der Küste von Massachusetts: ein einzelner Buckelwal, der aber ganz nahe an das Boot heranschwamm, auf dem ich mich befand.
Eigentlich, liebe Barbara, finde ich dieses Hingezogensein zu einem Meerestier – für einen Bergbewohner wie mich – eigenartig. Und apropos Meer, da knüpfe ich an deine Überlegung an, eine Arche zu bauen oder zumindest einen Regenschirm zu kaufen, um sich vor der Sintflut zu retten. Letzten Abend hat es hier sehr stark geregnet, nicht vergleichbar mit einer Sintflut, sicher, doch der letzte stärkere Regen ist schon eine Weile her. Es goss in Strömen und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, wie schön es ist, in solchen Fällen ein Dach über dem Kopf zu haben. Ein Zuhause zu haben. Das ist ein Glück, doch manchmal ist es für uns so selbstverständlich, dass wir letztendlich nicht daran denken, auch dann nicht, wenn wir einen sogenannten Homeless treffen. Nass geworden bin ich übrigens weiß Gott oft genug, wie jeder, sei es bei einem Open-Air-Konzert, auf einer Bergtour oder einfach auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mit dem Rad.
Von der Arbeit gibt es eine große Neuheit zu vermelden, Barbara! Nachdem ich in den letzten Wochen jeden Tag arbeiten konnte, allerdings bei verschlossenen Türen, hat das Museum jetzt wieder die Tore für Besucher geöffnet. Es herrschte einige Aufregung, es war keine leichte Wiedereröffnung, und das ist hilfreich, um den Puls der Situation zu fühlen. Denn nicht alles ist wieder so, wie es vorher war. Oder vielmehr glaube ich, dass wir uns die Idee des „wie vorher“ aus dem Kopf schlagen sollten, nicht weil sie nicht realisierbar ist, sondern gerade weil ich es in einem gewissen Sinn für richtig halte, dass wir lernen müssen zu verstehen, dass ein solches „wie vorher“, so sehr wir uns dieser Vorstellung auch annähern können, nicht durchführbar ist. Mit Optimismus und ein bisschen Idealismus möchte ich mir vielmehr ein „besser als vorher“ ausmalen. Doch damit begebe ich mich in den Bereich der Utopie.
Kommen wir lieber auf deinen Brief zurück, Barbara. Deine Idee, dass kein Studium eine gründliche Herzensbildung ersetzen kann, gefällt mir wahnsinnig gut. Fühlen mit dem Herzen. Ich weiß nicht, wie viele das Glück haben, das wir haben, weil wir Nutzen daraus ziehen konnten, dass wir Vorbilder hatten wie unsere Großmütter oder einfach Menschen, die uns vorausgegangen sind: mag sein, dass ich mich diesbezüglich oft desillusioniert fühle. Wenn ich Familiensituationen ohne Ausweg oder an der Schwelle zur Katastrophe sehe, fühle ich mich mit den Familienmodellen, die ich hinter mir habe, wie ein seltenes Exemplar. Vielleicht ist gerade das der Grund für die Empathie, die ich Bären und Walen gegenüber verspüre, ich fühle mich irgendwie als eine vom Aussterben bedrohte Spezies.
Wahrscheinlich bin ich das auch. Ich habe keine Kinder, an die ich das Vorbild der Familie, aus der ich stamme, weitergeben könnte. Doch darüber hinaus kann ich Folgendes tun: fortfahren zu erzählen. Ich wiederhole mich aber, Barbara, das habe ich dir bereits im vorigen Brief geschrieben. Nur, es ist stärker als ich: erzählen, die Geschichte nicht vergessen, damit das Andenken nicht verloren geht, weitergeben, um sich zu erinnern, um nicht bereits begangene Fehler zu wiederholen, oder es wenigstens zu versuchen.
Für mich ist es eine echte Bereicherung, jemanden zu finden, der Lust hat, mir zuzuhören, so wie ich meiner Großmutter zuhörte, wenn sie mir die Familiengeschichten erzählte, die sie von ihrer Schwiegermutter erfahren hatte, zu der sie nach der Heirat mit meinem Großvater gezogen war, weit weg von ihrem Heimattal. Es ist verrückt, dass gerade dank ihrer Erzählungen die Geschichten einer Familie überliefert wurden, die nicht einmal ihre Herkunftsfamilie war.
Und ich gestehe, dass ich manche dieser Geschichten gelegentlich auch Freunden erzähle, die begierig zuhören; nicht nur, manchmal erzähle ich sie auch Museumsbesuchern, wobei ich sie in die Weltgeschichte einbette, die, und davon bin ich zutiefst überzeugt, eher von den Alltagsmenschen geschrieben wird, den einfachen Leuten, als von den Mächtigen, die sie nicht so sehr schreiben, sondern vielmehr zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.
Heute ist niemand ins Museum gekommen, doch wir waren da. Wenn jemand gewollt hätte, wäre er dort auf ein wenig Geschichte gestoßen, sowohl Weltgeschichte als auch kleine Geschichten. Doch nach monatelangem Zwangsarrest hat die Menschheit vielleicht das Bedürfnis, sich frei zu fühlen wie die Delfine und Wale, und hat weder Zeit für noch Lust auf Geschichten.
Sollte es also ein „wie vorher“ geben, dann wünsche ich es mir mit Menschen, die bereit sind, zuzuhören und die Vergangenheit zu bewahren. Um die Gegenwart besser zu leben, Barbara.
Ich habe dich nicht gefragt, wie es dir geht… ich hoffe, es geht dir gut…
Bis bald, einen schönen Abend und einen lieben Gruß.
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Seconda lettera / Lettera 4: Eccomi di nuovo a te …
weiter ...Cara Barbara!
Eccomi di nuovo a te.
Ma dove ti trovi che vedi i delfini? Sono davvero incuriosito da questa cosa… ti immaginavo qui, tra le montagne, come me!
Probabilmente lo sei, d’altra parte con questa situazione pandemica che seppure allentata continua a gravarci addosso (e temo lo farà ancora per molto) chi può muoversi? Immagino allora che a sinistra della tua scrivania ci sia una foto di delfini che giocano in un porto. Io stesso, se guardo davanti a me, vedo la tomba di Jimi Hendrix in una foto di tre anni fa che ritrae il mio amico fraterno Patrick e me a Seattle, in pellegrinaggio rock.
Bella l’immagine dei delfini, animali senza dubbio dall’intelligenza superiore: ne ho visto un branco una volta, anche se in realtà ero in cerca di balene e non di delfini!
Sì perché le balene, cara Barbara, con gli orsi e i cani della mia compagna, sono i miei animali preferiti. Non so se ti è mai capitato di vedere una balena dal vero, è un’esperienza fantastica, poter uscire in mare e ammirare gli animali più grandi del creato nel loro ambiente naturale, in totale libertà, senza restrizioni, gabbie, recinti o che altro a limitarne i movimenti. Una sensazione emozionante, vedere lo sbuffo d’acqua che emettono riemergendo in superficie, prima di rituffarsi in mare sbattendo sull’acqua quelle loro enormi code.
Sai che anche le balene saltano e giocano come i delfini? Non tutte chiaramente, ma le megattere lo fanno, sono le balene che mi piacciono di più e ho avuto la fortuna di avvistarle un paio di volte, la prima da lontano, in gruppo, alle Hawaii, la seconda vicino alla costa del Massachusetts: era una sola megattera ma si era avvicinata tantissimo al battello su cui mi trovavo.
Ti dirò, Barbara, che trovo curiosa questa attrazione, da parte mia che sono un montanaro, per un animale marino. E a proposito di mare mi riallaccio alla tua considerazione sul costruire un’Arca o almeno comprare un ombrello per salvarsi dal diluvio. L’altra sera c’è stata una pioggia molto forte qui, nulla di paragonabile ad un diluvio, certo, ma era da un po’ che non vedevo piovere così forte. Veniva giù a dirotto e il primo pensiero che ho fatto riguarda il bello dell’avere un tetto sopra la testa in questi casi. Avere una casa. Ed è una fortuna, ma talvolta lo diamo talmente per scontato che finiamo per non pensarci, nemmeno quando ci imbattiamo in un cosiddetto homeless. Poi, per carità, di acqua in testa ne ho presa tanta, come tutti, che fosse per assistere ad un concerto all’aperto, o durante una gita in montagna o semplicemente tornando a casa dal lavoro in bicicletta.
Ma a proposito di lavoro devo dirti la grande novità, Barbara! Dopo che nelle ultime settimane ero riuscito a lavorare tutti i giorni, ma a porte chiuse, adesso il Museo ha riaperto il portone al pubblico. C’è stato un sacco di fermento, non è stata una riapertura facile, e questo aiuta a percepire il polso della situazione. Perché non è ancora tornato tutto ad essere come prima. Credo anzi che il concetto di “come prima” sia una cosa che dovremmo cercare di toglierci dalla testa, non perché non sia realizzabile, ma proprio perché in un certo senso trovo giusto che ci si sforzi di imparare a capire che per quanto vicini possiamo arrivare a quel concetto, il “come prima” non sarà realizzabile. Ottimisticamente e un po’ idealisticamente vorrei piuttosto immaginare un “meglio di prima”. Ma mi sto addentrando nell’ambito dell’utopia.
Meglio, Barbara, tornare alla tua lettera. Mi piace da matti la tua idea che nessun corso di laurea possa sostituire un’accurata formazione del cuore. Del sentire col cuore. Non so quanti abbiano la fortuna che abbiamo noi, di aver potuto avvantaggiarci dall’aver avuto esempi come le nostre nonne o semplicemente di chi ci ha preceduti: sarà perché spesso mi sento disilluso a riguardo. Vedendo situazioni familiari alla deriva o al limite del disastro mi sento una rarità con i modelli familiari che ho alle spalle. Forse è proprio questa la ragione dell’empatia che provo per orsi e balene, mi sento in qualche modo una specie a rischio di estinzione.
E probabilmente lo sono. Non ho figli a cui trasmettere l’esempio di famiglia da cui provengo. Ma in senso più esteso quello che posso fare è quello di continuare a raccontare. Ma mi sto ripetendo Barbara, questa cosa te l’ho già scritta nella lettera precedente. Solo che è più forte di me, questo fatto del raccontare, del non dimenticare la storia, perché la memoria non vada perduta, del tramandare per ricordare, se non per non commettere errori già fatti, almeno per provarci.
Per me è una vera ricchezza trovare qualcuno che abbia piacere di ascoltarmi, come io ascoltavo mia nonna raccontarmi le storie di famiglia così come lei le aveva imparate sentendole dalla suocera con cui era andata ad abitare, lontano dalla sua valle d’origine, dopo aver sposato mio nonno. È pazzesco come proprio grazie ai suoi racconti si siano tramandate le storie di una famiglia che non era nemmeno la sua famiglia d’origine.
E ti confesserò che alcune di queste storie a volte le racconto a certi miei amici che ne sono avidi ascoltatori; non solo, a volte le racconto anche ai visitatori del Museo, inserendole nella Storia quella con la S maiuscola, che sono più che convinto sia fatta anche dalle persone della quotidianità, le persone semplici, piuttosto che da quei potenti che più che farla la sfruttano a loro vantaggio.
Oggi al Museo non è venuto nessuno, ma noi eravamo lì, se qualcuno avesse voluto vi avrebbe trovato un po’ di storia, sia quella con la S maiuscola, sia quella più “piccola”. Ma dopo mesi di cattività coatta forse il genere umano ha bisogno di sentirsi libero come i delfini e le balene e non ha né tempo né voglia per le storie.
E allora se un “come prima” ci dovesse essere, lo vorrei con la gente disposta ad ascoltare e a ricordare il passato. Per vivere meglio il presente, Barbara.
Non ti ho chiesto come stai… ma spero bene…
A presto, buona serata e un caro saluto.
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 7: Auf deinen schönen Brief, der mich sehr entzückt hat (ich liebe dieses Wörtchen seit ich Wickie und die starken Männer gesehen habe …
weiter ...27. Mai
Liebe Marjana,
auf deinen schönen Brief, der mich sehr entzückt hat (ich liebe dieses Wörtchen seit ich Wickie und die starken Männer gesehen habe, wo ein gewisser Gorm immer wieder ausruft: „Ich bin entzückt!“), werde ich bald eingehen, aber im Moment habe ich einfach zu wenig Zeit für einen Brief. Ich sage nur: Weidinger, Zuckergoscherl, Dezentral, Hafenkneipe, Central Garden, Automat Welt, Schweizerhaus, Wild, Goldener Pelikan, Zum lustigen Bauern, Phönixhof, Chelsea, Rhiz, Schwedenespresso, Zur Kernigen, Alt Wien, Ubl, Weinstube Josefstadt, Anzengruber, Else, Zweistern, Gasthaus am Silbersee, Zum Sieg, Tachles, Schöne Perle, Sperlhof, Sperl, Schank zum Reichsapfel, Eiles, Nil, Hummel, Kent, Quell, Eduard, Amerling, Blue Box, Nachtasyl, Jelinek, Westend, Old Oak, Stag’s Head beim Weststadion, Hendricks am Praterstern, Steindl, Admiral am Hauptbahnhof, Prückel, Zum frohen Schaffen, Club International, Simon, Tonis Inselgrill, Gösser Bierinsel, Englischer Reiter und so weiter.
Ich treffe endlich wieder urviele Leute, z.B. war ich letzte Woche mit Lena im Gasthaus zum Sieg. Das haben wir schon vor über zwei Monaten ausgemacht, dass wir dort, wenn die Lokale wieder offen haben, den Sieg über Corona feiern. Und mit Herrn Pollak, dem Büchernarren, war ich im Schwedenespresso, um den Sieg über die Schweden zu feiern. Und mit Evi und Tanja war ich im Zuckergoscherl, nach dem definitiv letzten Balkon-Konzert von Ernst und Karl Molden, bei dem diesmal über 500 Leute waren. Dankbarkeit auf dem Balkon und auf der Straße, ein Abschiedsfest … Übrigens, Tanja und Lena sind Ukrainerinnen! Ja, ich hatte endlich wieder Termine, „war das eine Herrlichkeit!“, um Bohumil Hrabal zu zitieren, und ich habe noch viele Termine vor mir, oft mehrere an einem Tag, dass ich’s nur nicht übertreibe, ich darf mich nicht zerreißen, Cucurrucucú! Eines meiner neuen Lieder, die ich zur Gitarre singe, ist die Vertonung eines Gedichtes von Rainer Brambach und Frank Geerk aus ihrem gemeinsamen Buch Kneipenlieder, darin die Textzeile: „Uns locken alle Schenken, der Weg nach Haus ist weit“. In meinem Repertoire habe ich auch „Kofferversionen“, also Lieder von anderen, die ich eigenwillig interpretiere, darunter eines, das Molden beim vorletzten Gig auf dem Balkon in seiner wienerischen Übersetzung gesungen hat: The Ship Song von Nick Cave. „Auf geht’s, einem ungewissen Schicksal entgegen!“ (Übrigens habe ich letztens gesehen, dass in einem meiner vorigen Briefe ein Buchtitel von F.K. Waechter nachträglich korrigiert wurde. Ich hatte geschrieben: Es lebe die Freihei, das ist richtig, falsch ist: Es lebe die Freiheit – der Engel steckt im Detail.)
Marjana, ich schreibe dir, sobald ich wieder mehr Zeit und einen klaren Kopf habe, vor allem zu Arthur 1 und Arthur 2 (es gibt auch Neuigkeiten von Fritz!), Kritzendorf und Gelsen (schönes Molden-Lied: dausnd göösn), Jan Larri (das Buch habe ich bereits bestellt), und sehr gefreut habe ich mich über die Grüße deines Mannes – grüße ihn auch recht herzlich, und und und. Bald!
Auf die Freiheit, die Briefkultur, die Ankurbelung der Wirtschaft und die schillernden Seifenblasen!
Alles Liebe und Entzückende,
Christian
PS: Ich muss gestehen, dass ich manchmal etwas übertreibe und sogar lüge, nein, schwindle. Das mit Lena im Gasthaus zum Sieg liegt z.B. noch vor mir …
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 6: Dein Traum erinnert mich an mein früheres Ich.
weiter ...Lieber Christian,
dein Traum erinnert mich an mein früheres Ich. Kaum zu glauben, aber es gab mal eine Zeit, in der ich in der Lage war, teilnahmslos und gleichzeitig freundlich auszuschauen (also abwesend) und stundenlang vor einer Toilettentür im überfüllten Zug zu stehen. Von diesem Mädchen ist nichts übriggeblieben, und das ist gut so. Zu deiner Frage: alles hat seine Zeit, Gedichte schreibe ich nicht mehr, ernst gemeinte Herzblutgedichte, die wird es von mir wohl nicht mehr geben, es sei denn, ich werde durch ein Trauma verwirrt. Das Dichten habe ich aber nicht ganz an den Nagel gehängt, immer wieder flechte ich den einen oder den anderen unernsten Vierzeiler in meine Romane unter dem Deckmantel eines Zitats ein, manchmal steht „Schiller“ drunter, „anonym“ oder „Volksmund“. So steht in meinem letzten Roman der Protagonist im Klostergarten und schaut auf eine an einen alten Baum genagelte Tafel mit folgender Inschrift.
Kopf in den Wolken,
Großes im Sinn
wie schnell war den Mönchen
der Gulden dahin.
Du hast ein Stelzenhaus in Kritzendorf bewohnt? Wie cool! Ich bin einmal mit dem Twin City Liner an diesen romantischen Bauten vorbeigefahren und habe mir vorgestellt, eine Nacht ohne Mückenspray in so einer Hütte zu verbringen, bei offenem Fenster. Hast du ein Gelsengedicht in deiner Sammlung? Ich habe schon immer viel für Insekten übriggehabt. Wie Millionen sowjetischer Kinder hatte ich das Buch „Die ungewöhnlichen Abenteuer von Karik und Walja“ von Jan Larri in meinem Bücherschrank, es hat mich stark geprägt. In diesem Buch geht es um ein Geschwisterpaar, das im Labor eines Gelehrten eine nach Limonade schmeckende Flüssigkeit zu sich nimmt – dadurch schrumpfen die beiden zur Größe einer Erbse und dann lernen sie noch im Grasdschungel unter furchterregenden Insekten einige Lektionen fürs Leben. Nun, als du mir in deinem ersten Brief über eure Fliege Fritz geschrieben hast, fand ich dich, nimm es bitte nicht allzu persönlich, sehr sympathisch, und ich muss dir sagen, auch ich habe seit einigen Wochen so einen Fritz daheim. Er heißt Arthur und ist eine gewöhnliche Zitterspinne, dem hageren Körperbau nach ein männliches Exemplar. Diese Spinnenart soll laut Wikipedia bis zu drei Jahre alt werden, was mich natürlich sehr freut, denn ich habe mich an Arthur gewöhnt. Leider hängt sein Netz in einer ereignislosen Ecke über einer Lichtleiste mit kaltem LED-Licht, eine Art Mondlicht also, das meinem Empfinden nach kaum Beute anzieht, deshalb habe ich beschlossen, die Ernährung der Spinne zur Chefsache zu machen. Neuerdings bekommt er jeden Abend einen kleinen Feldblumenstrauß mit vielen Minifliegen hingestellt. Mein Mann (der dich übrigens unbekannterweise herzlich grüßen lässt) verlässt jedes Mal den Raum bei dieser Raubtierfütterung. Er kann einfach kein Blut sehen. Ich übrigens auch nicht, denn es fließt gar kein Blut. Zuerst wird die Beute lange zwischen den dünnen Beinen (oder Armen?) gedreht, es schaut wirklich nach Weben aus, dann wird sie von Arthur ausgesaugt. Wie in einem Kuss vereint sehen die beiden dabei aus. Warum die Spinne Arthur heißt? Wir kannten einen Stallknecht, der hieß Arthur und sah unserem Arthur in seinem Habitus ziemlich ähnlich. Einmal muss er etwas Alkohol konsumiert haben, es war eine klirrend kalte Winternacht, da sagte er im Vorbeigehen zu mir: „Für Sie hole ich die Sterne vom Himmel!“ Das hat mich umgehauen, denn Arthur hatte mich zuvor jahrelang mit kurzem Nicken und skeptischem Blick begrüßt. Unter anderen Umständen hätte ich über die kitschige Anmache gelacht. Inzwischen denke ich, der Arthur hat sich an diesem Abend einfach wohl gefühlt in seiner alten Haut unter dem Sternenhimmel, er wollte sein Wohlbefinden kommunizieren, zufälligerweise war ich in der Nähe, es hätte auch sein Kater oder ein Pferd sein können. Es gefällt mir der Gedanke, dass manche schöne Geste für niemanden etwas zu bedeuten hat. Wie eine schillernde Seifenblase darf sie nur zur Kenntnis genommen werden und mehr nicht.
In diesem Sinne grüße ich dich ganz herzlich
Marjana
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 3: Ich schaue nach links …
weiter ...25.5. 2020
Lieber Paolo!
Ich schaue nach links.
Delfine spielen im Hafen, ein Regenbogen schillert farbenfroh über einer prächtigen Villa mit rosa duftendem Oleander.
Ich schaue nach rechts.
Ein zerfranster Umzugskarton mit den Utensilien des gekündigten Bürojobs, ein Foto der fünfköpfigen Familie und eine Packung Xanax obendrauf.
Ich schaue nach oben.
Gewitterwolken am Horizont. Manche verziehen, andere brauen sich gerade zusammen. Welcher Gott über den Wolken sitzt, weiß ich nicht, aber es spielt keine Rolle.
Ich schaue nach hinten.
Unsere Großeltern haben die großen Kriege erlebt.
Heute wird anders gekämpft. Aber das Leid bleibt, kein Platz für Sieger. Links die Freiheitskämpfer, rechts die Gesundheitsapostel. Dazwischen der Schützengraben. Eine Staatsgewalt, die mit vereinten Kräften nicht nur den unsichtbaren Feind erdrückt, Argumente, die wuchtig ins gegnerische Feld geschleudert werden, die Moralinkeule, die bedrohlich geschwungen wird. Die Presse entzückt, die Masse verrückt. Medialer Hype. Das Virus der Panik gefährlicher als Corona. Habgier, Missgunst und Angst der Motor einer vielbedienten Kriegsmaschinerie. Wann und wo der Blitz einschlägt, können nicht einmal Meteorologen vorhersagen. Aber dass ein Gewitter aufzieht, kann sogar ich erkennen. Einfach den Wolkenbruch abwarten? Nein – die Arche bauen, Dächer sanieren, zumindest einen Regenschirm kaufen. Und andere unterstehen lassen. So sehe ich das, mit der Gegenwart. Und mit der Zukunft.
Aber weißt du, Paolo, weil du den Aspekt der Hoffnung ansprichst – weder ein naiver Optimismus noch eine apokalyptische Weltuntergangsprophezeiung werden etwas nützen, doch der Glaube an die Möglichkeit des Guten im Menschen und ja, vielleicht sogar an einen wie auch immer genannten Gott jenseits unserer Berge, können den Blick und unsere Handlungen auf etwas Größeres, Transzendentales hin ausrichten, das in unserer immer kleiner gewordenen Welt oft so schmerzlich fehlt. Woran unsere Gesellschaft erkrankt? Nicht nur an Corona, und das schon seit Längerem. Welchem Gott wir dienen wollen? Gesundheit als neue Götze, pfui Teufel. Wir glauben doch wohl nicht ernsthaft, ein funktionierender Körper sei unser höchstes Gut. In dieser Hinsicht dürfen wir Menschen wohl getrost größer von uns denken. Und besser. Damit wir dann auch eher größere und bessere Handlungen von uns selbst abverlangen. Unsere Großmütter haben es uns vorgemacht. Es ist schön, wie du über deine Oma schreibst. Meine hat mich auf mannigfaltige Weise inspiriert, ihr weiser Geist und ihr großes Herz wirken hinein in meine Gegenwart. Kein Studium ersetzt eine gründliche Herzensbildung, kein Titel ist Garant für Wohlwollen oder zumindest Anstand. Ein Wort, das aus der Mode gekommen ist wie das Konzept, das es umschreibt.
Aber genug – es berührt mich, was du über das Erzählen berichtest, und diese Gabe lese ich aus jeder Zeile deines Briefes heraus. Mein Blick schweift auf die vielen bedruckten und beschriebenen Blätter vor mir. Poesien, Erzählungen, wissenschaftliche Texte, Tagebücher, To-do-Listen. Was Schreiben für mich bedeutet? Beschreiben, aufschreiben, umschreiben, verschreiben, anschreiben, ausschreiben, neuschreiben, gegenschreiben, wi(e)derschreiben, entschreiben.
Doch weißt du was? Seit ich das Wort „Hawaii“ gelesen habe, kann ich an nichts anderes als an Urlaub denken. Grüne Palmen, weißer Sandstrand und ein blaues Meer, das sich in einem noch viel blaueren Himmel spiegelt. Kein Wölkchen in der Luft, alle Gedanken und Sorgen wie weggeblasen. Eine kleine Alltagsflucht an die Quelle der Inspiration, ein Moment der Stille und der Einkehr, nur das gleichmäßige Atmen der Wellen, die schäumend an das Ufer rollen. Ich wünsche mir gerade in Zeiten wie diesen mehr Abstand vom Alltagsstress, vom Grübeln, vom Virus. Corona muss wieder aus unseren Köpfen verbannt werden, es tut uns nicht gut. Vergessen sollen wir es lernen, einfach vergessen, und da wirst du jetzt vielleicht lachen oder empört aufschreien, und das verstehe ich, aber sind es nicht gerade auch unsere vielzitierten Berge, die uns vom Gipfel aus, der Distanz wegen, die Dinge im Tal kleiner und klarer sehen lassen und unsere Perspektive wieder etwas zurechtrücken?
Ach, ich sollte mir neue Wanderschuhe kaufen. Und trainieren. Es ist anstrengend, eine Bergspitze zu erklimmen, aber dauerhaft viel beschwerlicher, den Anstieg nicht einmal zu versuchen. Natürlich, hinter jedem Berg ein neues Tal, das wissen wir Südtiroler, und doch stählt jede Besteigung unsere Muskeln für das Überwinden des neuen Massivs, das sich hinter der nächsten Biegung vor unseren Augen präsentiert. Und dann wieder Sandalen, Hängematte und ein Stapel guter Bücher am Strand. Gebirge und Meer, Tag und Nacht, Sonne und Mond. Irgendwo zwischen Mundschutz, Lippenstift und einer gemeinsam am Lagerfeuer geteilten Flasche Wein liegt wohl das Reich der Zukunft, in dem ich auch gern ein Stückchen Land bewohnen möchte. Mit Blumen in den Gärten, sauberem Wasser für alle und genug Brot und einem herzlichen Empfang für jeden neu ankommenden Gast.
Wieder muss ich an meine Großmutter denken, die trotz der vielen Entbehrungen weder verbittert noch selbstmitleidig wurde, sondern tatkräftig Herz und Haus für verwaiste Kinder und Notleidende öffnete und ein Leben lang demütig und würdevoll ihren Dienst am Nächsten verrichtete. Und dabei sogar die Fähigkeit besaß, voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken, und, was wohl nur ganz wenigen von uns gelingt, die Gegenwart zu genießen. Ein wunderschönes Erbe, das sie mir hinterlässt, und für welches ich sehr dankbar bin.
Lieber Paolo, ich freue mich, wieder von dir zu hören.
Herzliche Grüße,
Barbara
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Peter Gilgen & Gabriele Bösch
Brief 4: Der Flieder ist verblüht, jetzt ist es der Holder …
weiter ...Sonntag, 24. Mai 2020
Lieber Peter,
der Flieder ist verblüht, jetzt ist es der Holder, der den Garten mit seinem Duft erfüllt. Immer, wenn ich in diese weißen Blütenkaskaden schaue, sehe ich auch die Arbeit des Spätsommers vor mir. Die tiefblauvioletten Beeren, die vor Saft strotzen und meine Finger färben. Es gilt jetzt abzuwägen, wie viele der Blüten ich in Sirup verwandle, wie viele ich stehen lasse, um später Marmelade, Likör oder Wein aus den reifen Beeren zu machen. In dieser Abwägung berücksichtige ich auch die Menge an Beeren, die wir den Amseln gönnen, die sich im Übrigen auch an den Kornelkirschen, der Felsenbirne, den Beeren des Wilden Weines und später im Herbst an den gefallenen Äpfeln gütlich tun. Wenn mein Mann im Garten jätet, nähern sich die Amseln am Boden bis auf einen Meter. Sie haben gelernt, dass durch seine stille, unaufgeregte Tätigkeit Würmer für sie abfallen.
Und wenn ich mit meiner alten Dame bei ihr auf dem Balkon sitze, dann pfeife ich dem Amselmann. Es ist ein Vergnügen für sie, ihn immer antworten zu hören. Sie, die nie Zeit für die Natur oder den Garten hatte, hatte stets eine Vorliebe für Kunststoffblumen, da sie keiner Mühe bedurften. Vor vier Jahren habe ich begonnen, ihr diese Kunststoffbegonien, die sie noch am Dachboden hatte, auf das weiß lackierte Gusseisengeländer zu binden. So blüht es dort scheinbar vom Frühling bis in den späten Herbst. Ich habe aber auch Gewürze auf dem Balkon gepflanzt. Wir riechen an ihnen, wir verwenden sie für die Speisen und zur Dekoration derselben. Meine alte Dame gießt die Gewürze, eine kleine Aufgabe, die ihr den Rhythmus des Tages und auch der Jahreszeiten vermittelt. Irgendwann hat sie begonnen, auch die Kunststoffblumen zu gießen, und ich habe mich über ihre logischen Verknüpfungen gefreut. Und wenn sich Schwebfliegen, Bienen und Hummeln auf diesen falschen Blüten tummeln, dann frage ich mich manchmal, ob sie vielleicht weniger einer optischen Täuschung anheimfallen als vielmehr auf unser Verhalten reagieren: auf unseren zärtlichen Blick, auf unsere Fürsorge, auf unsere Freude. Was wissen wir schon wirklich?
An jenem Tag (29.04.2020), als ich morgens den ersten Brief an Dich abschickte, hörte ich die Nachrichten erst spät. Es wurden geleakte Sitzungsprotokolle der Regierung und ihrer Taskforce Corona veröffentlicht. Ihnen war zu entnehmen, dass der Kanzler am 12. März (vier Tage vor dem Lockdown), dem Termin der ersten Sitzung mit Experten, das Angstmotiv aufgreift, das einst in GB in Bezug auf eine Masernepidemie so ähnlich kreiert wurde. Die Angst vor Lebensmittelknappheit allerdings, sei den Menschen zu nehmen.
Die Kommunikation der Angst, dass Großeltern sterben könnten, fand breit in unseren Medien statt – und zwar auf eine relativ nette Art: „Ich schau auf dich“. Das konnte jeder verstehen und fast alle machten mit. Die Angst vor „Hunderttausend Toten“, die Spaltung der Menschen in „Lebensretter“ und „Lebensgefährder“ wurde aber erst ab 30. März kommuniziert, zu einem Zeitpunkt, als die Corona-Krise im Gesundheitssystem bereits überwunden war. Warum? Bereits am 13. März soll Dr. Allenberger (Agesexperte) gewarnt haben, man müsse ganz schnell von der Botschaft des „ganz gefährlichen Virus“ wegkommen, weil diese Botschaft kontraproduktiv sei und zu größeren Kollateralschäden führen könne, die weit über Covid-19 hinausgehen könnten. Sars-CoV-2 sei für über 80 Prozent der Bevölkerung nicht gefährlich. (Falter 20/20).
An dieser Stelle mache ich eine Pause. Ich weiß nicht recht, ob ich meine Gedanken und meine Fragen hier überhaupt ausbreiten soll. Wirst du daran interessiert sein? Ich bin keine Philosophin und auch keine Politikwissenschaftlerin und sehe nur auf kleine Ausschnitte der Welt. In den letzten Jahren habe ich diese Konzentration auf Details trainiert, um sie ähnlich der fraktalen Welt Mandelbaums in Form von Zeichnungen auf das Papier zu bringen. In den besten Stunden denke ich, dieses Tun sei eine Art Meditation, die die Evolution von Vertrauen abbildet. In der iterativen Wiederholung ein und desselben Zeichens geschehen, wenn man so will, „kleine Fehler“, die die Fortschreibung oder Fortzeichnung in minimal anderer Richtung beeinflussen. Im ersten Moment mag als Störfaktor erscheinen, was letztendlich zu einem interessanten Ganzen führt, weil es lebendig ist und als solches wirkt. Vermutlich schaue ich auf eine ähnliche Weise in die Gesellschaft. Ich schaue auf die vielen kleinen Gesten, die es vermögen, im Kleinen etwas zu verändern, das durch Wiederholung zum großen Ganzen gedeiht. Dieses, am Anfang der Coronakrise kommunizierte „schau auf Dich, schau auf mich“, konnte am Einzelnen im Sinne von Freiwilligkeit und Verantwortung andocken und sich wiederholen, und darum funktionierte es. Die abrupte Unterteilung der Menschen in Lebensretter und Lebensgefährder nahm sich wie ein ausgeleertes Tintenfass über meiner Zeichnung aus: Es wurde das gemeinsame Werk zerstört. Indem man jene Wenigen, die sich nicht an die Regeln hielten oder sich auch nur zufällig in nicht tolerierten Situationen aufhielten, beinahe zu Verbrechern an der Menschlichkeit hochstilisierte, stellte man Sündenböcke in die Welt.
Meine Wahrnehmung war täuschte mich nicht. Mimik und Gestik des Kanzlers stimmten nicht mit der Botschaft überein. Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, weshalb er gegen den Rat der Experten gehandelt hat, denn es lagen zusätzlich an jenem 30. März bereits Daten der Mathematiker vor, die besagten, dass eine Beschränkung der Freizeitkontakte der Generation 65+ um 50 Prozent bereits eine Senkung der Severe Cases von Covid-19 von über 50 Prozent für die Gesamtpopulation bedeutet hätte. Ein milderer Weg wäre möglich gewesen.
Warum also handelte der Kanzler so? Weil Netanjahu, den er kontaktierte, dazu riet? Wie kann man ausgerechnet den Menschen um Rat fragen, dessen Gesundheitsminister öffentlich erklärte, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes für Homosexualität sei? Wie kann man in einem Land nachfragen, in dem die Ultraorthodoxen, die sich nicht an Ausgangsbeschränkungen halten, die eigene Polizei als „Nazis“ beschimpfen und sie mit uringefüllten Plastiksäckchen bewerfen?
Der Kanzler hat sich nicht verrechnet, wie ich im ersten Brief an dich anklingen ließ. Er hat ge-rechnet, wie ich vermute: Wenn er die Krise verschärft kommuniziert, so wird er nachher umso besser dastehen. Dann hat er hunderttausend Menschen gerettet und nicht wir, die wir uns solidarisch und empathisch verhalten haben. Diese meine Annahme entspräche seiner dummen Eitelkeit, die er im Kleinen Walsertal unter Beweis stellte. (Aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, sie hat aber dazu geführt, dass kurzfristig seine Umfragewerte gesunken sind und sich viele Menschen nicht mehr an die Maskenpflicht halten wollen.)
Auf jeden Fall hat er uns mit dieser Angstkommunikation ab 30. März um unsere Freude gebracht, dass unser Handeln bzw. Nichthandeln sich sehr positiv auf das Verflachen der Kurve (flatten the curve) ausgewirkt hat – er hat stattdessen mit seinem Innenminister dem Moralismus und der Denunziation Tür und Tor geöffnet. Das halte ich für gefährlich. Das sind Wege, die wir schon einmal gegangen sind – sie wurden in der kollektiven Erinnerung wachgerufen. Eine Folge davon ist, dass Rassismus und Antisemitismus deutlich zugenommen haben.
Dazu kommt, dass das Epidemiegesetz ausgehebelt wurde und die Milliardenpakete an Unterstützungen ausgerechnet von der Wirtschaftskammer verteilt werden. Die Großen, die den Wahlkampf des Kanzlers unterstützt hatten, werden jetzt mit zukünftigen Steuergeldern gefördert, obwohl sie gleichzeitig Dividenden ausschütten, während die unendlich vielen EPUs und KMUs zu Bittstellern degradiert wurden und viele von ihnen noch immer leer ausgehen. Die Umverteilung von unten nach oben nimmt deutlich zu. Vom Umgang mit den Künstlern ist ganz zu schweigen, die wurden schlicht vergessen. Und ich kann mich des Gedankens nicht verwehren, dass in der Kultur eine Art Flurbereinigung stattfindet, die auch vom ORF mitgetragen wird: In Vorarlberg wurde letzthin ein Kulturredakteur aus fadenscheinigen Gründen gefeuert, während in Wien ein Jahr nach Ibiza, ich fasse das eigentlich nicht, dem Herrn Strache wieder eine mediale Bühne geboten wird. Zudem wird über die Wirtschaftskammer Werbung für unsere Boulevardpresse vertrieben, an denen ein dem Kanzler nahestehender Milliardär beteiligt ist. Man wird in Zukunft nicht mehr von Volksgesundheit sprechen müssen, wenn man der Volksverblödung derart viel Vorschub leistet.
Dazu passt, dass der Bildungsminister beifällig den Satz fallen lässt, dass in den nächsten Jahren mehrere private Universitäten entstehen sollen. Ich stehe dem zwiespältig gegenüber. Wer wird das finanzieren? In welche Richtung wird die Forschung ausgerichtet? Vorletzte Woche habe ich einen Bericht der Montanuni Leoben über die ersten Doktorarbeiten zum Thema Bergbau am Mond gelesen. Wie stolz man auf diese „Errungenschaften“ ist – während man für die öffentlichen Schulen so nebenbei den in Diskussion stehenden verpflichtenden Ethikunterricht strich, und stattdessen das Fach „Religion“ zum Wahlpflichtfach erhob.
Und dazu kommen die vielen arbeitslosen, eh schon mittellosen Menschen, von denen wir hochmütig annehmen, dass sie auf die Populisten hereinfallen und in Zukunft noch mehr hereinfallen werden. Und gleichzeitig wird Österreich aufgrund seines hervorragenden Gesundheitssystems, das sich in der Pandemie bewährte, plötzlich relevant für die Superreichen – man liest, für einen österreichischen Pass zahlen sie bis zu sieben Millionen Euro. Voraussetzung für den Pass ist nur, „dass man sich um die Republik verdient macht“. Man muss es sich leisten können, Österreicher oder Österreicherin zu sein, die Einbürgerungen sind in den letzten Jahren drastisch gesunken, sie sind einkommensabhängig. An dieser Stelle mag ich gar nicht mehr weiterschreiben, was ich weiterdenke.
Dazu kommt auch noch, dass ein Ökonom aus dem Umfeld der Industriellenvereinigung die Leitung der Statistik Austria übernommen hat und vorab alle neuen Aussendungen zuerst ans Bundeskanzleramt schicken muss. Message control. Evidenzbasierte Politik in Echtzeit aufgrund statistischer Auswertung unserer digital erfassten Aktions- und Reaktionsmuster ist das Ziel.
Bazon Brock hatte vermutlich recht. Nach einer solchen Krise driftet eine Gesellschaft nach rechts. Das stimmt mich absolut dystopisch. Naomi Kleins Text im Guardian „How big tech plans to profit from the pandemic“ tut sein Übriges dazu. Die bewusst geschürte Angst und der Moralismus (die anderen sollen sich an die Regeln halten) werden dazu führen, dass Menschen JA zu allen möglichen Überwachungssystemen sagen werden.
*
Lieber Peter, zu Beginn dieser Krise hatte ich ehrlich gehofft, dass diese Lockdowns dazu führen könnten, dass Gesellschaften dauerhaft umzudenken fähig wären (wenn ich mir auch schwere Sorgen um die Schwellenländer machte, in denen so viele Menschen von der Hand in den Mund leben – den Verzweiflungsschrei eines Beiruter Straßenhändlers vergesse ich nie). Ich habe nachgeschaut, wann ich meine Haltung zu unserem Lockdown geändert habe. Es war der 5. April. Zu diesem Zeitpunkt haben Schweizer Ärzte bereits Alarm geschlagen, dass es 40 % weniger Herzinfarkte gäbe, dass Patienten nicht mehr in die Ordinationen kämen. Ich habe das verfolgt und ganz ähnliche Berichte von österreichischen Ärzten gefunden. Auch in der englischen Presse schlugen damals schon Ärzte Alarm, dass Menschen mit schweren Erkrankungen aus Angst vor Corona nicht mehr die Spitäler aufsuchten, dass sie zu Hause blieben und dort starben.
Ich habe mich damals gefragt, wie viele neue Krankheitsfälle und auch Todesfälle wir durch den Stress der Isolation, durch den Stress, den Panik verursacht, durch den Stress, den Arbeitslosigkeit verursacht, schaffen. Da kein Grundeinkommen verteilt wurde (was m.E. sinnvoll gewesen wäre), fand ich diese Fragen berechtigt. Ich habe das weniger als „Rechnen“ empfunden, vielmehr als „Abwägen“. Es galt und gilt, die alten und schwachen Menschen zu schützen. In meiner Sicht hatte sich aber die Gruppe der „schwachen“ Menschen verändert – Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt und Missbrauch ausgesetzt waren, suizidgefährdete Menschen, Menschen, die auf Krebsdiagnosen warteten, usw. Ich hatte die Frage so gestellt: Schaffen wir durch den Lockdown neue Risikogruppen? Ich stellte diese Frage auch vor dem Hintergrund, dass mehrere Ärzte erzählten, die für Covid-19 ausgerüsteten Krankenhäuser stünden fast leer.
Jetzt werden abertausende verschobene Operationen allmählich nachgeholt. Zwanzigtausend Psychotherapieplätze werden zusätzlich geschaffen, um die in der Zeit des Lockdowns an der Psyche Erkrankten aufzufangen – Depressionen sind von 4 auf 20 % gestiegen, Angstzustände von 5 auf 19% und Schlafstörungen sind auf 19 % gestiegen (Donauuniversität Krems). In Deutschland untersuchen Pathologen die durch die Angst vor Corona verübten Suizide und von San Francisco lese ich Ähnliches. Die Studie (an der auch Dr. Drosten beteiligt war), die besagt, dass 30-40% der mit Sars-Cov-2-Infizierten eine gewisse Kreuzimmunität (zelluläre Immunität) mit anderen Coronaviren aufweisen und deshalb keine Symptome zeigen, liegt nicht länger unbeachtet auf einem Preview-Server, sie gelangt langsam an die Öffentlichkeit und nimmt hoffentlich etwas von der Panik.
Diese umfassendere Sicht auf eine momentane Pandemie plus ihrer möglichen Folgen aufgrund von Maßnahmen gegen sie, ist vermutlich jene, auf die Anders Tegnell mit seiner Strategie in Schweden baute. Ich kann nicht glauben, dass es in Schweden nur um die Wirtschaft ging. Denn Schweden hat zur Zeit der Schweinegrippe Erfahrungen gemacht, die uns in Österreich, soweit ich weiß, erspart blieben. Tegnell war damals für Massenimpfungen eingetreten, die, wie sich danach herausstellte, lebenslange Folgeschäden für 168 Kinder hatte, da sie eine Narkolepsie entwickelten. Also nahm ich an, dass er viele Bedenken gegeneinander abwog.
Ich habe öfter mit Interesse aber auch mit Besorgung nach Schweden geschaut. Was mir persönlich auffällt, da ich mich in der Vergangenheit aufgrund meiner Beteiligung an Visionsprozessen ein bisschen mit pflegerischen Modellen in den nordischen Staaten auseinandergesetzt habe, ist, dass in Schweden wesentlich mehr junge Menschen (Studenten) an der Betreuung alter Menschen mitwirken als bei uns. Was uns vor ein paar Jahren noch eine Art Vorbild war, dass Studenten auch Tür an Tür mit alten Menschen leben, ist vielleicht jetzt in Schweden zum Damoklesschwert geworden. Aber nicht nur dort, die Zahl der Todesfälle in Altersheimen ist in Belgien (vor Spanien und Italien) und den Niederlanden ähnlich hoch, wenn nicht höher.
Das ambulante Modell der Altenpflege (Buurtzorg, von Jos de Blok 2007 gegründet) in den NL ist ein Vorzeigemodell. Ich kann aber momentan keine Aussage finden, wie es sich in der Coronakrise bewährt hat.
Diese Pflegemodelle würden mich nicht nur aufgrund meiner eigenen Tätigkeit mit meiner alten Dame interessieren und im Hinblick auf die Entwicklung der Pflege hier im Land, sondern auch in Erwartung des eigenen Altwerdens. Und das wiederum führt dazu, dass ich mir Gedanken über den eigenen Tod mache. Seltsamerweise ist daraus Kraft zu schöpfen.
Der Zufall will, dass ich jetzt in diesem Moment das Titelblatt der New York Times vom heutigen Tag betrachte. Ich lese die Namen und die kleinen Lebensgeschichten von tausend an Corona verstorbenen Menschen, die hier stellvertretend für Hunderttausend veröffentlicht sind.
Ich erinnere mich an Cambridge. Als ich dort vor einigen Jahren Wittgensteins Grab suchte, blieb ich an einem Grabstein stehen, in den vorne und hinten die Daten von Verstorbenen eingeprägt waren. Vorne war der Satz zu lesen: She had done what she could. Ich stand lange dort, und versuchte mir vorzustellen, wie das Leben dieser Frau ausgesehen haben mag. Sie tat, was sie konnte. Hat man sie gemocht? Oder war sie eher eine schwierige Person, der man im Tod bescheinigte, dass sie sich wenigstens bemüht hatte? Für mich war diese Zusammenfassung eines ganzen Lebens in einem einzigen Satz neu. Ich mochte das und dachte, dass ausgerechnet dieser Satz einmal auf meinen Grabstein passen würde.
Und so bin ich tief berührt von diesen vielen gewesenen Leben in New York, die sich nach ihrem Tod noch über einen einzigen Satz in mein Herz zu schreiben vermögen. Der Mann, der seinen Beruf aufgab, um sich um seine Eltern zu kümmern. Der Mann, dessen größte Errungenschaft die Beziehung zu seiner Frau war. Die Großmutter, die voller toller Ideen war. Sie alle sind wir.
They are us.
Ich weiß nicht, ob dieses Bewusstsein sich durchzusetzen vermag. Aber als ich am vergangenen Freitag mit Freunden am See entlang geradelt bin, habe ich viele freundliche Menschen gesehen, die sich ganz offensichtlich freuten, zu grüßen. Allen war Erleichterung ins Lächeln gewoben und doch hielten sie sich noch an den obligatorischen Abstand. In der Stadt war ich noch nicht unterwegs, davon kann ich nicht erzählen.
Ich kann dir aber von meiner Anfang Mai getroffenen Entscheidung berichten. Ich werde weiter für meine alte Dame tätig sein, werde weiter Rücksicht und Vorsicht walten lassen. Insofern habe ich die Lockerungen im Alltag hier gar nicht mehr mitverfolgt. Für mich wird sich in den kommenden Monaten nicht viel ändern, wie schon zuvor nicht. Meine slowakische Kollegin kann nun nach drei Monaten nächste Woche wieder nach Hause fahren. Sie war hiergeblieben, weil sie in der Slowakei nicht in staatliche Quarantäne gehen wollte. Sie freut sich sehr und ich mich mit ihr. Die Suche nach einem Arzt, der einen Covid-Test an ihr durchführt, den sie für die Einreise in die Slowakei benötigt, war aber ein kleineres Abenteuer, was mich wiederum verblüffte. Ich dachte, die Vorarlberger seien besser organisiert.
Was ich der soeben eintreffenden Analyse (ich sitze am Computer im Büro) eines politisch analysierenden Journalisten entnehme, gibt unser Kanzler jetzt das Schlagwort „Eigenverantwortung“ aus. Österreich könne sich keinen zweiten Lockdown leisten, die Arbeitslosigkeit sei höher als in Deutschland und der Schweiz. Man müsse sich, wie es auch in der Schweiz gefordert werde, mehr am Modell Schweden orientieren. Die Zahl der Todesfälle halte sich dort auf einem Niveau, das einer schwereren Grippewelle in Österreich entspricht.
Nun, es ist ohnehin müßig, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn. Und dennoch könnten wir jetzt doch einiges lernen, weil das vermutlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird.
Das Wichtigste scheint mir, dass man niemanden zurücklassen darf. Leave no one behind. Nicht den Geringsten darf man zurücklassen, so auch nicht die geflüchteten Menschen, die in Lagern verharren müssen, nicht die Sklavenarbeiter (Erntehelfer, Arbeiter in Schlachthöfen usw.) in ihren unmenschlichen Unterbringungen, niemanden. Denn jeder Vergessene kann durch nicht erkannte Ansteckung eine neue Welle an Krankheit und Tod hervorrufen. Wenn das nicht aus Empathie heraus verstanden werden kann, so doch wenigstens aus einem kollektiven Egoismus heraus. Das gilt weltweit. Die Prävention bestünde also darin, ordentliche Löhne zu zahlen, gesunde Ernährung anzubieten und für gesundheitliche Leistungen auch außerhalb der Krise zu sorgen.
Und wer soll die Kosten dafür tragen?
Das Geld muss man von den Superreichen holen. 3% des Geldes jener 400 reichsten Amerikaner, die Du erwähntest, würden ausreichen, um alle Amerikaner auf Corona zu testen. Mit diesen 3% könnte man aber auch weltweit die Malaria besiegen, die im 20. Jahrhundert mehr Tote (vor allem Kinder) forderte als die Schwarze Pest. Und so fort.
Ja, ich bin absolut geneigt, ab sofort sämtliche Regierungen, die nicht endlich die Konzerne besteuern und Finanztransaktionssteuer einführen, als verbrecherisch zu bezeichnen.
*
Lieber Peter, als dein Brief ankam und ich von Deinem Murmeltier las, musste ich schmunzeln. Dein Murmeltier ist hier der Igel. Ich sah ihn, als ich nächtens noch auf dem Balkon saß. Ich freue mich über ihn, habe mich aber dennoch vergewissert, dass der Zaun des Hühnergeheges keine Durchschlupfmöglichkeit für ihn bietet. Letztes Jahr hat er sich derart in eines unserer Hühner verbissen, dass wir ihn nur mit einer Kaltwasserdusche zum Loslassen bewegen konnten. Das Huhn ist leider gestorben.
Zu unseren Hühnern gesellt sich seit einer Woche auch eine geschenkte Ente. Es ist jetzt ein fröhliches Gemisch aus Schnattern und Gackern tagsüber in unserem Garten zu hören. Abends geht es allmählich in das Zirpen der Grillen über, mein liebster Hauch von Süden.
In diesen Tönen liegt Frieden für mich.
Ich freue mich, dass es euch gut geht, dass Deine Mutter so gut versorgt ist, dass meine Tochter in Portugal zum ersten Mal einen Ausflug machen konnte, und dass meine Tochter in Wien, die ursprünglich nach Lissabon fliegen wollte, jetzt ab Anfang Juni ihren Urlaub bei uns verbringen wird. Ich freue mich, dass zwei meiner Söhne sich fragen, wie sich ein gutes Leben nach der Coronakrise gestalten lässt. Sie haben die Idee geboren, gemeinsam mit Freunden den brachliegenden Acker zu bestellen, und so werden wir im kommenden Jahr viel zu studieren und vorzubereiten haben.
Und ich freue mich, dass meine Eltern relativ sorgenfrei über diese Zeit gekommen sind und meine lungenentzündungsanfällige Pflegeschwester, die sie seit bald vierzig Jahren betreuen, gut behüten konnten. Das Geburtstagsfest zum Vierziger, den sie im April gefeiert hätte, wird jedoch wohl noch weiter in die Zukunft verschoben werden müssen.
Jetzt, da die Welt sich wieder öffnet, kann ich in meine eigene Stille zurückkehren, die auf eine etwas verschrobene Art jenem schiefen Haus im Garten des Fürsten Orsini in Bomarzo gleicht: erst im Verlassen desselben wurde mir schwindlig.
So schicke ich Dir aus diesem Beginn einer neu zu erobernden Stille meine besten Wünsche für Dich und Deine Familie
und grüße Dich herzlich,
Gabriele
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 5: mit «primavera» entwerfen sie ein primaveristisches programm …
weiter ...schaan, 23. mai 2020
liebe antonie,
mit «primavera» entwerfen sie ein primaveristisches programm:
ein blühen, zittern und balancieren. von worten ausgehen, sie kindergleich kosten, mit worten schlendern, taumeln, kreiseln, beiläufig den eigenen schwerpunkt finden.
ein innehalten, ein grosszügiges, notwendiges innehalten in der & wider die pandemie.
sie sprechen mir aus der seele. das leben, so sagte es ein freund, ist eine kunst der begegnung.
das stimmt – ich würde sagen – vorbehaltlos. es setzt ein angesprochensein voraus. genau und tiefenscharf wie der satz von dietmar kamper, den sie mir aufgeschrieben haben, ein geheimnis nennt. ein satz, eine gleichung fast von geometrischer strenge, unauslotbar, vielleicht von der paradoxen wendung/windung einer möbius-schleife. das tröstliche des versuchs: der gegenstand der kunst bleibt unnennbar und flüchtig, im geheimniszustand.
ein geheimniszustand, wovon inger christensen eine ahnung vermittelt im essay «die seide, der raum, die sprache, das herz». ein essay, den man zirkulär zu lesen beginnt, wieder und wieder, einer zirkularatmung gleich. einen gedankenraum, den man zirkulär ein- und ausatmet,
der einen verwandelt.
es ist eigenartig. vieles, woran ich arbeite, erscheint mir als ein „retour à l’ordre“, als eine rückbesinnung auf eine grundgestimmtheit. an welche innere ordnung, an welche stimme soll man sich wenden? die inneren affinitäten kommen einem zuhilfe in der diffizilen phase des findens.
wer im sichtbaren arbeitet, muss sich seiner mittel bewusst sein. koroliovs spiel traf mich in seiner porösität. er stellt ein prinzip unter beweis: es genügt nicht, den bauplan einer partitur zu kennen,
sondern das entscheidende liegt darin, den inneren raum im zuhörer erfahrbar zu machen, zu erschliessen, was gilt. sein instrumentarium aus- und inwendig kennen.
es sind fraglos die meister, die einen leiten und begleiten, die einem herz und sinne öffnen.
diese erfahrung mache ich jetzt, heute, bei den grafischen arbeiten von bruno monguzzi, aufmerksam geworden durch einen NZZ-artikel.
die arbeiten von monguzzi erklären sich selbst in ihrer poetischen wucht, er ist ein kopf- und handarbeiter von rang. seine plakate sind und wirken so, als ob eine agile, sichere und souveräne hand, die details an die richtige stelle rückt. monguzzi hat eine ahnung. ich vertraue seiner stimme, folge seinem instinkt. im bemerkenswerten film von heinz bütler zur arbeit von bruno monguzzi, (zu sehen unter https://vimeo.com/394134905/d2c9c7c1d7) lässt er den gestalter anhand eigener arbeiten von seinem arbeitsprozess sprechen, von seiner recherche, seiner methodik, rezeptlos. er spricht von innerstem wissen. ich finde das fesselnd. künstler sprechen nur vor ihrer arbeit gut.
verzeihen sie die abschweifung.
2 dinge, 2 hausarbeiten stehen an: ein solidaritätsbeitrag für das hilfsprojekt eines indonesischen künstlers, der in liechtenstein lebt, der ein bambus-aufforstungsprojekt auf java initiiert. dafür möchte ich herzblut spenden in form von drei gouachen, die ich in gedanken
längst entworfen habe, die aber noch nicht gemalt sind. dann beschäftigt mich die edition eines textes einer befreundeten schriftstellerin zu einem bild ihres mannes, «der mann in der blüte», die einer besonderen feinabstimmung bedarf. ich arbeite mit einem buchdrucker und buchbinder in personalunion zusammen, der meinen anspruch kennt. das bestimmen von schrift, die wahl von papier, die anmutung des druckwerks verlangt fingerspitzengefühl und treffsicherheit in der manufaktur. ich komme der sache allmählich näher.
das brauch ich ihnen nicht weiter zu erläutern. sie kennen und bewegen sich in dem metier.
sie werden mir vielleicht einmal erzählen, wie sich die zusammenarbeit mit ihrer illustratorin isabel pin ergab, wie sich sich gefunden haben. ihr gemeinsames buch «kleiner könig, wer bist du?» stellt einen grossartigen „wurf“ dar.
zu beobachen, wie sich affinitäten ereignen, ist eine erhellende erfahrung: alle entfernungen sind im nu überwunden. auch davon legen sie zeugnis ab in ihrem inneren gedankenstrom mit der chinesischen komponistin cong wei. wahlverwandschaft, wenn sich gedankenräume berühren und zu einem kreisendem gespräch entfalten, bedeutet ihnen wie mir ein rares geschenk.
ich empfinde in diesem zusammenhang tatsächlich das verbindliche continuum der farbe weiss als balsamisch: WEISS, «die farbe der stille», verstanden als die summe aller farben, als resonanzraum aller farben, die sie zum klingen bringt.
white matter: white matters!
beim morsezeichen dachte ich gleich an den ruf des kuckucks, den ich vor einer woche im ruggeller riet wiederhörte. wie kann man diesen ruf vergessen, den man nicht zu orten vermag.
kaum zu fassen, ist der ruf dieses «schelms», der einen aufhorchen lässt und ins sinnen bringt,
wie ein echolot im all.
ich grüsse sie herzlich über den bodensee hinaus.
herzlich, hansjörg
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 2: Die Schlussworte deines Briefes haben mir das Lied eines texanischen Rockmusikers in Erinnerung gerufen …
weiter ...Liebe Barbara!
Die Schlussworte deines Briefes haben mir das Lied eines texanischen Rockmusikers in Erinnerung gerufen, den ich sehr mag: Wir blicken auf dieselben Sterne, sein Kontext war ein anderer, der Kern aber bleibt der gleiche, und wir blicken auf dieselben Berge. Und so haben wir, obwohl wir uns nicht kennen, schon etwas, das uns verbindet, außer dem Schreiben natürlich, der Ausgangsbasis dieses Briefwechsels.
Über die Sterne weiß ich wenig, die Berge aber liebe ich, ich liebe sie mit der Hassliebe, die man letztlich oft für jene Dinge empfindet, die uns am meisten berühren, ich betrachte sie gern, doch ich hasse die Kälte, ich stehe gern oben, doch ich hasse es, vom Aufstieg Knieschmerzen zu bekommen. So sind wir eben, wir Menschen: im Verlauf von Jahrtausenden herausgebildete Merkmale und Probleme, und mittlerweile ändert uns keiner mehr.
Mir gefallen die Gipfel, ich wandere aber auch gern im Flachland (wahrscheinlich eben wegen der besagten Kniebeschwerden), ich mag die Wälder, die Lichtungen, die Luft, die man atmet, den Duft dieser Luft, den Unterholzgeruch. Früher bin ich wirklich viel gewandert, musst du wissen. Wenn ich dir jetzt aber sagen müsste, welches mein Lieblingsberg ist, nun, da bringst du mich ein wenig in Verlegenheit. Nicht so sehr, weil ich keinen habe, sondern weil es in etwa so ist wie beim berühmten Buch, das man auf die einsame Insel mitnimmt. Es hängt davon ab, wann man dich danach fragt, von deiner momentanen Gemütsverfassung, glaube ich, nicht jeden Tag würde man letztendlich den gleichen Titel nennen und dann, seien wir ehrlich, ein einziges Buch für die einsame Insel ist doch etwas wenig.
Im Augenblick empfinde ich, dass es mit den Bergen in etwa genauso ist. Ich könnte dir den Mauna Kea nennen, einen sehr hohen Vulkan auf den Hawaii-Inseln, ich war noch nie oben, habe ihn von unten gesehen, er befindet sich aber auf einer Insel, die mir sehr gefällt und auf die ich mich in der Fantasie zurückziehe, wenn mich das Fernweh überkommt. John Steinbeck, mein Lieblingsautor, meinte, der eine reise, um Bücher zu schreiben, der andere schreibe Bücher, um im Kopf zu reisen, ich habe mich immer ein bisschen zwischendrin gefühlt.
Um auf die Berge zurückzukommen, ich könnte auch sagen, die im Passeiertal, von wo mir ein wunderschönes fünftägiges Trekking dauerhaft in Erinnerung bleibt, oder der Becco di Filadonna, ein niedriger Gipfel im Trentino mit atemberaubendem Ausblick. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ich die Dolomiten sage, unsere Hausberge, die ich von meiner Stadt aus sehe, den Rosengarten, der mit seinem Profil mein Bozen Town beherrscht. Es ist der Berg, den ich täglich auf meinem Weg zur Arbeit ins Museum sehe und den ich den Museumsbesuchern zeige, wenn ich sie auf die Turmspitze führe und ihnen Geschichten erzähle, die mit den Bergen, die wir sehen, zu tun haben, denn darauf verstehe ich mich im Grunde am besten: erzählen. Worüber schreibst du denn gewöhnlich, Barbara?
Erzählen ist die Essenz meines Lebens, um welche Art von Erzählung es auch immer gehen mag, das habe ich von meiner Mutter und meiner Großmutter geerbt, das ist alles in den Genen, im Reinzustand. Wichtig ist, jemanden zu finden, der bereit ist, dir zuzuhören, sich selbst zu erzählen
ist hart. Ich denke an meine Großmutter und frage mich, was sie von dieser ganzen Geschichte mit der Pandemie gehalten hätte, sie, die zwei Weltkriege und die famose Spanische Grippe mitgemacht hat … Obwohl sie jetzt weit über hundert Jahre alt wäre, und in Anbetracht der Erziehung, die sie genossen hat, glaube ich, dass sie sie nicht als Strafe Gottes angesehen hätte. Sie war eine aufgeklärte Frau.
Auch wenn die christliche Religion den Leuten zu viele Jahrhunderte lang von einem strafenden, strengen und schrecklichen Gott erzählt hat. In gewisser Weise ein bisschen das Gegenteil jener olympischen Götter, von denen du mir in deinem Brief schreibst: die waren im Vergleich dazu Operettengötter, wenn man so sagen kann, zu unsäglichen Bosheiten fähig, gewiss, doch voller Fehler: Neidhammel, unverbesserliche Sünder und Gauner, genau wie die Menschen, die sie sich so ausgedacht hatten, nach ihrem Ebenbild. Ganz das Gegenteil vom Gott der Christen. Und von dem der anderen Monotheisten.
Ich bin drauf und dran, mich auf ein Minenfeld zu begeben, und verlasse es schnell wieder, bevor ich mich darin festfahre. Worauf ich hinauswollte, ist jener Punkt in deinem Brief, an dem du auf die Desertifikation und auf den Klimawandel zu sprechen kommst, ein Thema, das uns allen nahegeht, eines der vielen, gegenüber dem ich mich gleichzeitig ohnmächtig und schuldig fühle: ohnmächtig, weil ich nicht sehe, was meine getrennte Müllsammlung nützt (die ich auf jeden Fall weiterhin praktiziere), während in den Ozeanen ganze Plastikatolle entstehen; schuldig, weil ich mir vollkommen bewusst bin, dass der Verzicht auf so viele unverzichtbare Bequemlichkeiten unserer Tage der Umwelt helfen könnte.
Was mich an diesem Virus-Notstand beeindruckt hat, ist die Feststellung, dass die Zwangsklausur, zumindest in der ersten Phase, zu einer zeitweiligen Entvölkerung der besiedelten Räume geführt hat, und ich beziehe mich genau auf unsere Alpenräume: mit den gezwungenermaßen zu Hause eingeschlossenen Menschen ist es in einigen Dörfern des Trentino dazu gekommen, dass sich Wildtiere (Bären und Steinböcke) bewohnten bzw. unbewohnten Gebieten näherten und sogar auf Balkone kletterten. Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, das ist eine Folge der Quarantäne. Was meinst du?
Eher als eine Strafe scheint mir das eine Warnung von Mutter Natur zu sein, die zu Recht darüber erbost ist, wie wir mit ihr umgehen.
Manche glauben, dass das Schlimmste schon vorbei ist. Weißt du, Barbara? Ich bin mir da nicht so sicher. Die Kriege, die unsere Großeltern und Eltern erlebt haben, waren zweifellos schlimmer, doch ich traue mich nicht, einen Schlussstrich unter dieses unerwartete Ereignis zu ziehen, gegen das es noch kein Gegenmittel gibt. Ich versuche, optimistisch zu sein, doch die Aussicht erscheint mir düster und bedrohlich. Ich versetze mich in die Lage jemandes, der, so wie du, kleine Kinder hat, ich denke, es ist eine moralische Pflicht, auf eine unbeschwerte Zukunft zu hoffen, für sie zumindest. Andererseits wird, wie du geschrieben hast, der versprengte Samen von heute zur Blume von morgen gedeihen und, wenn ich mich in diesem verrückten, beispiellosen Frühling so umschaue, sehe ich die Natur erblühen, diesem unserem Menschengeschlecht mit seinen Fehlern und Mängeln zum Trotz.
Und mit diesem positiven Befund (nicht in Bezug auf das Virus!) wünsche ich dir einen schönen Abend, bis bald,
aloha, wie man im Schatten des Mauna Kea sagt
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Yannic Han Biao Federer & Verena Rossbacher
Brief 5: Die Mauer im Hang ist jetzt nicht mehr alleine …
weiter ...Verena,
die Mauer im Hang ist jetzt nicht mehr alleine, eine zweite hat sich hinzugesellt, offenbar sollen sie gemeinsam das Gewicht der Anhöhe tragen. Davor noch immer der gelbe Hydraulikbagger, er schichtet groben Kies zwischen Erdreich und Beton, abseits Aufschüttungen verschiedenfarbiger Erde, die wohl obenauf liegen wird, mit dem Rüttelstampfer zu einem festen Fundament gefügt. Ein Vorarbeiter gibt Anweisungen, wenn er die Handfläche neigt, kippt die Baggerschaufel seitwärts, gießt ihren Inhalt in die Senke, hält er sie gerade, versiegt ihr Strom. Manchmal winkt er dem Kollegen im Cockpit, bevor er von der Leiter springt, einen Spaten schultert und hinter dem Betonvorsprung verschwindet, um dort irgendetwas zurechtzuscharren. Es dauert, so lange, dass ich ungeduldig werde, weil ich zurück an den Schreibtisch muss, schließlich tatsächlich hinübergehe und nur noch hoffen kann, dass er dort nicht versehentlich begraben wird.
Entschuldige, schon wieder die Baustelle, ich fand es nur so schön, wie dort die Dinge und Menschen zusammenwirken, ineinandergreifen, helfend und vertrauend aufeinander. Und eigentlich eint auch uns beide mehr, als du glaubst. Zumindest als Einheit einer Differenz, würde Luhmann sagen, oder, in unserem Fall, als Einheit zweier Differenzen. Laut und leise. Schnell und langsam. Das Schnelle und Laute bringt es aber mit sich, dass manches nur verwischt auf den Bildträger findet, dass manches verzerrt auf der Tonspur. Es freut mich also, dass du das Stichwort der Genauigkeit aufwirfst, es ist mein Thema.
Dass es dir dort, wo ich von Politischer Theorie spreche, zu ungenau und abstrakt wird, beruht auf einem alten Missverständnis, das sich insbesondere an Theorie gut zeigen lässt. Abstraktion ist nämlich keineswegs etwas, das man erreicht, indem man alles Konkrete aus einem Bild entfernte, nein, es ist vielmehr etwas, das einer bewussten Setzung gleichkommt und sich in ihrer potentiellen Anwendbarkeit erst noch zu bewähren hat. Der veränderte Blick, den Theorie bietet, etwa der paranoide Blick der foucaultschen Machttheorie, entspricht ganz der Desautomatisierung von Wahrnehmung und Sprache, den die Formalisten als Wesenskern der Poetizität beschrieben haben, und es macht sie zur literarischsten Form aller wissenschaftlichen Literatur. Theorie ist also, wie Literatur, nicht die irgendwie abstrahierende Reformulierung ihrer Umwelt. Sie ist ein anderer und neuer Zugang zu ihr.
Um diesen aber zu erkennen, muss man schon genau lesen, muss man schon mitbekommen, dass ich autoritären Systemen an keiner Stelle eine wie auch immer geartete Affinität zu diskursiver Auseinandersetzung attestiert habe. Vielmehr ging es um die tiefgreifende Unterscheidung zwischen Systemen, in denen es ein heterarchisches Treiben zwischen eigenlogisch operierenden Subsystemen gibt, und solchen, in denen ein hierarchisch übergeordnetes Zentrum seine Kommunikationsweise jederzeit und nach Belieben den übrigen aufoktroyieren kann. Weniger luhmannianisch gesprochen: Wir haben das Glück, dass wir nicht über Politik sprechen müssen, wenn wir es nicht wollen. Andere haben das nicht. Es ging mir also gerade um einen pluralistischen Diskurs, den du dir doch auf die Fahnen geschrieben zu haben glaubst, nur dass du dich, in der angestrengten Negation eines vermeintlich übermächtigen Mainstreams, durch gerade diesen bestimmen lässt.
Wenn man ihn also erfassen wollte, diesen anderen und neuen Zugang, so müsste man auch die Radikalität erkennen, die in einer knappen Wendung verborgen liegen mag. Dass ich auf Arendts Postulat von der physischen Kopräsenz verwies, konntest du nicht nachvollziehen, du schriebst, du wüsstest gar nicht, wer denn um alles in der Welt diesen direkten physischen Kontakt nicht für wichtig hielte. Ich kann‘s dir sagen: ungefähr fast alle. Denn was Arendt im Kern fordert, ist ein räterepublikanisches Gemeinwesen, eine gestaffelte Anordnung öffentlicher Erscheinungsräume, die nur möglich werden, indem Menschen sich unmittelbar begegnen und diskutieren. Medialisierte Vermittlungsinstanzen und anonyme Wahlverfahren schließt sie aus, von Parteien will sie nichts wissen. Einzig die Diskussion zwischen physisch Anwesenden gewährleistet für sie das, was sie als die Freiheit des Politischen begreift. Die Phantasien von ‚direkter Demokratie‘, wie sie inzwischen auch von rechten Populisten aufgegriffen werden, sie wären ihr ein Graus. Zu groß die Gefahr, dass andere Mechanismen in Gang kommen, insbesondere diejenigen, die sie massentheoretisch (und durchaus problematisch) zu beschreiben versuchte. Aber auch hier gilt: Es bedarf der Distanz und der Zeit, um sich dies klarzumachen. Das Gaus-Interview auf YouTube zu gucken, es wäre Arendt wiederum nichts als ein unzureichendes Surrogat.
Ich verhandle all das am Beispiel der Theorie, weil ich hoffe, dadurch vielleicht den ein oder anderen Reflex zu mildern, etwa wenn sofort um Befindlichkeiten gekreist wird, nur weil irgendwo irgendwer nicht monothematisch und tagesaktuell im Chor mitbellen möchte. An der Theorie wird deutlich, was auch die Literatur betrifft: Sie kann nur sein, was sie ist, wenn sie nicht ist, was die anderen schon sind. Wer das als empfindsamen Rückzug in den Elfenbeinturm abtut, hat ein sehr begrenztes Verständnis von dem, was politisch ist, was Gesellschaft ist und was Relevanz bedeutet.
Eigentlich doch ein schönes Thema für ein Gespräch mit offenem Ausgang, für ein gemeinsames Nachdenken darüber, was das sein könnte, politisch zu schreiben, gerade weil wir so unterschiedlicher Meinung zu sein scheinen. Und ohne künstliches Streithammelgeblöke könnte man auch einmal riskieren, nicht unbedingt recht haben zu müssen. Das hat das Miteinandersprechen ja gemeinhin dem Streit voraus. Aber offenbar hast du schon die Segel gestrichen, was mich doch wundert, erst unbedingt Streit haben wollen, ja, unbedingt, du sagtest, er müsse sein, nicht, er könne. Und dann aus dem Raum stürmen, weil es doch irgendwie anstrengend wird.
Na ja. Wie dem auch sei. Hab es gut, Verena. Byebye.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Peter Gilgen & Gabriele Bösch
Brief 3: Meine Antwort auf Deinen Brief liess lange auf sich warten …
weiter ...Liebe Gabriele,
meine Antwort auf Deinen Brief liess lange auf sich warten. Das hat zwar mit den Auswirkungen der Coronakrise zu tun, aber es gibt in unserem Fall keinen Anlass zu Sorge. Wir halten uns seit zwei Monaten in unserem Haus auf und machen nur ab und zu einen kleinen Spaziergang. Diese Woche ist das Wetter besser geworden, nachdem es Anfang Mai noch zweimal schneite. Alles im Garten blüht. Die Bäume, die letzte Woche noch kahl waren, tragen mittlerweile Blätter, die man fast beim Wachsen beobachten kann. Jeden Abend, wenn ich zum Küchenfenster hinausschaue, wird die Waldwand undurchdringlicher.
Schon beim ersten Lesen Deines Briefes wollte ich so manche Bemerkung dazwischenwerfen: etwa dass ich mit den Herausforderungen der Pflegefrauen, die sich um alte und demente Patienten kümmern, vertraut bin. Meine Mutter, die in Liechtenstein lebt, wird seit gut zwei Jahren abwechselnd von verschiedenen Pflegerinnen betreut. Alle von ihnen kommen aus osteuropäischen Staaten. Die meisten haben ihre eigenen Familien, die sie unter normalen Umständen nur alle drei Wochen zu sehen bekommen und jetzt, aufgrund der verschärften Lage, sogar nur alle sechs Wochen. Die jetzige Betreuerin sagte mir letzte Woche am Telefon, dass sie nun jeweils vor Dienstantritt im Landesspital Vaduz einen Covid-19-Test machen müsse. Das sei die neue Vorschrift, um die betreuten Menschen zu schützen. Obwohl dieses Erfordernis ihr zusätzliche Umstände bereitet – ich vermute, dass sie fast einen Arbeitstag dadurch verliert, da sie kein eigenes Auto besitzt und auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist –, beklagte sie sich mit keinem Wort. Ganz im Gegenteil: Sie lobte die Massnahme, weil dadurch die Schwächsten geschützt würden. Und diese Frau, die ich nur als Telefonstimme mit slawischem Akzent kenne, sagte mir auch sehr eindringlich, dass ich mir keine Sorgen um meine Mutter machen müsse.
Liebe Gabriele, ich vermute, Du wirst mich verstehen, wenn ich Dir schreibe, dass ich in diesem Moment gerührt und zugleich erschüttert war: gerührt von der tatkräftigen Sorge, die aus den Worten dieser Frau sprach, und erschüttert, weil ihre anpackende Hilfsbereitschaft sich so deutlich abhebt von der Empathieermüdung, die nach Wochen des sogenannten Lockdowns allenthalben zu beobachten ist. Schlimmer noch als die rasch aufgebrauchte Solidarität ist ein allgemeiner Mangel an Fantasie. Waren am Anfang der Krise noch zahlreiche Stimmen im öffentlichen Diskurs zu vernehmen, die darauf pochten oder wenigstens darauf hofften, dass es nach der Bewältigung dieser enormen Herausforderung keine einfache Rückkehr zur gesellschaftlichen und politischen Normalität geben könne, so scheint sich das Blatt allmählich zu wenden. Das liegt auch und vielleicht sogar vor allem daran, dass sich die Diskussion zunehmend um eine unselige Kostenrechnung dreht, die Menschenleben und wirtschaftliche Verluste miteinander verrechnet, als wäre unsere Wirtschaftsordnung ein unabänderliches Naturgesetz. Als wären die ohnehin Alten und Schwachen den Preis ihrer Rettung nicht wert.
Hier ist eine einfache Frage, die sich ohne Mut und Fantasie nicht zufriedenstellend beantworten lässt: Handelt es sich bei der ganzen Angelegenheit wirklich um ein Nullsummenspiel zwischen den für die Krankheit Anfälligen und denjenigen, die am meisten an den wirtschaftlichen Folgen zu leiden haben – den Kleinunternehmern, den Selbständigen, den Arbeitnehmern, die um ihre Stelle fürchten oder sie schon verloren haben oder wie hier in den USA kräftige Lohnabstriche in Kauf nehmen müssen?
Und gleich noch eine weitere Frage: Wie kann es sein, dass in der Anfangsphase der Coronakrise in Amerika, das Vermögen der US-Milliardäre in nur 23 Tagen, vom 18. März bis zum 10. April, um 9.5% oder 282 Milliarden Dollar anstieg, während gleichzeitig 22 Millionen Amerikaner arbeitslos wurden (mittlerweile sind es über 36 Millionen), von denen viele mit der Stelle auch ihre Krankenversicherung verloren? Jeff Bezos, Gründer von Amazon und derzeit reichster Mensch auf Erden, darf sich einen neuen Geldspeicher bauen, denn seit Anfang Jahr hat sich sein Vermögen um märchenhafte 25 Milliarden vermehrt. Ich wage zu sagen: fast ohne sein Zutun. (Diese Zahlen entnehme ich übrigens nicht irgendeinem revolutionären Manifest, sondern einer Meldung vom 1. Mai auf der Webseite businessinsider.com, die zur für konservative und gutbürgerliche Leser unverdächtigen Axel-Springer-Verlagsgruppe gehört.)
Es passt zu dieser Geschichte, dass Whole Foods – eine gehobene Supermarktkette, die 2017 von Amazon, dieser über alle Massen erfolgreichen Firma, die keinen Dollar Steuern bezahlt, übernommen wurde – seine Angestellten schon im März dazu aufforderte, die ihnen zustehenden bezahlten Ferien ihren erkrankten Kollegen zur Verfügung zu stellen, damit diese der Arbeit fernbleiben dürfen. Auch wenn solche Zustände in Europa noch nicht denkbar sind, ist die ihnen zugrunde liegende Logik auch drüben längst allgegenwärtig. Denn auch innerhalb der europäischen Staaten gibt es einen Umgang mit dem Krankheitsrisiko, der bestehende soziale Ungleichheiten verstärkt und auf eine zweigeteilte Gesellschaft hinausläuft: Auf der einen Seite gibt es die Schützenswerten, die zu den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten gehören und die zum Teil sogar von der Krise profitieren. Auf der anderen Seite stehen die Verlierer, die Minoritäten, die Flüchtlinge, die Ungebildeten, die Arbeitslosen, die Behinderten – alle die im gesellschaftlichen Wettbewerb von Anfang an benachteiligt waren und den Anschluss verloren haben. Die besondere politische Tragödie besteht darin, dass viele dieser Habenichtse sich noch immer zum Mittelstand gehörig wähnen und sich von den falschen Versprechungen und Verschwörungstheorien populistischer Politiker verführen lassen. Fast ohne es zu merken, verfallen sie dem neuen Faschismus und tragen ihn immer weiter in die gesellschaftliche Mitte, wenn sie anderen Benachteiligten – gestern waren es die Flüchtlinge, heute sind es die Alten und Kranken – die Solidarität aufkündigen, in der Hoffnung aus dem Verteilungskampf um die wenigen Almosen der Regierung selbst als Sieger hervorzugehen.
Noch etwas anderes stört mich an den vielen öffentlichen Protesten gegen die von den Regierungen verordneten Massnahmen: In Ländern wie Deutschland oder Österreich führen lautstarke Kritiker die relativ niedrigen Infektions- und Todesraten als Beweis dafür an, dass die ganz Krise aufgebauscht sei und vor allem dazu diene, die Bevölkerung durch Notrechtsverordnungen zu entrechten. Um solche Skeptiker von ihrem Irrtum zu überzeugen, bräuchte es ein Alternativuniversum, in dem nichts gegen die Verbreitung von Covid-19 unternommen worden wäre. Erst das volle Ausmass der Katastrophe würde die Kritiker widerlegen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass solche Alternativszenarien tatsächlich existieren, wenn auch in begrenzterem Rahmen: In Norditalien und New York City, zwei der am schwersten heimgesuchten Orte, kamen die Schutzmassnahmen zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Ich werde die Bilder von Massengräbern in New York nie vergessen. Zugleich setzt Schweden bewusst auf Herdenimmunität und nimmt dafür den Tod von Tausenden in Kauf, in der Hoffnung, bei späteren Ausbrüchen viele Todesfälle verhindern zu können. Das mag plausibel klingen. Doch die Strategie ist unter Fachleuten umstritten. Die überwiegende Mehrheit der Virologen glaubt nicht an ihren Erfolg. Es sind allerdings nicht allein diese fachlichen Einwände, die mich nachdenklich stimmen. Es ist etwas Grundlegenderes: Ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ganze Bevölkerungsgruppen ungefragt einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt werden sollen zum Wohle der Jüngeren und Gesünderen und wohl auch Reicheren. Sind die Leben der Alten und Schwachen weniger wert?
Es ist, als ob ein Rettungsschwimmer am Flussufer tatenlos zusähe, wie ein Schwimmer ertrinkt, nur weil er vermutet, dass er demnächst zwei andere wird retten müssen. Würden wir diesen Bademeister für seine Weitsicht loben? Was, wenn es ihm später tatsächlich gelänge, zwei andere in Not Geratene zu retten, weil er noch frisch und auf seinem Posten ist? Würden wir ihm die besondere Kaltblütigkeit, die es brauchte, um den ersten Schwimmer ertrinken zu lassen, hoch anrechnen? Würden wir wollen, dass ein solcher Bademeister über unser Leben wacht?
Es sind solche Rechnungen, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich nehme nicht in Anspruch, es besser zu wissen, und glaube, dass es fatal ist, wenn wir hier allzu schnell in ein Schwarz-Weiss-Denken verfallen. Ich zweifle nicht daran, dass auch die schwedischen Behörden nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, medizinisch gute und moralisch vertretbare Entscheidungen zu fällen. Erst am Ende wird sich zeigen, wer die beste Bilanz hat. Was mich aber bedrückt, ist gerade dieses Rechnen, die Rede von der Bilanz, das ökonomische Denken, das darüber bestimmt, was dieses oder jenes Leben wert sein soll. Ohnehin wird in unserer durchökonomisierten Gesellschaft zu oft Wert als blosser Preis missverstanden. Was uns dies oder jenes kostet, ist aber eine ganz andere Frage als: Was ist es uns wert?
Ich weiss, dass die Frauen, die meine Mutter betreuen, sich sehr um sie kümmern. Sie tun ihr gut, weit über die eigentliche Hilfe hinaus. Es gab die eine oder andere, die den Job nicht lange machen konnte, weil er zu anstrengend und aufreibend ist. Oder weil sie Heimweh nach ihrer eigenen Familie hatte. Diejenigen, die nach dem ersten Einsatz wieder gekommen sind, haben alle etwas Resolutes und zugleich Herzliches. Sie erzählen meiner Mutter von ihren Familien, von der Landschaft und vom Essen bei ihnen zuhause. Wenn es innerhalb Europas kein dramatisches wirtschaftliches Gefälle gäbe, könnten die meisten Betreuten sich diese Hilfe nicht leisten. Ähnliches gilt in fast allen Pflegeberufen. Die Covid-19-Krise hat das deutlich gemacht. Man spendet den Krankenpflegern, Ärztinnen und Betreuerinnen Beifall und lobt sie als Heldinnen unserer Zeit. Ob dies etwas an ihrem Status und dem Gesundheits- und Pflegesystem insgesamt ändern wird, sobald die Krise vorüber ist, wird sich zeigen. Ich vermute, dass die während des Lockdowns gewonnenen Einsichten, als die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen auf sich gestellt und gezwungen waren, über die alltäglichen Abläufe, die plötzlich nicht mehr spielten, nachzudenken, sich bald nach der Normalisierung wieder verflüchtigen werden. Schon jetzt wollen die meisten nichts mehr, als sich wieder dem Vergnügen hingeben zu können. Nicht dass daran etwas falsch wäre. Ich gebe zu, dass auch ich mir die Rückkehr unbeschwerter Lebensfreude wünsche, die sich zur Zeit irgendwo im Dunkeln verkrochen hat. Doch muss eins das andere ausschliessen? Könnte nicht die wiedergewonnene Freude uns dazu bewegen, unsere Prioritäten zu überdenken und für mehr Gerechtigkeit einzustehen?
Es könnte sein, dass diese Krise noch lange nicht ausgestanden ist oder dass es in einem Auf-und-Ab immer wieder neue Infektionswellen geben wird. An meiner Universität ging letzte Woche das Frühlingssemester zu Ende. Prüfungen und Abschlussarbeiten stehen noch aus. Alles findet seit Mitte März auf virtuelle Weise statt. Schon seit ein paar Wochen steht fest, dass in diesem Jahr Sommerkurse, -konferenzen und alle sonstigen Veranstaltungen, Konzerte, Aufführungen und Ausstellungen ausfallen werden. Wie im Herbstsemester Vorlesungen und Kurse abgehalten werden sollen, steht noch in den Sternen. Alle paar Tage erhalten wir von höherer Stelle eine Zusammenfassung der neuesten Massnahmen und Beschlüsse. Dabei werden auch die Konkurrenzinstitutionen genau beobachtet.
Einzelne Universitäten haben bereits angekündigt, im Herbst ganz auf den Präsenzunterricht zu verzichten. Andere haben die Krise zum Vorwand genommen, um unrentable Abteilungen (oder was dafür gehalten wird, nicht immer mit guten Gründen) zu schliessen und die Personalkosten durch Entlassungen soweit zu reduzieren, dass sie die erwarteten finanziellen Einbussen im Herbst auffangen können. Es zeichnet sich ab, dass viele angehende Studenten davon absehen werden, in diesem unguten Jahr ihr Studium zu beginnen. Manche unter den Fortgeschritteneren werden ein Zwischenjahr einlegen, denn wer will schon die hohen Studienkosten – an den führenden Privatinstitutionen mittlerweile mehr als 50’000 Dollar pro Jahr – für besseren Fernunterricht bezahlen?
Man kann davon ausgehen, dass dieser Geschäftseinbruch längerfristig eine grosse Anzahl von Universitäten ruinieren wird. Eine Hochschulbildung wird ein exklusiveres Gut werden, und das schon heute im amerikanischen Bildungssektor sehr ausgeprägte Kastensystem wird sich weiter verfestigen. All diese Tendenzen würden sich exponentiell verstärken, falls das social distancing über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden müsste oder wenn es eine massive zweite oder gar dritte Corona-Welle mit entsprechenden Lockdowns geben sollte. Vielleicht wird 2020 einmal als das Jahr gelten, in dem die klassische Universität zu existieren aufhörte. Auflösungserscheinungen wie die fortschreitende Digitalisierung, die Übernahme der Bildungsinstitutionen durch Manager und profitorientierte Firmen und das fehlende politische Bekenntnis zu einer qualitativ hochstehenden Bildung für alle gibt es zwar schon länger. Allerdings wirkt sich die gegenwärtige Krise wie ein Brandbeschleuniger aus.
Liebe Gabriele, wären wir mitten im Gespräch, anstatt uns Briefe zu schreiben, dann gäbe es jetzt eine Pause. Ich wäre für einen Moment mit meinen Gedanken allein.
Am Computer sitzend schaue ich auf und blicke in den Garten hinaus, wo seit zehn Tagen der Kirschbaum prächtig blüht, direkt vor meinem Fenster. Vor ein paar Tagen sprang einen ganzen Vormittag lang ein Goldzeisig zwischen den hellrosa Blüten von Zweig zu Zweig. Sein gelbes Gefieder leuchtete auf, wenn er aus dem Schatten ins Licht hüpfte. Gestern war es ein Baltimoretrupial (ich musste den deutschen Namen nachschlagen), ein in Nordamerika recht weit verbreiteter Vogel, den ich zuvor noch nie bemerkt hatte. Seine Unterseite war von leuchtendem Orange, das je nach Lichteinfall eher ins Gelbe oder Rote changierte. Mein vierjähriger Sohn hatte ihn in unserem Baum entdeckt und rief mich aufgeregt ans Fenster, wo wir dem Vogel lange zusahen.
Auch das Murmeltier ist seit meinem letzten Brief jeden Morgen und Abend in unseren Garten gekommen. Vor ein paar Tagen bemerkten wir, dass es am Rücken eine Wunde hat, die aber schon wieder langsam verheilt. Es könnte ein Streifschuss gewesen sein oder der Biss eines grösseren Tiers, vielleicht eines Kojoten oder eines Hundes. Man sieht die Murmeltiere hier vor allem als Schädlinge, weil ihr Bau recht ausgedehnte Dimensionen annehmen kann. Ihre Grabungen richten in manchen Gärten Verwüstungen an und können sogar das Fundament eines Hauses destabilisieren. Man würde mir wahrscheinlich mit Unverständnis begegnen, wenn ich erzählte, dass ich das Murmeltier in unserem Garten nicht nur dulde, sondern mich jeden Tag auf sein Erscheinen freue. Genau zu der Zeit, als wir uns wegen des Virus in unsere Häuser zurückziehen mussten, erwachte es aus seinem Winterschlaf und hatte vielleicht seinen schönsten, weil ungestörtesten Frühling seit langem. Ich wünsche mir, dass seine Wunde gut verheilt und dass es uns noch oft besuchen wird. Es ist mein Wappentier geworden, ein Zeichen der Hoffnung: dass es auch für uns Menschen wieder einen besseren Frühling geben möge.
Mit herzlichen Grüssen aus Ithaca, N.Y.,
Peter
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Prima lettera / Lettera 2: Le ultime parole della tua lettera mi hanno portato alla mente una canzone di un rocker texano a me molto caro …
weiter ...Cara Barbara!
Le ultime parole della tua lettera mi hanno portato alla mente una canzone di un rocker texano a me molto caro: vediamo le stesse stelle, il suo contesto era diverso ma il succo resta il medesimo, e vediamo le stesse montagne. E quindi, pur non conoscendoci, abbiamo già qualcosa che ci accomuna, oltre la scrittura naturalmente, che è il fondamento su cui si basa questo epistolario.
Di stelle so poco, ma amo le montagne, le amo di quell’amore/odio che spesso si finisce per provare per le cose che ci toccano maggiormente, amo guardarle ma odio il freddo, amo starci sopra ma odio il fatto di aver male alle ginocchia per poterci salire. Siamo fatti così noi esseri umani: caratteri e problematiche forgiati nell’arco di millenni e ormai non ci cambia più nessuno.
Mi piacciono le cime ma mi piace anche camminare in piano (probabilmente proprio per quel male alle ginocchia di cui ti dicevo), e mi piacciono i boschi, le radure, l’aria che si respira, il profumo di quell’aria, gli odori del sottobosco. Una volta camminavo davvero tanto sai? Però da qui a saperti dire quale sia la mia montagna preferita, beh, mi metti un po’ in crisi. Non tanto perché non ne abbia una, ma perché credo sia un po’ come il famoso libro da portare su un’isola deserta. Dipende da quando te lo chiedono, dal tuo stato interiore del momento credo, non tutti i giorni si finirebbe col dire lo stesso titolo, e poi diciamocelo, un libro solo per l’isola deserta è un po’ poco.
In questo momento sento che è un po’ la stessa cosa con le montagne. Ti potrei dire il Mauna Kea, un vulcano altissimo delle Hawaii, non ci sono mai stato sopra, l’ho visto da sotto, ma si trova su un’isola che mi piace molto e dove mi rifugio con la fantasia quando sento la nostalgia del viaggiare. John Steinbeck, il mio autore preferito, diceva che qualcuno viaggia per scrivere libri, qualcun altro scrive per viaggiare con la fantasia, io mi sono sempre sentito un po’ nel mezzo.
Ma tornando alle montagne, potrei dire anche quelle della Val Passiria, dove ho il ricordo permanente di un bellissimo trekking di cinque giorni, o il Becco di Filadonna, una piccola cima trentina con un panorama mozzafiato. Più prevedibilmente dirò invece le Dolomiti, le montagne di casa, quelle che vedo dalla mia città, il Catinaccio col suo profilo che domina la mia Bozen Town. È la montagna che vedo tutti i giorni recandomi al museo per lavorare, ed è quella che mostro ai visitatori del museo quando li accompagno in cima alla torre, raccontando loro qualche storia legata alle montagne che vediamo, perché questa è la cosa che mi viene meglio in fondo: raccontare. Tu di cosa scrivi di solito, Barbara?
Raccontare è l’essenza della mia vita, di qualunque tipo di racconto si tratti, l’ho ereditato da mia mamma e da mia nonna, è tutto nel DNA, allo stato puro. L’importante è trovare qualcuno disposto ad ascoltarti, altrimenti è dura a raccontarsela da soli. Penso a mia nonna e mi chiedo cosa avrebbe pensato di tutta questa storia della pandemia, lei che aveva visto due guerre mondiali e la famosa epidemia spagnola… Nonostante ora avrebbe molto più di cent’anni e considerata l’educazione che aveva ricevuto, credo che non l’avrebbe considerata un castigo divino. Era una donna illuminata.
Anche se la religione cristiana per troppi secoli ha raccontato alla gente di un dio punitore, severo e temibile. Per certi versi un po’ l’opposto di quegli dei dell’Olimpo di cui mi scrivi nella tua lettera: quelli a confronto erano divinità da operetta, se così possiamo dire, capaci di cattiverie indicibili, certo, ma pieni di difetti: invidiosi, peccatori incalliti e cialtroni proprio come quegli uomini che se li erano inventati così, a propria immagine e somiglianza. Tutto l’opposto del dio dei cristiani. E di quello degli altri monoteisti.
Mi sto addentrando in un territorio minato, e ne esco prontamente prima d’impantanarmi. Quello a cui volevo arrivare era il punto della tua lettera in cui fai riferimento alla desertificazione e ai cambiamenti climatici, un tema che ci tocca tutti da vicino, uno dei tanti nei cui confronti mi sento al tempo stesso impotente e colpevole: impotente perché non vedo a che serva la mia raccolta differenziata dei rifiuti (che continuo a fare comunque) nel momento in cui vediamo crearsi interi atolli di plastica negli oceani; colpevole in quanto sono pienamente consapevole che rinunciare a tante irrinunciabili comodità dei nostri tempi potrebbe essere d’aiuto all’ambiente.
Una cosa che mi ha colpito di questa emergenza virale è stato vedere come la clausura coatta abbia portato, almeno nella prima fase, ad un temporaneo spopolamento delle zone antropizzate, e mi riferisco proprio alle nostre zone alpine: con la gente chiusa in casa forzatamente, in un paio di paesi del Trentino ci sono stati casi di animali selvatici (orsi e stambecchi) che si sono avvicinati ai centri abitati/disabitati fino al punto di entrarvi arrampicandosi sui balconi. Non riesco a non pensare che sia un effetto della quarantena. Ti pare?
Più che un castigo, mi viene da pensare ad un ammonimento da parte di madre natura, a buon diritto arrabbiata per come la trattiamo.
Qualcuno pensa che ormai il peggio sia passato. Sai Barbara? Io non riesco ad averne la certezza. Le guerre viste dai miei nonni e dai miei genitori sono state sicuramente peggio, ma non me la sento di mettere la parola fine su quest’esperienza inattesa e ancora senza rimedio. Provo ad essere ottimista, ma l’orizzonte mi pare fosco e minaccioso. Mi metto nei panni di chi come te ha bimbi piccoli, immagino che sia un dovere morale sperare in un futuro sereno, per loro almeno. D’altra parte, come scrivevi, i semi sparsi oggi fanno crescere i fiori di domani e, guardandomi attorno in questa pazza primavera senza precedenti, vedo la natura andare avanti, alla faccia di questa nostra difettosa razza umana.
E su questa dichiarazione di positività (non al virus!), ti auguro una buona serata, a presto,
aloha, come si dice all’ombra del Mauna Kea
Paolo
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Barbara Ladurner & Paolo Crazy Carnevale
Brief 1: Es ist Abend und ich blicke ein letztes Mal aus dem Fenster …
weiter ...Lieber Paolo!
Es ist Abend und ich blicke ein letztes Mal aus dem Fenster, bevor ich die Jalousien schließe. Vor mir ragt die Zielspitze in den schwarzen Himmel, nebelverhangen, wie der Olymp, auf dessen Gipfel die Götter hausen, im Verborgenen. Die Zielspitze ist mein absoluter Lieblingsberg. Ich war aber noch nie oben. Hast du einen Lieblingsberg, Paolo?
Wo die Götter hin sind, frage ich mich. Ob sie auch husten und röcheln, oder ob sie im Schatten ihrer Unantastbarkeit ihrem ewigen Leben frönen, fernab von jeglichem menschlichen Leid und Sterben, im Glanze der Unendlichkeit. Langweilig eigentlich, nicht wahr, aber faszinierend erhaben in einem Sumpf kurzlebiger Geschöpfe und deren Erzeugnisse. Häuser auf Sand, manchmal nur Marmor, aber die Desertifikation schreitet gerade in Zeiten wie diesen unerhört voran, vielleicht auch der Klimawandel dran schuld. Ob der geistige Schrott der dunklen Materie gleicht, die die Sterne am Himmel erst zusammenleimt? Der Schein heller Ideen wirkt lang, aber wir wissen heute, dass ihr Licht oft erst die Weltbühne erreicht, wenn der Himmelskörper dahinter schon lang erloschen. Und dann ist es manchmal zu spät. Nur noch bunter Sternenstaub, der sich tröstlich auf das matte Grab legt. Nebel eben, wie er die Zielspitze heute großzügig umbauscht. Nicht ein Lichtstrahl ringt sich durch zu uns. Dabei hatte mich die letzten Wochen hinweg immer wieder ein helles Leuchten rechts des Gipfels fasziniert, nicht der Sirius, vielleicht die Venus oder der Merkur. Sie sollen sich ja momentan auf derselben Höhe befinden, von hier unten aus gesehen. Dabei ziehen die beiden Planeten ihre Kreise auf völlig verschiedenen Umlaufbahnen. Aber hier für das ungeschulte Auge zum Verwechseln ähnlich. Tückisch. Doch ich kenne mich mit Astronomie nicht aus. Manchmal betrachte ich die Flut der Informationen und Gegeninformationen und weiß nicht, auf welcher Seite ich der Sonne näher bin. Kennst du dieses Gefühl, Paolo?
Ich spüre dann nur dieses wachsende Unbehagen und dieses vereinnahmende Bedürfnis, es in Worte zu fassen, zu artikulieren, ja hinauszuschreien in eine abgestumpfte Welt, die sich schon längst an alles und viel mehr gewöhnt hat und mühselig ihren Ballast Umdrehung für Umdrehung mit sich wälzt. Doch dann ertappe ich das Rotieren meiner Gedanken, die sich ebenso beschwerlich im Kreise drehen und vergeblich plagen, im Hamsterrad der genormten Scheinwirklichkeit mehr als nur die Denkmühle selbst zu bewegen. Und schließlich erkenne ich, dass mir schlecht wird von diesem ständigen Purzelbaumschlagen und ich mache einfach nicht mehr mit, aber der Schädel schwirrt noch immer, und die Welt scheint abwechselnd kopfzustehen. So falle und erhebe ich mich, taumle und stehe, irre und erringe ich, den Blick fest auf den geliebten Gipfel gerichtet, besser noch auf das Himmelslicht daneben, so fern und
doch so nah, auf der Suche nach einer Wahrheit, die es gibt, nicht in tausend Scherben, zersprungen im Fall, sondern rein und rund wie die gläsernen Murmeln der Götter, die sich damit im Schatten der Wattewolken die Zeit vertreiben. Ob sie herabblicken und lachen, frage ich mich, angesichts des rührseligen Auslotens unserer viel zu straff gezogenen Grenzen. Mauern und Zäune, jetzt wieder maschinengewehrbewacht. Aber was nützen mir das Spielen des Zeus, der Hera und deren Kinder, während unsere auf Leistung getriggert in einer nicht nur seit Corona viel zu beengten Welt hergetrieben werden vor dem kategorischen Imperativ eines perversen Wirtschaftssystems, dessen Höher-Schneller-Weiter in keinem Maße mit einem ethischen, geistigen, sozialen oder emotionalen Fortschritt zu korrelieren vermag. Ich jedenfalls wünsche mir keine Vergeltung jenseits des Olymps, sondern ein bisschen mehr Himmelreich auf Erden. Es ist zum Greifen nah. Außerhalb des eigenen Kosmos Ich, einen Schritt vom Du und eine Armlänge vom Wir entfernt. Hier fängt die Freiheit an, ein wirklich dauerhaftes Licht an dem Himmel zu entzünden, auf den wir alle und auch zukünftige Generationen aufblicken werden, klagend, weinend, verzweifelt und lachend, dankend, hoffnungsfroh.
Die Nacht ist sehr dunkel und kalt, ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit. Der Mensch braucht wieder Wärme und Nähe in dieser pseudokontaktreichen Gesellschaft, deren Losigkeiten sich schon längst in die Herzen der Menschen gefressen haben. Freudlos, kontaktlos, hoffnungslos, energielos, ziellos, mutlos, ruhelos, interessenlos, tabulos, schamlos, wertelos. Virale Verbreitung. Unbemerkt und tödlich. Corona als Symptom einer krankenden Gemeinschaft. Leiber gehen zugrunde, Seelen auch – das war des Dramas erster Akt. Regisseure besprechen sich, passende Akteure werden gecastet, das Publikum ist erstarrt vor Schreck. Aber einzelne Stimmen erheben sich, der Chor wird immer lauter, ich mittendrin.
Es ist schon spät, wahrscheinlich ist der Mond schon aufgegangen, nur sehen kann ich ihn nicht. Jede Krise birgt auch Chancen, herrschende Missstände können behoben und ein Neuanfang gewagt werden. Die Herausstellung der Würde, ein dem Menschen wirklich gemäßes Leben, eine humanere Welt – das sind keine Träumereien zu schläfriger Nachtzeit, das ist vielmehr das Gebot der Stunde für uns alle. Gedanken, Ideen, Visionen führen zu Handlungen und konkreten Ergebnissen im Hier und Jetzt, auf dessen Boden der versprengte Samen von heute zur Blume von morgen gedeihen wird.
Nun grüße ich dich herzlich, lieber Paolo, und freue mich darauf, von deiner Gedanken- und Lebenswelt zu erfahren. Ich kenne dich nicht – aber wir blicken auf dieselben Sterne und dieselben Berge, das fühlt sich vertraut an.
Liebe Grüße,
Barbara
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 4: „Zu hören wie das Leuchten von blühenden Eichkätzchen am Wegrand“, schrieben Sie, hellhörig zu hören am Wegrand wie …
weiter ...Weiler im Allgäu, den 17. Mai 2020
Lieber Hansjörg,
„Zu hören wie das Leuchten von blühenden Eichkätzchen am Wegrand“,
schrieben Sie, hellhörig zu hören am Wegrand wie … von blühenden Eichkätzchen das Leuchten zu hören …Ich spiele damit, wie ein Kind seinen Vers aufsagt, langsam, schneller, Wörter entlässt, springt.
Ich höre es, das Leuchten aus den „wenigen Geräuschen“.
Und dann bezaubert mich dieses Wort „primavera“, Frühling mit der ersten Wahrheit, dem ersten wahr sein, gewahr sein in den Tagen der Pandemie, ein Rätselwort im Widerhall, ein Sehnsuchtswort.
Gestern mailte mir ein alter Freund auf meine Bitte hin, Dietmar Kampers Zitat, das ich Ihnen nicht vorenthalten will in seiner Präzision, jene Erfahrung des Raums, die Sie kennen.
„So wie der Raum Götter, Menschen und Dinge trennt, so verbindet sie die Zeit. Sein Wesen ist die Grenze, ihre Wahrheit ist der Augenblick“. Dietmar Kamper, Zur Soziologie der Einbildungskraft, Carl Hanser Verlag, München/Wien 1986, p.124.
Diesen Augenblick, das gegenseitige sich Erkennen von Künstler und Werk ahne ich als Geschehen in Ihrem Arbeitsraum, aber auch als Köstlichkeit der unvermuteten, unerwarteten Begegnung in Ihrem letzten Brief.
Beethoven, sagte der Freund im gestrigen Gespräch, begleite ihn nun neben Mozart täglich und Hyperion seit seiner Jugend und er fügte noch hinzu, dass der Mensch sterben müsse, weil er den Anfang und das Ende nicht zusammenbringen könne. Wenn wir nur schrieben, lebten aus dem Phänomen, um uns selbst zu sein, käme etwas zur Geburt, dass einen die Dinge anschauen…
Woran Sie wohl gerade arbeiten…
Ihr Nennen von Evgeni Koroliovs Bachinterpretation machte mich neugierig, ist es nicht diese schlichte Frömmigkeit, das Umsonst des Tuns, ausgerichtet auf etwas Größeres, dieses „soli deo gloria“, was uns bei Bach in Erstaunen versetzt und eine wunderbare Beglückung auszulösen vermag, dem Ankommen bei sich selbst in der Leichtigkeit und Tiefe des Seins.
Seit einem Jahr besitze ich ein Clavichord und Koroliov bestätigt mich in meinem Gefühl, dahin gehört Bach auch, in den kleinen privaten Raum.
Vielleicht gelingt es mir einmal, Bach und eigene kleine Kompositionen zu spielen, nur für mich.
Inger Christensens alfabet berührt mich zutiefst, als ob Sie gewusst hätten, dass Inger Christensen zu meinen Lieblingsdichterinnen gehört, sie weiß,
dass das Gedichteschreiben immer auch wie das Stehen auf nacktem Boden ist…
Da Sie ganz spontan die Musik ins Spiel bringen, möchte ich Ihnen von einer jungen chinesischen Komponistin erzählen, die gerade in Hongkong festsitzt und sobald wie möglich wieder nach Deutschland ausreisen will. Vielleicht interessiert es Sie?
Ihr Brief kam dem Ihrigen zuvor. Ich glaube, dass es Gemeinsamkeiten gibt, trotz der räumlichen wie kulturellen Entfernung zwischen Ihnen und ihr und mir.
Wir hatten uns kennengelernt durch Prof. Robert H.P.Platz, der für die Abschlussarbeit seiner Studenten einen Text von mir auswählte: „Fastentage“, und der am 17.3.19 zur Uraufführung im Neumünster in Würzburg kam.
Seither schreiben wir uns. Natürlich auch über die gegenwärtig bedrängende Situation.
Cong Wei sandte mir ihre Soundcloud, damit ich einen besseren Einblick in ihr Werk bekäme.
BATHE MY SOUL IN THE FIRE
erschütterte mich zutiefst, den gewaltigen Klangraum, den diese zarte Person schuf an weltumfassendem Klagegesang.
Ich musst an A. Delps Worte denken: „Keiner durchschreitet die Glut ohne Verwandlung.“
BEAMS OF LIGHT IN THE DARKNESS
lösten Assoziationen aus in dem ergreifenden Gesang, Aufschrei der geschundenen Kreatur und Materie, wie der vom Brand gezeichneten Kathedrale Notre Dame, der nach Atem Ringenden…im hellen Klang der Glocken,
ein stellvertretendes Wachen in den Flüchtlingslagern, Krankenhäusern, bei den Verzweifelten, Vereinsamten.
„Hören des Leuchtens“
In dem kleinen Band:
„Migranten“, das ein Gespräch zwischen Edmond Jabès, Massimo Cacciari und Luigi Nono wiedergibt, fand ich eine Stelle, die auszudrücken versucht, was nicht auszudrücken ist, was Musik und Sprache verbindet, jene Stille, jenes Leuchten, in die das Wort, die Musik letztlich heimkehren, rufend, singend, jedoch erwartet.
Es war, vielleicht nun schon vor einem Jahr. Bei mir die erste Begegnung mit einem Mann, der in sich die Stille von tausend nahen oder fernen Stimmen trug, die jedoch alle erwartet wurden.
Ist sie nicht weiß, die Farbe der Stille, die alle Farben miteinzuschließen vermag, wie Morsezeichen es vermögen bei Nacht, unsere Hoffnung leuchten zu lassen.
Nun ist es Nacht geworden, das Heu duftet, nach einem strahlenden Sommertag im Mai,
grüß ich hinüber nach Schaan, vielleicht steht der Orion am Himmel…wer weiß,
herzlich
Antonie
Blinder Orion
Schiffbrüchige sind wir
in der Ordnung des Lichts
Morsezeichen
Gesandte
in Eile
Von Insel zu Insel
Im entfesselten Frühlingswind.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 5: Ich habe bereits vor einer Woche begonnen, dir meinen dritten Brief zu schreiben, in dem ich bereits auf deinen zweiten Brief eingehe …
weiter ...15. Mai
Liebe Marjana,
ich habe bereits vor einer Woche begonnen, dir meinen dritten Brief zu schreiben, in dem ich bereits auf deinen zweiten Brief eingehe, ohne ihn zu kennen. Es ist erstaunlich, was für Parallelen es zwischen den Briefen gibt, ums um die Ecke zu sagen, ich nenne nur ein paar Stichwörter, auf die ich später noch ausführlicher eingehen werde: Menschen, Düfte, Bibliothek, Pater, Klosterneuburg, Schreibplatz, Social distancing … Ich bin so frei und zeige dir erstmal, was ich dir bereits letzte Woche geschrieben habe, beflügelt vom Duft der Leichen zweier toter Fliegen in einem Tintenfass in der schon einmal erwähnten Erzählung Tubutsch von Albert Ehrenstein: „Denn was kann besser zu meiner Stimmung passen als der für andere, robuster geartete vielleicht gar nicht wahrnehmbare Geruch ihrer Verwesung?“ …
Hier jetzt der Brief von letzter Woche:
Liebe Marjana,
zuerst will ich dir von dem Traum erzählen, den ich dir im vorigen Brief angekündigt habe.
Ich stand in Dornbirn am Bahnsteig, ich hatte viel Gepäck dabei, auch meine Gitarre, ich war völlig übermüdet, verkatert und ungeduscht, es war ein heißer Sommertag, unglaublich viele Menschen standen auf dem Bahnsteig, da kam plötzlich ein Mann auf mich zu, in dessen Begleitung du dich befandest. Ich wusste, wer du warst, obwohl wir uns noch nie zuvor getroffen hatten. Der Mann sagte zu mir, ich solle dich sicher nach Innsbruck bringen, von wo du einen Flug hättest. Mir kam der Auftrag seltsam vor, du standest schweigend neben dem Mann und sahst mich nur teilnahmslos, aber freundlich an. Kurz darauf stiegen wir in den Zug, der komplett überfüllt war, an einen Sitzplatz war nicht zu denken, wir standen vor einer Toilette, es war eng, ich schwitzte, roch mich selber, du warst jung und strahlend, ich alt und glanzlos, ich schämte mich wegen meines Schweißes und meiner üblen Ausdünstungen, du standest nur schweigend und gelassen vor der Toilettentür, als sei das die größte Selbstverständlichkeit, kein Anzeichen von Unmut oder gar Widerwillen, ich hingegen wollte aus der Haut fahren, die Vorstellung, mit dir so bis Innsbruck zu fahren, war unerträglich, da hatte ich einen rettenden Einfall und sagte, dass ich in Feldkirch aussteigen würde, um meine Mutter zu besuchen, du sagtest, das sei okay, du standest lächelnd da, als sei nichts dabei, in einem überfüllten Zug vor einer Toilettentür zu stehen mit der Aussicht auf zwei Stunden Fahrt, es waren auch Grundwehrdiener in der Nähe, die Bier tranken und wahrscheinlich bald unangenehm sein würden, das war mir klar, aber ich konnte nicht anders, so gern ich in deiner Gegenwart geblieben wäre, ich musste raus. Du meintest lächelnd, das sei völlig okay, ich stürzte aus dem Zug, eilte befreit und tiefe Luft holend den Bahnsteig entlang zur Unterführung, sah nach links, sah in den Speisewagen des Zuges, und da – ich traute meinen Augen nicht – war ein Zweiertisch frei! Ich stieg spontan wieder in den Zug, stürzte in den Speisewagen, legte mein Gepäck und die Gitarre zu dem freien Tisch, sagte zur Kellnerin, sie solle den Tisch bitte reservieren, ich sei gleich wieder da. Und dann kämpfte ich mich durch all die stehenden, schwitzenden, stöhnenden Menschen in den überfüllten Waggons zurück zu dir, und nie werde ich den Anblick vergessen: Du standest lächelnd genau dort, wo ich dich verlassen hatte, ich sagte, komm mit, ich habe einen Platz für uns, und dann sagtest du, und auch das werde ich nie vergessen, dachte ich im Traum: „Das werde ich dir nie vergessen.“ Kurz darauf saßen wir an unserem Tisch, es war ein großer Speisewagen, wie es sie früher gegeben hatte, du warst der Mittelpunkt, alle Blicke waren auf dich gerichtet, wir redeten, du bestelltest wie ich ein Bier, du sagtest, das sei das erste Bier deines Lebens, du zeigtest mir ein Buch, das du von mir gekauft hattest, mein Erstling was mir die adler erzählt, ich war völlig überwältigt, dass du dieses Buch von mir hattest, das durfte doch nicht wahr sein, ich sollte dir was reinkritzeln, wir sahen schweigend aus dem Fenster, wir fuhren durch eine Berglandschaft, die Zeit verging wie im Flug, schon waren wir in Innsbruck, wo du aussteigen musstest, und kaum warst du weg, bemitleideten mich alle im Speisewagen, wie mir schien, und die Kellnerin kam zu mir und sagte: „Jetzt ist sie weg“, und sah mir tief in die Augen, machte ein bedauerndes Gesicht und seufzte …
Corona hatte jedenfalls keinen Einfluss auf diesen Traum! Im Zug wurde kein Abstand gewahrt, was mir gar nicht auffiel, auch Gesichtsmasken gab es keine – ich denke, er spielte eindeutig in der Vergangenheit.
Jaja, ich schreibe nicht nur viel, ich träume auch viel. Einmal habe ich mich im Traum sogar schon verletzt. Meine kleine Schwester wurde vor dem Haus meiner Großeltern von einem Mann abgefangen, sie stieg zu ihm ins Auto, ich wusste, er wollte sie entführen, um ihre etwas Böses anzutun, ich begann zu laufen, das Auto fuhr rückwärts aus der Parklücke, ich sprang vorne auf die Kühlerhaube, ich sah das Gesicht des Mannes durch die Windschutzscheibe, ich wusste, er würde mich abschütteln wollen, da holte ich mit dem Fuß aus und trat zu – ich wollte ihm durch die Windschutzscheibe den Schädel zertrümmern, so groß war plötzlich mein Hass auf ihn, diesen Mann, der meiner kleinen Schwester was antun wollte, und kurz bevor mein Fuß sein Gesicht traf, sah ich, dass es ein Pfarrer war, der da am Steuer saß, deutlich zu erkennen an seinem Kragen … Ich wachte auf, denn ich hatte mit voller Wucht in die Wand neben dem Bett getreten. Am Morgen war der große Zeh blau und geschwollen, der Nagel eingerissen – ungefähr ein Jahr lang spürte ich die Folgen des Trittes, humpelte ich …
Deinen zweiten Brief habe ich noch gar nicht bekommen, ich warte ungeduldig darauf, will auf deinen Brief reagieren, aber das geht nicht, wenn er noch nicht da ist, also erzähle ich dir von meinem Spaziergang gestern …
Hier auf meinem Schreibtisch steht übrigens ein großes Buch, an die Wand gelehnt mit dem Titelbild zu mir. Das Bild zeigt ein Mädchen, das mit Federkiel und Tusche einen Brief schreibt, bzw. über einem Brief sinniert, und dabei einen Schatten wirft. Auf dem Briefpapier, das vor dem Mädchen auf dem Tisch liegt, ist nur zu lesen:
laß wir o
tapfer s
Das schöne große Buch befindet sich schon seit längerem an diesem Platz, es heißt: Ich sitze hier im Abendlicht … Briefe gesammelt und illustriert von Jutta Bauer. Vor dem Buch steht eine ca. 10 cm hohe blaue Leselampe, die man einschalten kann, daneben ein Sandhügel aus Plastik, in dem ein kleiner Sonnenschirm steckt, dessen Schirmstange, wenn man sie aus dem Sand zieht, sich als Bleistift entpuppt (Geschenke). Dazwischen liegen u.a. eine uralte hart und braun gewordene Zitrone und ein verschrumpeltes Radieschen (keine Geschenke). Darüber hängen zwei Fotos von rauchenden Menschen: Lou Reed, die Zigarette im Mund zeigt nach links, und Johanna Dohnal, die Zigarette im Mund zeigt nach rechts. – Das sind nur ein paar kleine Details von meinem Schreibplatz. Wie schaut dein Schreibplatz aus? – Es gäbe ein schöneres Wort dafür, ich weiß …
Es wird wieder normal. Ich arbeite an meinem Schreibtisch, ohne dass im Nebenzimmer wer arbeitet. Meine Frau macht kaum mehr Home Office, gestern musste sie länger als geplant im Büro bleiben, also ging ich am Abend zum ersten Mal seit langem allein spazieren. Schon beim Balkon-Konzert von Ernst Molden am Mittwoch war eine Veränderung zu bemerken gewesen. Es gab wieder fast so viel Straßenverkehr wie früher, d.h. Molden war nicht mehr so gut zu hören, die Atmosphäre war nicht mehr so angenehm unwirklich, ruhig und feierlich, außerdem spielte er zum ersten Mal seit Wochen allein – sein Sohn Karl hatte wohl nach den Lockerungen wieder Besseres zu tun. Und Molden sang auch nicht das Lied „Awarakadawara“, bei dem ich so gern mitsinge: „Hokuspokus fidibus i foa mitn schwoazn Autobus …“ Ich ging allein spazieren, steuerte den Märchenwald an (umgestürzte Bäume, Unterholz …), vielleicht würde ich meinen Sohn treffen, der auch manchmal dort spazieren geht. Nein, das war unwahrscheinlich, er musste ja arbeiten (er hat sich als „außerordentlicher Zivildiener“ gemeldet, betreut eine Wohngemeinschaft von Kindern und Jugendlichen).
Du schreibst an einem „Düfte-Buch“, ich an einem „Vater-Buch“ …
Manchmal, wenn ich übermütig bin, denke ich, dass mir mit diesem „Vater-Buch“ vielleicht etwas gelingt, das bleiben wird wie der Kleine Prinz und der Große Gatsby, hoho. Wirklich wahr, ich habe ein urgutes Gefühl, bis ins Herzblut hinein! Titel: Mein Vater, der Vogel. Die Idee dazu hatte ich schon vor Jahren, seither sammle ich Material. Es handelt sich um eine Fülle von hauptsächlich lustigen Szenen, Episoden, Geschichten, im Hintergrund lauert Hintergründiges, zwischen den Zeilen tut sich eine zweite Ebene auf, die Sache ist tragikomisch, endet fatal … Den letzten Anstoß gegeben hat mir das Buch Er hat nie jemanden umgebracht: mein Papa von Jean-Louis Fournier. Darin schreibt Fournier über seinen Vater, der Alkoholiker war und mit 43 gestorben ist, da war er 15. Ein zweites autobiografisches Buch von Fournier heißt Wo fahren wir hin, Papa? Darin schreibt er über seine zwei geistig und körperlich schwer behinderten Söhne, die er beide überlebt hat, einer der beiden starb mit 15. – Was für ein Leben als Sohn und als Vater von Söhnen! Jean-Louis Fournier ist laut Klappentext «Schriftsteller und Humorist“ …
In letzter Zeit habe ich nicht mehr so fleißig an meinem Buch gearbeitet, nicht nur deshalb, weil meine Frau immer seltener Home Office macht. Ich hatte eine Erkenntnis: Der Grund, warum ich in letzter Zeit nicht viel an dem Buch gearbeitet habe, ist der, dass ich nicht will, dass diese Arbeit aufhört. Ich arbeite deshalb nicht, weil ich mir die schöne Arbeit länger erhalten will. Ich wollte jetzt eigentlich schon fertig sein damit, aber das wäre nicht schön. Ich will eigentlich gar nicht, dass die Arbeit aufhört. Das sehr gute Gefühl, an etwas sehr Gutem zu arbeiten, soll weiterhin erhalten bleiben. Deshalb arbeite ich nicht daran. So lange ich an etwas arbeite, kann ich außerdem nicht sterben – ich glaube, das hat Urs Widmer irgendwo so ähnlich geschrieben. Inzwischen ist er auch schon tot. Er hätte sein letztes Buch nicht beenden sollen.
Zum Geburtstag bekam ich ja viele Gutscheine für Bücher, sechs Stück habe ich damit schon besorgt, darunter das Buch Hektopolis von Wojciech Czaja, weil mich das Vorwort begeistert hat, das so beginnt: „Einmal im Monat, an einem Samstag oder Sonntag, haben wir uns ins Auto gesetzt, ich war damals sieben oder acht, und sind einfach drauflosgefahren. Mein Vater am Lenkrad, meine Mutter am Beifahrersitz, ich ständig auf der Rückbank hin- und hergleitend, Ausschau haltend nach der nächstbesten Chance am Horizont. […] Die Spielregeln waren denkbar einfach. Den ganzen Tag lang durfte ich uns dirigieren: links, rechts, geradeaus, zurück und stopp. Den ganzen Tag lang hat der Fahrer den Befehlen ohne Widerrede Folge geleistet.“ – Was für ein Vater!
„Auf geht’s! einem ungewissen Schicksal entgegen“, denke ich oft, das ist ein Zitat von F.K. Waechter, dessen Sohn Philip auch Zeichner und Autor geworden ist und ein Buch mit dem Titel Sohntage veröffentlicht hat, das ich gerade bestellt habe. Mein Desktop-Hintergrundbild ist übrigens seit langem ein Foto vom Wallersee, auf dem ein Schneidebrett schwimmt, auf dem ein Salzfass steht. Ich war einmal ein sog. „Seeschreiber“ in Seekirchen am Wallersee, lernte dort die Berliner Autorin Johanna Straub kennen (wir wohnten Tür an Tür direkt am See), die übrigens ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Das Zebra hat schwarze Streifen, damit man die weißen besser sieht. Johanna war die „Seeschreiberin“ (es wurden immer zwei gleichzeitig zur Seeschreiberei eingeladen) und sie hatte 1000 Zitate von F.K. Waechter im Kopf, ich war begeistert, denn ich hatte 500 von ihm im Kopf, wir konnten uns stundenlang nur in Waechter-Zitaten miteinander unterhalten, und das taten wir auch, es war die helle Freude, ein unerschöpfliches Vergnügen, „Heidewitzka, Herr Kapitän!“ Und eines Tages beschlossen wir, einen Cartoon von Waechter in die Tat umzusetzen, wenn man das so sagen kann. Auf dem Cartoon sieht man ein Schneidebrett, auf dem ein Salzfässchen steht. Das Brett schwimmt am Rand eines Meeres – ein Mann hat ihm gerade einen Schubs gegeben und sagt: „Auf geht’s! einem ungewissen Schicksal entgegen, gutes altes Salzfass.“ – Wir besorgten ein Schneidebrett und ein Salzfass und machten damit Fotos im Wallersee. Eines davon ist seit damals mein Desktop-Hintergrundbild.
Liebe Marjana, schreibst du eigentlich noch Gedichte? Ich glaube, dein letzter Lyrikband ist schon länger her. „Das Schiff bin ich …“
Meine Gedichte schreibe ich hauptsächlich im Bett – in der Nacht, am Morgen, im Halbschlaf, manchmal sogar im Schlaf … Also im Bett nehmen sie zu 90% ihren Anfang. Kürzlich kritzelte ich am Morgen ein Gedicht, an das ich gestern bei meinem Spaziergang denken musste. Es ist noch unfertig, aber wird schon, wird schon: „In einem schwarzen Haus / sitze ich in einem schwarzen Zimmer / auf einem schwarzen Stuhl / an einem schwarzen Tisch / mit einem schwarzen Bier darauf, / da geht die schwarze Türe auf / und herein kommt meine Frau, / die orange leuchtet.“ – Heissa! Das mit dem „schwarzen Bier“ lasse ich vielleicht besser weg, da denkt womöglich wer an die berühmte „schwarze Milch“, an die ich nicht dachte beim Kritzeln. Jedenfalls musste ich gestern, als ich bei meinem Spaziergang das Lied „Awarakadawara“ von Molden vor mich hin sang, plötzlich denken, dass mir vielleicht der „schwarze Omnibus“ aus diesem Lied eingefahren ist, und auf Umwegen führte die unterirdische, nächtliche Reise dann zu meinem schwarzen Haus … Ernst Molden nenne ich übrigens seit kurzem nur noch The Golden Molden, weil er ein goldenes Herz hat, eine goldene Stimme, und sein Gitarrenspiel ist auch golden. Er hat auf jeden Fall eine Goldmedaille verdient, die Balkon-Konzerte werden mir abgehen.
An der Donau entlang spazierte ich und dachte an meinen Goldschatz, der hier so gern spaziert. Es war ein bisschen traurig, dass ich allein war, aber ich sang, und auf die Gefahr hin, dass ich dir auf die Nerven gehe, hier schon wieder ein Zitat, das mir in dem Zusammenhang sofort in den Kopf schießt, eins von dem Südtiroler Dichter Gerhard Kofler, der viel zu früh gestorben ist: „und du fange nicht an / zu weinen / fange zu singen an“, und ich singe von Molden „Awarakadawara“, aber auch „Gemma ins Wossa“ – es gibt eine CD von ihm, die heißt Schdrom, sie ist voller Donau-Lieder, die ich einen Sommer lang sehr oft gehört habe – im Sommer 2017, in dem ich ein Stelzenhäuschen in Kritzendorf hinter Klosterneuburg bewohnt habe. In meinem Lyrikbändchen Grüße an alle, in dem viele Donau-Gedichte drin sind, die zum Großteil in jenem Sommer entstanden sind, habe ich Ernst Molden zitiert mit dem Satz: „Alle wollen immer nach Westen. Die Donau will nach Osten. Das mag ich so an ihr.“ – Wäre ich mit meiner Frau spaziert, wären mir andere Dinge durch den Kopf gegangen …
Stell dir vor, einer hat mich umarmt! Ich war auf einer Geburtstagsfeier im Freien, auf einer Gstettn beim Nordbahnhof, wild wucherndes Gras, Gestrüpp und Unterholz, überwachsene Geleise, „Priklopil-City“, wie Helmut, das Geburtstagskind, den Ort nennt (ganz in der Nähe hat sich Priklopil, der Entführer von Natascha Kampusch, umgebracht), wir sitzen auf großen Steinblöcken im Kreis, in einen Stein in der Nähe hat wer ein Gesicht gemeißelt, immer wieder sehen wir einen großen Hasen, in einem kleinen Teich, der eher eine Pfütze ist, schwimmen zwei Enten, wir, die Geburtstagsgesellschaft, sind vier Schriftsteller, ein Wienerlied-Sänger, der auch Autor und neuerdings Übersetzer ist, sein Sohn, der wahrscheinlich Musiker wird, bzw. schon ist, ein Maler und zwei Burgschauspieler – ein repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung quasi.
Herrliches, wildes Gelände – der Weg dorthin führt an einer Kneipe vorbei, die heißt ZUR ALM, davor in drei Metern Höhe ein eineinhalb Meter hoher Bierkrug mit schäumendem Bier aus Kunststoff (eine abstoßende Augenweide, absurd und grotesk).
Besonders faszinierend war für mich der Hase, der immer wieder auftauchte, in einem Respektabstand, ein großer, stiller, ernsthafter Bursche – traumhaft, märchenhaft.
Als einer der Burgschauspieler, der mich vorher nicht kannte, erfährt, wie alt ich bin, nennt er mich „Babyface“ … Daraufhin stürze ich mich sofort auf ihn und würge ihn, was ich u.a. dem Einfluss des Bieres zuschreiben muss. Jedenfalls gebe ich keine Ruhe, bis er mich „Adultface“ nennt. Erst dann lasse ich ab von ihm. Der Mime ist seit einiger Zeit täglich in Ö1 zu hören mit einem Corona-Gedicht. Von mir kriegt er bestimmt keines zum Vorlesen! Später nennt er mich auch noch „Bilgeri-Schüler“, nachdem er erfahren hat, dass ich den „Professor Rock ’n’ Roll“ Reinhold Bilgeri in der Schule als Philosophie-Lehrer gehabt hatte … Das musste der Herr Jedermann allerdings mit einem Zahnverlust büßen. Schweigen wir über die weiteren Vorkommnisse. Mein Freund Uwe hätte gesagt: „Es kam zu Situationen!“ Manchmal geht es eben durch mit mir … Jedenfalls zum Schluss UMARMTE MICH das Geburtstagskind (es hat übrigens gerade Donald Duck ins Wienerische übersetzt, und vor ein paar Tagen war Molden im Radio, weil er gerade Asterix ins Wienerische übersetzt hat – diese Koinzidenzen immer!) – es war das erste Mal seit 6. März, dass mir wer so nahe kam! Ich habe in der Nacht gleich Folgendes darüber geschrieben: „Jemand hat mich umarmt. Es war nicht meine Frau. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Er hat mich einfach umarmt. Ich habe nicht aufgepasst. Muss ich jetzt sterben?“ Kein Wunder, dass in manchen Ländern wegen Corona ein Alkoholverbot herrscht …
Immer wieder muss ich seither an den großen Hasen denken.
* * *
Liebe Marjana, ich habe den Brief oben stark gekürzt (hoho), inzwischen ist dein Brief eingetrudelt, über den ich mich sehr gefreut habe. Du machst es spannend! Ich danke dir. Weil ich „getrudelt“ geschrieben habe, hier ein Zitat von Kurt Tucholsky, das mich seit Jahrzehnten begleitet: „Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön: gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben.“
Für viele ist die Welt derzeit nicht schön, es sind immer mehr Hilferufe zu hören … Ich bin schwer dafür, dass niemand Existenzängste hat, allen soll geholfen werden, Brot und Spiele, Arbeit und Düfte … Freier Zugang zu allen Theatern, Konzerten, Meeren, Freuden, Aufgaben, Erfüllungen, Freundschaften, Liebschaften, Abenteuern, Liebkosungen, Reisen, Lesungen, Klöstern, Fußballstadien, Minigolfplätzen, Zügen, Schiffen, Bibliotheken, Gasthäusern, Bars, Aussichten, Einsichten … Aus!
Jetzt aber zu deinem Brief:
Ich mag „euch“, doch, meistens zumindest, nicht alle, aber doch einige, sogar viele, also eher viele als wenige. Wobei ich manchmal, besonders in der warmen Jahreszeit, jemandem, der in der überfüllten Straßenbahn neben mir steht und sich an einer Halteschleife festhält, am liebsten ein Messer in die Achselhöhle rammen würde …
Deine einäugige Lilly lässt mich an Billie denken (Billie heißt die Katze in meinem „Vater-Buch“) – in Prag war ich früher gern in einem wüsten Lokal, das nannte sich „Zum ausgeschossenen Auge“ (an den originalen tschechischen Namen kann ich mich leider nicht mehr erinnern). Was ist mit Lillys zweitem Auge passiert?
Du: „Parfüm-Roman“, ich: „Vater-Kurzroman“ – über meine Nase habe ich schon viel nachgedacht, darüber vielleicht ein andermal. Stell dir vor, ich hatte sogar einmal eine Lesung vor einer riesigen Nase am Ufer der Donau, einem Kunstwerk der Künstlergruppe Gelitin, „Die Wachauer Nase“, 4 Meter hoch, eine „begehbare Skulptur“ – ich las eigene „Nasen-Texte“ in einem der Nasenlöcher stehend, quasi aus einem Nasenloch heraus …
Sommer 2017! Du in Klosterneuburg, ich in Kritzendorf. Da wohnten wir nicht weit voneinander, da hätten wir uns treffen können. Aber du hieltest dich auf an so Orten wie Stiftsbibliothek und Klosterzelle, wohingegen ich mich herumtrieb an Orten wie Gasthaus am Silbersee und Sportsbar Happyland. Letztere ist in Klosterneuburg, da fuhr ich mit dem Fahrrad hin von Kritzendorf, der Donau entlang, dort sah ich zwei Fußballspiele des österreichischen Frauenteams, das damals groß aufgeigte bei der Europameisterschaft. Beim zweiten Spiel saß ein schwer betrunkener Mann an der Bar, der irgendwann während des Spieles – er hatte vergessen, was gespielt wurde – immer wieder laut ausrief: „Gemma, Burschen!“
Wenn ich an Parfüms in meiner Kindheit denke, fällt mir als erstes meine Oma mütterlicherseits ein. Sie war eine der wenigen Frauen in meinem Umfeld, die von einem speziellen, in ihrem Fall süßlichen, um nicht zu sagen picksüßlichen Duft umwabert war – das passte zu ihrer Kochkunst, denn sie gab auch in die Salatsauce reichlich Zucker … Du schreibst von Süskinds Grenouille, ich denke oft an Süskinds Kontrabass, weil bei uns im Haus ein Kontrabassist wohnt, und ein Ehepaar Schwarz wohnt auch hier. Frau Schwarz gab mir einmal tatsächlich schwarze Luftballons, die sollte ich aufgeblasen im Hof befestigen, die würden die Tauben vertreiben. Und hat nicht Süskind auch ein Buch geschrieben, das Die Taube heißt?
Dass dir ein Bad in der Menge abgeht, hat mich überrascht.
Den nächsten Brief beginne ich definitiv erst dann, wenn ich deinen dritten erhalten habe.
„Trudeln, nicht hudeln!“, rufe ich dir zu.
Ich freue mich schon auf unsere Zugfahrt ins schöne Tessin …
Grüße auch an Lilly!
Christian
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Yannic Han Biao Federer & Verena Rossbacher
Brief 4: Ich versuche, aus den wenigen Zeilen, die wir bisher gewechselt habe, eine Art Fazit zu ziehen …
weiter ...Lieber Yannic,
ich versuche, aus den wenigen Zeilen, die wir bisher gewechselt habe, eine Art Fazit zu ziehen, um eine Verortung zu ermöglichen. Also, fassen wir zusammen:
Streit: nein; Bagger: nein; Diskussion: nein; Spielplatz: nein, usw., es schaut, kurzum, schlecht aus, was die gemeinsame Themenfindung angeht. Es wundert mich ja selber, aber es läuft über kurz oder lang auf ein Beziehungsgespräch hinaus (ja, nervig).
In deinem Brief beschäftigst du dich unter anderem mit dem Nicht-streiten-müssen – eh klar, streiten müssen tut man nicht, und auch du und ich, wir müssen mitnichten miteinander streiten. Mir wird es zu ungenau und abstrakt, wenn du von totalitären Regimen sprichst und von Sprechweisen und Sprachregelungen des Politischen – ich finde es ungenau und abstrakt und vor allem falsch: Demokratie lebt von Auseinandersetzung – Streit ist nur eine der vielen, munteren Varianten davon – und gerade in autokratischen Systemen ist der Streit verpönt, er schwächt die Macht.
Aber kommen wir zu uns zurück, von wegen Beziehungsgespräch, denn ich denke, wir müssen das klären, um eine Entscheidung zu treffen, um die herumzulavieren nur Kraft und Zeit kostet.
Es heißt ja gern über Paare, sie seien glücklicher, wenn gestritten würde – allerdings nur, wenn über Dinge gestritten wird, für die es Lösungen gibt, also nichts Grundsätzliches. Lösungen gibt es beispielsweise für Fragen, die sich ums Geld drehen oder um Ordnung, Grundsätzliches wären Schwierigkeiten mit dem Charakter oder der Gesinnung. Ich würde jetzt mal sagen, wir beide sind ein Schreib-Paar, das sich nicht unbedingt an herumliegenden Socken aufreiben würde (metaphorisch, wir verstehen uns, es sind metaphorische Socken), sondern immer am Grundsätzlichen.
Du schreibst Dinge, über die ich generell anders denke – und, ja, ich will sie so nicht stehen lassen, also fühle ich mich genötigt, mit dir ein bisschen darüber zu streiten. Ein bisschen streiten kann man vielleicht ersetzen mit diskutieren. Sicher, du könntest sagen, dir gefällt meine Streitkultur nicht – wir könnten uns ja auf eine andere einigen. Du kannst auch sagen, du willst, Streitkultur hin oder her, weder streiten noch diskutieren, das ist dein gutes Recht. Es wird dann nur ein bissl schwierig mit dem Briefverkehr. Wenn man sich nicht grundsätzlich einig ist über Dinge, muss man halt diskutieren, wenn die Meinungen sehr auseinander gehen, halt streiten – und ich würde sagen, du und ich haben, auf so ziemlich jeder Ebene, die literarische eingeschlossen, das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Da ist der Streit quasi vorprogrammiert. Andernfalls könnte ich nur höflich zu allem schweigen, was du so schreibst – und das wäre dann sicher alles Mögliche, aber kein Brief. Spielplatzmäßig korrekt könnte ich sagen, du willst nicht mit mir spielen, du willst, dass ich deine feinen Förmchen bewundere und die zarten Gebilde, die du damit produzierst.
Wo du schon Hannah Arendt erwähnst – ich wüsste übrigens nicht, warum irgendjemand bezweifeln sollte, dass es wichtig ist, in direktem, physischen Kontakt miteinander zu sein – , tatsächlich ist mir etwas geblieben aus dem Interview, das 1964 Günter Gaus mit ihr führte, und das kam mir zu Beginn dieses Wahnsinns, als ich rundherum sah, wie so viele der Intellektuellen auf Panik-Kurs gingen und die Schotten dicht machten, in den Sinn: „Das war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Ich lebte in einem intellektuellen Milieu, ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, daß unter den Intellektuellen die Gleichschaltung sozusagen die Regel war. Aber unter den anderen nicht. Und das hab ich nie vergessen.“
Mitnichten liegt übrigens eine Pathologisierung vor (entspann dich), wenn ich dein bedächtiges Umrunden in Wald und Flur als verrückt bezeichne – ich denke, als Schriftsteller sollte man zumindest in der Lage sein, mal die Perspektive zu verschieben, ist ja ein ganz probates Mittel, um seine Stoffe von verschiedenen Seiten zu betrachten. Vollführt eine ganze Gesellschaft einen absurden Akt – wie natürlich neben dem Slalomgehen im Park auch die erzwungene Maskierung –, muss man nicht Pathologisieren, wenn man das verrückt nennt. Man muss es nur mal aus einer gewissen Distanz betrachten.
Du und ich, wir werden nicht miteinander ins Spielen kommen, so viel ist klar. Wir sind, um die Metapher auszureizen, Kinder, die, und wenn sie sich alleine zu Tode langweilten, nichts miteinander anfangen können. Nur, weil beides Kinder sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie auch miteinander klarkommen, das ist immer so eine Idee von Erwachsenen. Ich werde darum ehrlich sein. Mir sind Autoren, die so dringend ihre Empfindsamkeit rühmen, suspekt. Ich halte dieses Zurückziehen in einen schallisolierten Elfenbeinturm für möglich, aber nicht gangbar.
Mir geht es dabei nicht um „Schauenlernen“ oder „Hinhören“ – das alles in Ehren, und gerade gibt es, auch abseits von Baustellengeräten, sehr viel zu schauen und zu hören, aber nicht alles, was geschaut und gehört und dann in wohlfeile Wort verpackt wird, ist auch von Interesse. Ich denke mal: Du hast ein Verständnis von Autor-Sein, das ich eher ablehne. Und ich würde mein Hemd dafür wetten: Umgekehrt verhält es sich genauso. Ich finde das übrigens nicht schlimm.
(Kein bisschen bin ich übrigens der Meinung, jeder sollte nun den ultimativen Corona-Roman schreiben, Gott bewahre, was du und ich in unseren Romanen treiben ist eine Sache, eine andere ist es – so wir schon in dieser Zeit einen offenen Briefwechsel führen sollen -, nicht kritisch und mit allen Ambivalenzen über das zu reden, was gerade passiert.)
Das Kreisen um die eigene Befindlichkeit, diese hypersensible Wahrnehmung, das „zu viel an Welt“, die es suggeriert, das alles dient für mich nicht der Selbstaufklärung, was Schreiben im besten Fall sein kann, sondern der Selbstverklärung.
Von Bekenntniszwang: Keine Rede. Argumentiere doch einfach, warum du die weiten Bögen machst im Park und im Wald, und wenn du schon nicht streiten willst, dann nenn es diskutieren, mir kommt das nicht drauf an. Wenn du aber „leise“ sein willst und über diverse Maschinen und dein Schreiben resümieren, bin ich sicher die falsche Ansprechpartnerin – in dieser speziellen Zeit, aber auch sowieso. Kinder inspirieren sich zum Spiel oder sie tun es nicht, das ist bei Autoren nicht viel anders. Wir würden im Sand nicht froh werden zusammen und werden es eben auch auf der Bank nicht. Ich sitz gerade auf der Bank, um ein bisschen zu streiten, aber vermutlich möchtest du eher in Ruhe die Rutsche betrachten.
Da ich deinen Brief nicht kritiklos hinnehmen kann, gäbe es nur zwei Möglichkeiten: Dazu zu schweigen oder zu streiten. Ersteres lehne ich ab, Zweiteres du.
Allzu deutlich wird mir dies alles, wenn ich auf den Schluss deines Schreibens eingehen muss, wo du plötzlich sehr episch wirst und von den „anderen Orten“ sprichst, die „sich seltener äußern mögen, langsamer auch“, und so weiter, weil das ist mir dann doch zu sehr waberndes Geraune, das in dem Satz gipfelt, „Aber sie sind es, die noch da sind, wenn das Licht einmal aus ist.“
Bitte, was für ein Licht? Wenn die Sonne untergeht? Die Welt? Oder nur wir, du und ich und die anderen, wenn wir sterben? Oder ist einfach nur die Glühbirne kaputt? (Ich hatte mal einen Freund, der, wenn die Birne in seinem Zimmer den Geist aufgab, sich zum Lesen in den Flur legte. Monatelang. Klar, man könnte sagen, das ist ein bisschen, du weißt schon, ich will da jetzt nichts pathologisieren oder so, aber er hatte diesbezüglich – „wenn das Licht einmal aus ist“ – eine Konsequenz, an die ich heute noch denke. Ich habe sie nicht, aber ich bewundere sie.) Und dann sind es diese von dir erwähnten Orte, die sich langsam und selten äußern und als harmlos verspottet werden, die dableiben? Wenn ich dich recht verstehe, möchtest du aber diese Orte, ja was eigentlich, bewohnen? In der Hoffnung, dann auch zu bleiben, über deine Worte? Über das Leben – oder das Licht? – hinaus zu wirken? Soll ich daraus schließen, dass du es für wichtiger hältst – und gar die Endlichkeit überdauernd – über diverse Gerätschaften zu schreiben, als sich hier und jetzt mit der diffusen und unruhigen Realität auseinanderzusetzen?
Bemühen wir in dieser Angelegenheit noch einmal Hannah Arendt: „Jetzt fragen Sie nach der Wirkung. Es ist das – wenn ich ironisch werden darf – eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken; aber ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinn, wie ich verstanden habe – dann gibt mir das eine Befriedigung, wie ein Heimatgefühl.“
Ich fürchte, du und ich, wir werden beieinander nicht heimisch werden. Ich will nicht wirken und wir werden – vielleicht sehe ich das zu pessimistisch, aber es ist meine Vermutung – wir werden nicht zu einem gemeinsamen Verständnis kommen.
Wie jedes andere Paar müssen wir auch als Schreib-Paar uns die Frage stellen: Können wir froh werden miteinander? Werden wir Freude haben aneinander und ein Heimatgefühl entwickeln, können wir Spaß haben zusammen? Vor zwanzig Jahren hätte ich womöglich einen Haufen Energie in eine Beziehung gesteckt, die von Anbeginn zum Scheitern verurteilt ist. Heute sehe ich das weitaus nüchterner und würde sagen: Lassen wir das. Mir macht das keine Freude. Gewiss, Beziehungen sind immer auch Arbeit und so – aber sie sollten nicht nur aus Arbeit bestehen. Ich finde immer, das gemeinsame Glück sollte deutlich überwiegen. Hier, bei uns beiden, ahne ich, dass wir uns in erster Linie auf die Nerven gehen werden. Bei solchen Paaren zu Besuch zu sein, ist ja immer ein Elend, dauernd schaut man auf die Uhr und trotzdem vergeht die Zeit nicht – ersparen wir uns und etwaigen Besuchern diese Tortur.
Viele Grüße,
Verena
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 4: Es fasziniert mich …
weiter ...Lieber Christian,
es fasziniert mich, mit welcher Hingabe und Wärme du über Menschen sprichst. Magst du uns wirklich? Einmal wurde mir in einer Radiosendung die Frage gestellt: „Frau Gaponenko, mögen Sie Menschen?“ Äh, habe ich gedacht und nach langer Stille gesagt: „Ich interessiere mich für sie“ (glaube ich). Wie ist es bei dir? Hast du es geschafft, deinen Verstand und dein Gefühl zu synchronisieren? Ich bin dir jedenfalls dankbar für deinen großartigen Brief, der mich lange beschäftigt hat, vor allem dein trauriges Gedicht über den Verlust eurer Katze. Das Video auf Youtube kann ich mir nicht ohne Tränen anschauen.
Diese Zeilen schreibe ich in meiner Bibliothek an einem ausgeklappten Spieltisch, der mir nun als Schreibtisch dient. Dabei sitze ich mit dem Rücken zum Fenster (anders kann ich mich nicht konzentrieren) und lausche dem Abendgesang eines einsamen Amselmannes. Er singt leiser als sonst, scheint mir, es gibt ja kaum Fluglärm. Auf meinem Schoß schläft die einäugige Katze Lilly. Ab und zu gibt sie ein schnatterndes Geräusch von sich, als verfluche sie eine unerreichbare Beute in ihrem wilden Katzentraum. Neben mir funkeln mehrere Parfümflakons in den Bücherregalen. Wenn ich meine Augen schließe, erinnere ich mich, was ich bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte, an den Duft in jedem dieser Flakons wie an eine Geschichte. Eine Fähigkeit, die ich dem Training meines Geruchsgedächtnisses zu verdanken habe. Seit drei Jahren brüte ich schon an meinem Parfümroman, bestelle Parfümabfüllungen, teste immer wieder unbekannte Düfte, notiere meine Eindrücke in einer Datei. Das Schnuppern an meinem Handgelenk und an parfümbesprühten Teststreifen ist inzwischen mein Alltag. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht über eine Duftnote oder eine Duftkomposition nachdenke. Manchmal glaube ich sogar Parfüm im Traum zu riechen, ein intensives Gefühl. Angefangen hat alles mit Diors Diorissimo.
Diesen 50-er-Jahre-Maiglöckchenduft habe ich im Sommer 2017 während meines Schreibaufenthalts im Stift Klosterneuburg gekauft – mit dem Gedanken, meine riesige und karge Klosterzelle mit etwas Schönem zu beduften. Damals habe ich an einem Roman geschrieben, in dem es um alte Bücher und einen verliebten Bibliothekar geht, und es war ein großes Glück für mich, dass ich eine Arbeitswohnung im Stift zur Verfügung gestellt bekommen habe (wie es dazu kam, erzähle ich dir gerne auf unserer Fahrt durch den Gotthardtunnel, wenn du magst). In unschuldige Wolken von Diorissimo gehüllt, habe ich also in jenem heißen Sommer eine junge Wissenschaftlerin für ein Interview in der angenehm kühlen Stiftsbibliothek getroffen, eine kluge, freundliche Frau, die meine profanen Fragen genauso geduldig ertragen hat, wie ich ihre kryptischen Antworten. Zum Glück ist sie auf die Vatikanische Bibliothek zu sprechen gekommen, in der sie kurz vorher geforscht hatte. „Ach“, schwärmte sie, „und wie sie duften, die Patres auf den Korridoren. Betörend!“ Ich erinnere mich an ihr genießerisches Lächeln, die halbgeschlossenen Augen und dass mir das Blut ins Gesicht geschossen war. Mein „Ein Geistlicher, der sich parfümiert? Ausgeschlossen!“ ist inzwischen einem „Warum nicht?“ gewichen, bekräftigt durch mein Wissen um die sakrale Ebene des Per-fumum.
Patres als wohlriechende Panther. Dieses Bild hat mich nicht losgelassen, und damals schon in Klosterneuburg habe ich angefangen, mich dem Thema Parfüm zu nähern. Ich finde es erstaunlich, dass dies so spät in meinem Leben stattgefunden hat. Dabei bin in einer parfümierten Welt aufgewachsen, die meisten Frauen in meinem Umfeld trugen Parfüm, meine Mutter, ihre Freundinnen, meine Lehrerinnen, Verkäuferinnen im Lebensmittelgeschäft und, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, Ärztinnen. Für diese Frauen muss es in einem menschen- und genussfeindlichen System nicht einfach gewesen sein, sich schön zu fühlen. Dass sie sich nicht aufgegeben haben – in der notorischen Mangelwirtschaft der Sowjetunion, dafür spricht die Tatsache, dass sie Parfüm trugen. Perfume is a promise in a bottle, sagt die aus Weißrussland stammende Parfumeurin Sophia Grojsman. Düfte waren, sind und bleiben in der Tat ein Versprechen für Glück, Erfolg, Anerkennung, Schönheit. Sie motivieren uns aber auch, mehr erreichen, mehr sein zu wollen. Ich erinnere mich, wie mich als Mädchen manchmal Parfümschwaden in einer Warteschlange umwehten, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Du fragst mich, was mir in der Coronazeit am meisten abgeht. Reisen, in einer Weltstadt herumspazieren, in der Menge baden, hier und da eine süße Duftspur aufnehmen und ihr wie Süskinds Grenouille eine Zeitlang folgen, in die Körperatmosphäre des anderen eindringen. Social distancing und Mundschutz werden mich leider noch lange daran hindern. Soviel zum Thema Taktgefühl 😉
Bis bald
Marjana
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 3: sie zaubern mit ihrem brief kammermusik in meinen arbeitsraum …
weiter ...schaan, 12. mai 2020
liebe antonie
sie zaubern mit ihrem brief kammermusik in meinen arbeitsraum.
wohltemperiert und von feiner weite. sie lassen revue passieren, wie wir ins gespräch kamen, im bewusstsein, dass wir ein gespräch sind. lyrische stimmen begleiten uns. die «wenigen geräusche», die philippe jaccottet genügen, sind noch leiser geworden. zu hören wie das leuchten von blühenden eichkätzchen am wegrand.
«ist uns nur noch mit gedichten zu helfen?» fragen sie so entwaffnend, wie das nur kinderseelen vermögen. ich möchte mir helfen, das zu glauben. verhalten, mit dem unterton von «erkenne die lage, rechne mit deinen defekten».
es gehört fraglos innere noblesse dazu, eine form von selbstvergewisserung in gedichten auszuüben, die den bann der lage zu brechen versucht. ich bewundere das wagnis, das sie damit eingehen. in leichter sprache, die die schwerste ist. sie haben friederike mayröcker angerufen. wie in innerer anrufung. jemanden, der schon solange in nicht endendem schreibzustand, eine eminente dichterin, die sich in so vielfältigen étuden der aufmerksamkeit verschenkt: sich an gedichte zu verlieren, scheint mir die nachahmenswerteste kunst zu sein. die vornehmste art zu verschwinden und vielleicht im verschwinden zu bleiben. eine kunst, die sich gleichwohl von angeregtem ferngespräch alimentiert, ein drinnen und draussen herzaubert, mühelos. es genügen schon wenige worte.
das hellhörig werden auf details erzeugt so etwas wie eine lakonische trance. erzeugt einen zusammenklang, ausgelöst von beobachtungen im kleinen. man kann sich das aufsagen und aufzählen in hüpfender litanei bis sich ein fast unhörbarer oberton einstellt. eine wahrnehmung und weltbenennung mitunter wie in alfabet von inger christensen. selbstvergewisserung in der wortfindung auch hier.
fast beiläufig bin ich gestern auf die interpretation der goldberg-variationen von evgeni koroliov gestossen, die mich begeistern. da legt jemand so beredtes zeugnis ab vom inneren aufbau der dinge, in souveräner leichtigkeit, klar und hell. er hört das gesetz, oder macht es hörbar. nichts anderes als das, was nur musik von bach vermag. so selbstvergessen und herrlich, sodass fast pötzlich alles diffuse weicht, nichts mehr zu dämpfen vermag. es lüftet sich aller schleier. dieses momentum allein zählt, nährt und wärmt. – die äussere welt kann einem gestohlen bleiben mit ihren vielfältigen zumutungen …
ich lese aus ihrem brief, wie gedichte lebenselexier sind, zu sauerstoffreichen stellen werden, kleine exile, um sich zu begegnen. tomas transströmer hat, das muss ich sagen, eine unerhörte photosynthese mit worten geschaffen.
gelegentlich kommt ein wetterleuchten, das uns erhellt. der regen tröstet.
herzliche grüsse in alle weiler und gärten der poesie.
hajqu
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 10: In meinem ersten Brief schrieb ich von dem Gefühl unserer Verantwortung, diesen besonderen Augenblick zu interpretieren …
weiter ...Lieber Christoph.
In meinem ersten Brief schrieb ich von dem Gefühl unserer Verantwortung, diesen besonderen Augenblick zu interpretieren. Nun bin ich beim letzten angelangt und merke, dass mir, egal für welche mögliche Interpretation, jegliches Gefühl von Gewissheit fehlt. Sinn verleihen, den Geschehnissen eine Bedeutung zumessen, die Gesellschaft muss dieser Krise eindrücklich Ausdruck verleihen. Und schau: alles wird gesagt, von allen, auf jede erdenkliche Art und Weise. Es wurden andere Zeiten und andere Ereignisse in Erinnerung gerufen, man hat eine neue, eigentlich alte Erzählung begonnen, sie neu aufgerollt und sie bestätigt. Gestärkt und deshalb neu oder zumindest aus heutiger Sicht neu betrachtet, wurde sie zu etwas Neuem mit Ausblick auf die Zukunft, zu etwas anderem als das Vergangene. Ganz sicher wird sich diese Erzählung in ihrem Wesen und in ihren Eigenschaften, ihren Ausdrucksweisen und Gefühlen unterscheiden, von dem was war und was man vorher hatte. Insgesamt sehr viel! Vieles ist gesagt worden, vieles wird gerade gesagt und vieles wird danach und später noch gesagt werden, wir werden unermüdlich sein.
„Nichts wird mehr sein wie es war“. Diesen eindringlichen Satz hat man im Radio, im Fernsehen oft vernommen, man hat ihn gelesen in den verschiedenen Medien und Zeitungen, gezwungenermaßen. Allerdings und bei allem Respekt vor den vielen Todesfällen, bin ich da im Zweifel. Nicht wegen der apokalyptisch klingenden Aussage als solcher, die ich nicht teile, vielmehr hege ich Zweifel an der Ehrlichkeit und Würde der Gesellschaft, die so etwas sagt. Etwas hat sich verändert, sehr wahrscheinlich hat sich sogar vieles verändert. Doch uns zu verändern ist schwierig, wir kennen uns und wissen, dass wir unter unseren vielen guten Eigenschaften auch eine nicht so schöne haben, und zwar, schnell zu vergessen. Die Dinge zeigen sich letztendlich oft anders und entwickeln sich in eine ganz andere Richtung, als man hier und jetzt denkt.
Ist es für die Begegnung mit der gegenwärtigen Zeit(enwende) nicht auch vorteilhaft, das ruhige und ruhende Auge auf dem scheinbar Unwesentlichen zu schulen?
Auf diese deine Frage glaube ich, eine Antwort versuchen zu können und daran, im Gegensatz zu allem anderen, kaum zu zweifeln. Ich bin mir sicher, dass diese stillstehende Zeit für die Gesellschaft, verstanden als „jeder von uns“, eine Gelegenheit darstellte. So tiefgreifend wir die Unmöglichkeit von anderem auch erlebten, es gab uns die Möglichkeit, die Stille im ganzen Ausmaß ihres Bewusstseins wahrzunehmen.
Es hatte die Intensität eines andauernden, unaufhörlichen Volumens. Außerhalb von uns
hörten wir die anhaltende Dauer, das Kontinuum, etwas, das unendwegt da ist. Zu hören war es für die Venezianer, die Florentiner. Für die Mailänder, und Bergamo. Wir hörten es hier in Abtei, in den Wäldern, in den Ställen. Ob auf See, weiß ich nicht, wir werden die Flüchtlinge fragen.
Nun wissen wir, was der Blick auf die Stille sein kann, der Horizont eines Erkennens dessen, was wir vorher nicht gesehen hatten. Vor allem aber wissen wir, dass die Stille für eine lange Dauer von Wochen aus dem Verborgenen trat. Weil wir sie entblößten, sie unserer lärmigen und geschäftigen Hüllen entkleideten und dem Zuhören erlaubten zuzuhören. Der Stille erlaubten, gehört zu werden. Einzigartig und ohnegleichen, eine Stille bar ihrer Mehrzahl. Oft schon schrieb ich in meinen Gedichten über die Stille, immer dabei über ihr Vielfaches, indem ich Bezug nahm, was in unserem Inneren ist. Im eigenen Kopf, innerhalb des Hauses, draußen, von der Höhe der Berge aus, in einem Händedruck während des Tages. In der Nacht, die die Mutter des Hörens ist, ein feines Werkzeug, das dem Atem lauscht, wie er die Stille streicht, sie aber nicht stimmt.
Von jetzt an weiß ich, dass die Einzigartigkeit als Eigenschaft der Stille selbst angehört, ihr allein. Eine einzige Komposition, für nur ein Instrument. Nur ein Akkord, absolut in seiner Vollständigkeit.
Wie das erzählen? Wie diese Stille mit Worten abbilden? Mit welcher Beschreibung? Alles haben wir gesagt, weil wir Menschen ohne Stille sind und was nicht ausgedrückt werden konnte, wurde angekündigt mit dem Läuten der Totenglocken. Es war dramatisch, und traurig und wahr ist auch, dass es schön war, schön und ohne Vergleich.
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, dass uns diese Zeit die sachte Ahnung einer mystischen Erfahrung beschert hat, fernab von Ekstase oder Ähnlichem, durchaus, aber bezugnehmend auf eine innige Verbundenheit mit dem Dasein einer höheren Stille, die weder Anfang noch Ende hat. Wir haben uns in der Stille verändert, haben uns mit der Stille identifiziert, indem wir eine Art kognitiver Beziehung mit ihr eingegangen sind. Lang hat es gedauert, aber es hat auch kurz gedauert.
Stille kann nicht improvisiert, sie muss erkundet werden,
mit Hingabe suchen, die Stille durchdringen
und sie einem einzigen Instrument zuweisen,
um es als solches auf den Prüfstein zu legen,
sein Können und seinen Klangraum.
Erlaube mir, Christoph, diesen unseren Briefwechsel den Ärzten zu widmen, die in Italien im Zuge der Epidemie gestorben sind. Es ist eine traurige Liste, die die Zahl Hundert bei Weitem übersteigt. Zuzüglich der Zahl jener, die sie geheilt haben und jener, die sie nicht haben retten können. Roberta
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Brief 1 / Christoph an Roberta (I): Ein literarisches Blinddate …
Brief 9 / Christoph an Roberta (V): Zunächst einmal bin ich ganz bei dir …

Un epistolario tra sconosciuti. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Lettera 10: Scrissi nella prima lettera che la sensazione era quella di una nostra responsabilità di interpretazione di questo momento così particolare …
weiter ...Caro Christoph.
Scrissi nella prima lettera che la sensazione era quella di una nostra responsabilità di interpretazione di questo momento così particolare. Ora, arrivata all’ultima, mi manca la sensazione di certezza verso qualsiasi interpretazione possibile. Dare un senso, attribuire un significato a ciò che si manifesta, la società deve dare un contenuto espressivo a questa crisi.
E vedi: tutto viene detto e da tutti in tutte le maniere possibili. Sono stati ricordati altri tempi e altri fatti accaduti, si è dato inizio a una narrazione nuova, o vecchia insomma, ma ripetuta e confermata. Rafforzata e quindi nuova, o almeno, nell’interpretazione di ora è diventata un inizio con riferimento al futuro e sarà qualcosa di diverso rispetto al passato. Certamente si distinguerà nell’essenza e nelle caratteristiche, nelle manifestazioni e negli affetti per ciò che c’era o che si aveva prima. Tanto insomma! Tanto è stato detto, tanto si dice ora, e tanto si dirà dopo e più avanti ancora, saremo instancabili.
“Niente sarà più come prima”. È questa una frase incisiva che si è sentita dire alla radio, alla televisione, l’abbiamo obbligatamente letta nei vari media, nei giornali. Ecco, qui, nel profondo rispetto delle molte morti avvenute, io sono in dubbio. Non sulla considerazione stessa dal tono apocalittico, alla quale io non credo, ma sull’onestà e sulla dignità della società che afferma questo. È cambiato qualcosa, sì, probabilmente sarà cambiato molto. Ma è difficile cambiare noi, noi ci conosciamo e sappiamo che tra le tante qualità abbiamo anche quella poco bella di dimenticare in fretta. Le cose poi, spesso si presentano diversamente e vanno in tutt’altra direzione da come si pensa qui e ora.
Non è forse ugualmente utile esercitare l’occhio placido e fermo su ciò che apparentemente non è essenziale?
Credo di poter dare a questa tua domanda una prova di risposta, della quale al contrario del resto, poco dubito. Sono certa che la società, intesa come “ognuno di noi”, ha avuto in questo tempo fermo un’opportunità. L’impossibilità di altro, così radicale, ci ha dato la possibilità di percepire il silenzio nella sua profonda consapevolezza.
È stato un volume continuo e incessabile nell’intensità. Abbiamo sentito fuori da noi la duratura perpetua, il continuo, ciò che esiste senza interruzione.
Lo hanno sentito i veneziani, i fiorentini. I milanesi e Bergamo. Lo abbiamo sentito qui a Badia, dentro ai boschi e nelle stalle. Non so in mare, lo chiederemo ai migranti.
Ora sappiamo cosa può essere lo sguardo sul silenzio, l’orizzonte di un vedere ciò che non avevamo visto prima. Ma soprattutto sappiamo che il silenzio per un tempo lungo settimane, è uscito allo scoperto, poiché lo abbiamo denudato, spogliato delle nostre vesti rumorose e sbrigative, e pertanto abbiamo permesso all’ascolto di ascoltare. Al silenzio di poter essere ascoltato. Ed è stato unico e senza uguali, un silenzio esente dal suo plurale. Nei miei versi ho scritto spesso del silenzio e ogni volta nella sua molteplicità, raccontandolo con riferimento a quello che sta dentro di noi. Nella mente, dentro casa, fuori, dall’alto delle montagne, in una stretta di mano durante il giorno. E nella notte che è madre dell’udire, un fine attrezzo che ascolta il respiro strofinare il silenzio, ma non lo accorda.
Da qui in poi so che la qualità di essere singolare appartiene al silenzio stesso, a lui solamente. Un componimento solo, per uno strumento solo. Un unico accordo, così completo da essere assoluto.
Come raccontare questo? Come rappresentare con parole questo silenzio? Con quale descrizione? Tutto abbiamo detto, poiché noi siamo persone senza silenzio e ciò che non poteva essere pronunciato, era annunciato dalle campane che suonavano a morto. Ed è stato drammatico, ed è stato triste. Ma è vero anche che è stato bello, e senza confronto.
Non credo di essere in errore se dico che questo tempo ci ha consegnato la lieve percezione di un’esperienza mistica, lontana sì da estasi o altro, ma relativa a un’intima unione con la realtà del silenzio superiore che non ha principio né fine. Ci siamo trasformati nel silenzio e identificati con il silenzio, assaporando una forma di rapporto conoscitivo con esso. È durato molto, ma è durato anche molto poco.
Non s’improvvisa il silenzio, si va alla ricerca,
cercare con impegno, penetrare il silenzio
e destinarlo a un solo strumento,
così da mettere alla prova la capacità
e le sonorità dello strumento stesso.
Permettimi Christoph, di dedicare questo nostro epistolario ai medici morti in Italia nel corso dell’epidemia. È un triste elenco e supera di molto il numero cento. Si aggiungono al numero di chi hanno guarito e a quello di chi non sono riusciti a salvare. Roberta

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 2: Im April klopften Sie bei mir an, im April, „dem schrecklichsten aller Monate“ …
weiter ...Weiler im Allgäu, 8. Mai 2020
Lieber Hansjörg Quaderer,
im April klopften Sie bei mir an, im April, „dem schrecklichsten aller Monate“, wie ihn T.S. Eliot benannte. Via Lichtgeschwindigkeit, via Mail vom Liechtensteiner Rheintal über den Bodensee ins unbekannte Westallgäu. „Wie beginnen?“, fragte ich. „Es ist gut zu fragen, wie beginnen?“, schrieben Sie. „Zu fragen beginnen“.
„Wie einen Briefwechsel also anzetteln? Sorglos zu beginnen, wäre gut, nichts vorauszusetzen. Ein Schriftwechsel gleicht einem Wildwechsel…zu lesen nämlich, wo einer gegangen“, schrieben Sie in Kleinschreibung. So war ich versucht, in die Kleinschreibung meiner 70er Jahre zurückzukehren, beließ es aber dann bei einem Versuch.
„Sorglos zu beginnen“, schrieben Sie. „Con sordino“, antworte ich, „in diesen Tagen nur mit Dämpfer, gedämpft, mit leisen Tönen wie beim Geigenspiel, auch im Erinnern.“
„Wo grad so vieles aus den Fugen“, sagten Sie: „ Den blühenden Birnbaum zum Trost nehmen für die Zumutungen der Pandemie.“ Worauf hören? Auf „die wenigen Geräusche“? Auf diese kleine Hoffnung, die Seilhüpfen würde in den Prozessionen…Pèguy
Und auf das Geläut der Glocke am Morgen, wenn ich das Fenster öffne, den Gesang der Vögel zu hören. Es gibt da etwas, was mich Erschrecken lässt, das bei großen Bränden manchmal auftritt, es ist diese Unerklärlichkeit der Stille, der Pausen, die mich verwirren und beglücken zugleich, wie das Gefühl vom Ende einer Welt, ohne die ich nicht mehr atmen könnte. Trotzdem glaubt man an Worte im Vorübergehen, die ins Herz springen und sogleich verstummen.
Ist uns nur mit Gedichten noch zu helfen? So versuche ich es mit der Poesie, um die Welt um mich herum wieder zu verstehen. Da schaue, höre ich Dinge, als hätte ich sie nie gekannt? Da stehe ich plötzlich inmitten einer Welt, angstvoll wie ein Kind und schreibe Kindergedichte.
Auf leisen Sohlen schleicht manchmal das Glück
über Stock und Stein, stolpert, strauchelt, stakst
und lässt sich nieder als kleine Feder auf deinem Bein.
Dieses Kindergedicht stammt aus meinem neuen Buch „Es flattert und singt, Gedichte und mehr und alles für Kinder, das erscheinen wird in diesem Herbst. Heute Abend habe ich die Fahnen gelesen und mich gefreut wie ein Kind am Dichten zwischen Hahn und Henne im Hühnerstall inmitten der CoronaTage. Ist es nicht so? Wo das Unsichtbare sein Unwesen treibt, dichtet das Kind dagegen an, gegen die Dünnhäutigkeit, dem aussätzig geworden sein, dem ausgesetzt sein der Sätze. Wieder läuten die Glocken, rufen, als wollten sie mich in meiner stillen Verzweiflung trösten. Sie singen, sie dichten die Glocken, verbinden Himmel und Welt.
Heute sprach ich mit Friederike Mayröcker am Telefon und wir beschlossen, den Fuss in die Luft zu setzen, gemeinsam, dass sie trüge, war unsere Hoffnung mit Hilde Domin, die sie mag, wie dasGedicht, ebenso jenes, das Angelika Kaufmann, die Freundin schreibt, Tag für Tag, schon zum 80. Mal immer und immer wieder auf ein neues Blatt.
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
Friederike Mayröcker
Ein bisserl schreibe sie noch gegen die Angst und bald, sagte FM, wenn der Spuk vorüber ist, treffen wir uns im Café Sperl.
Es liegt in der Luft, dieses Gedämpfte, Abstand halten, Tröpfchen, die uns Krankheit und Tod bringen können: verhalten die Stimme, das Lachen gedämpft … Wie wesentlich ist uns der Mund, das Wort – als hätte man es uns verboten?
Dabei umhüllt uns die Natur mit solcher Schönheit, mit solchem Blühen, einem unerwartet frühen Sommer, dem kreisenden Milan, dem Ruf der Amsel, mit duftendem Flieder, weißen und schwarzen Tulpen, Päonien, Akelei, Löwenzahn, Wiesenschaumkraut, Ehrenpreis… und immer doch der Gesang der Vögel am Morgen und diesem Blau und dem Wolkenspiel des Himmels.
Es wird gesagt, dass das „Herunterfahren“ der Natur gutgetan habe, dem Klima geholfen, die Verschmutzung reduziert, nur mit dieser rätselhaften Bedrohung kommen wir nicht zurecht, wie sollten wir auch? Wir haben genug von der Quarantäne und trotzdem sehne ich mich wieder nach einer Art Abgeschlossenheit, den Zimmerkonzerten, dem bei sich sein, natürlich ist dies privilegiert…
Und dann ist da Europa, was ist dir, altem Europa? In der Übertragung des Europa Konzerts der Berliner Philharmonie mit Abstand und kleiner Besetzung, höre ich Musik, spüre etwas rätselhaft Gemeinsames, wir sind im gleichen Boot, bei den „Fratres“ von Arvo Pärt, bei Ligeti und Mahler überkommt mich für einen kurzen Moment dieses Gefühl der Verbundenheit, des Trostes. Wie ist es eine Stunde danach? Zahlt es sich aus, dieses bedingungslose Grundeinkommen? Ich denke an Aristoteles, der mich als Jugendliche so beeindruckte mit seiner Nikomachischen Ethik und an den biblischen Text vom Weinbergbesitzer. Was ist gerecht? Was gewährt ein gutes Leben? Die Freiheit bleibt uns sowieso, etwas daraus zu machen oder auch nicht. Was ist die Erde, die uns alle leben lässt, die wir ausbeuten? Sind wir nicht alle nur Gewordene aus Geschenktem, Empfangenen, aus dieser rätselhaften Mahlzeit, dem 1:1 eingelösten Stoffwechsel? Es wird nicht überall gejammert, Veränderungen werden konstatiert im alltäglichen Miteinander, wir erkennen uns hinter, unter der Maske, wir sind müde, vereinzelt, betroffen, haben uns eingerichtet oder auch nicht, sind verzweifelt, fühlen uns wohl. Und heute, der 8. Mai, das Ende des 2. Weltkrieges, 75 Jahre danach. Das „Lacrimosa“ im Essener Dom in Abstand und Nähe. Was ist nur Leben? Und was Sterben? Nichts mehr ist wie zuvor.
Ich höre das Plätschern des Brunnens, sehe den Mond, der aufgeht…es gibt diese kleine Pause nach dem Regen, wo alles noch nass ist und doch der Weg, die Straße trocken erscheint. Heißt etwas begreifen, sich verwandeln? Und ich spreche leise:
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
zwei feuchte Lappen
Seele und Leib
und dann lese ich FM und mir zugleich diese Zeilen vor:
Zwei Wahrheiten nähern sich
einander.
Eine kommt von innen, eine kommt
von außen,
und so sie sich treffen, hat man eine
Chance,
sich selbst zu sehen.
Tomas Tranströmer
Es kommt Regen heute noch und während ich aus dem Fenster schaue, sind sie nahe, die Berge, zum Greifen nahe aus Österreich und der Schweiz,
herzlich grüße ich hinüber nach Schaan
Waren da zwei Wahrheiten, die sich einander nähern,
Die eine kommt von innen, eine von außen
und so sie sich treffen, hat man eine Chance,
sich selbst zu sehen?
Antonie Schneider
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 3: Gross war die Freude über deinen kleinen Brief …
weiter ...30.April / 1.Mai
Liebe Marjana,
groß war die Freude über deinen kleinen Brief! Ich bin entzückt, dass du Bücher von mir besitzt, sogar Farblose Witze hast du, unglaublich! Diese Publikation ist längst vergriffen, und Reinhold Kirchmayr, der damals die Sache initiiert und die Bilder beigesteuert hat, d.h. er hat Texte und Bilder kombiniert, ist seit langem mehr in Indien als in Österreich, und wenn er in Europa ist, dann hauptsächlich in Ungarn, wo er ein kleines Häuschen besitzt. Keiner kann so schön lachen wie er! Außerdem fällt mir zu ihm sofort ein, dass er einmal einen Sommer lang unterwegs war in Sachen Wäscheklammern … Er suchte die idealen Wäscheklammern, die er für seine Ausstellung im Herbst unbedingt brauchte, wie er sagte. Immer wieder, wenn ich ihn in diesem Sommer traf, hatte er Wäscheklammern dabei, aus verschiedenem Material und in verschiedenen Farben und Größen, es war der Sommer der Wäscheklammern. Als ich dann im Herbst zu seiner Vernissage ging, war ich natürlich sehr neugierig. Die Ausstellung fand in einem recht kleinen Raum statt. Von einer Ecke zur anderen war eine Leine gespannt, an der Zettel mit Wäscheklammern befestigt waren (er hatte sich für die ganz einfachen aus Holz entschieden). Auf jedem Zettel stand ein Buchstabe, von links nach rechts konnte man lesen: „ZIEH LEINE“. – Ich war entzückt, tief entzückt!
Zwei weitere Highlights seiner künstlerischen Ausstellungstätigkeiten:
Einmal bespielte er einen Kaugummiautomaten. Warf man eine bestimmte Münze ein, ertönte eine Musik (komponiert von Gerald Futscher) und heraus kam eine Plastikkugel, in der sich ein kleines Kunstwerk befand.
Und ein anderes Mal hatte er bei einer großen Leistungsschau österreichischer Kunst in einem sehr renommierten Museum einen ganzen Raum zugesprochen bekommen, um ihn zu bespielen (um schon wieder dieses Wort zu verwenden). Er vergaß die Sache, war unterwegs in Asien oder weiß der Kuckuck, natürlich nicht erreichbar, und bei der Eröffnung der Ausstellung glänzte sein Raum mit Leere, nur sein Namensschild war angebracht. – Ich muss ihn fragen, wie das wirklich war, im Moment bin ich mir nicht mehr ganz sicher … Ich höre ihn lachen. Was für ein lautes, außergewöhnliches, nicht enden wollendes Lachen!
Reinhold war auch immer wieder Gast in dem Stadtheurigen, in dem ich lange gearbeitet habe, und über den ich dir tagelang erzählen könnte … Schade, dass du wahrscheinlich nie dort warst.
Nur ganz kurz: Bis 2013 war ich Pächter dieses Stadtheurigen, den ich zusammen mit einem Freund fast genau zwei Jahrzehnte lang betrieben habe. Ich habe dort alles gemacht, was so anfiel, zumindest die ersten zehn Jahre, von früh bis spät, von Buchhaltung bis Klo putzen, von Kartoffeln schälen bis Kellner sein, von Lieferanten empfangen bis Sperrstunde machen usw. Die letzten Jahre war ich dann nur noch als Kellner tätig, das „Kellnerbein schwingen“ nannte ich die Tätigkeit gern, weil sie für mich viel mit Tanz zu tun hatte, aber auch mit Schauspiel – ich fühlte mich sauwohl in dem Gastgarten, machte während der Arbeit oft Späße, erzählte Lügengeschichten, hatte einen Karl … Irgendwann werde ich über diese Zeit, über die ich tonnenweise Aufzeichnungen habe, ein Buch schreiben, Betonung auf irgendwann.
2013 hat dann mein Knie nicht mehr mitgespielt, und als mein Freund und Partner Michi im selben Jahr überraschend gestorben ist, er war erst 54, war die Sache für mich erledigt. Ohne ihn und mit marodem Knie wollte ich nicht mehr weitermachen.
Dass ich von Reinhold auf den Heurigen gekommen bin, hat einen einfachen Grund: Wenn ich in den letzten Jahren gefragt wurde, wie der Heurige so war, musste ich oft als erstes an einen Abend denken, an dem Reinhold für eine größere Gruppe reserviert hatte. Sommer war’s, der ganze hintere Teil des Gartens war für ihn reserviert, ca. 50 Plätze. Er machte eine kleine Vernissage in dem Salettl, das sich in diesem Bereich befindet (ein Salettl ist ein Pavillon, ein kleines Extra-Häuschen). Seine Freundinnen und Freunde trudelten ein, es war eine illustre Gesellschaft, darunter auch einige Kinder. Bald gab es bunte Kreiden, und die Kinder begannen damit den Boden des Heurigen, der aus Beton ist, zu bemalen. Dass du keinen falschen Eindruck bekommst: der Garten wird dominiert von üppigem Grün, es gibt z.B. eine große Fläche, die wild bewachsen ist, eine riesige Wand war damals noch bis zum Dach hinauf mit Efeu bedeckt, zwei Nussbäume, diverse Blumen usw. Vielen, die zum ersten Mal in den Gastgarten kommen, schießt als erstes das Wort „Oase“ in den Kopf.
Die Wege aber sind aus Beton bis vor zum Eingangsbereich, zum ersten Hof – und bis dorthin bemalten die Kinder den Boden. Es sah großartig aus, ich musste an Graffitis in Berlin und anderen Metropolen denken, ich musste immer wieder über Kinder, die am Boden saßen und lagen, hinwegsteigen, die Getränke auf meinem Tablett führten manchmal einen Tanz auf, fiel nichts zu Boden, hieß es: Keine Scherben bringen Unglück … Aber nichts da, es war ein wunderbarer Abend, und er hatte erst begonnen. Es waren null kinderfeindliche Gäste im Garten (in Wien und bei ca. 120 Sitzplätzen ein kleines Wunder), und Reinholds Freundeskreis war, wie gesagt, ein bunter Haufen. Ein Tisch in dem reservierten Bereich war noch frei, und an dem saß plötzlich ein fremder älterer Herr. Ich sagte ihm, dass hier hinten alles reserviert sei, Reinhold meinte, das passe schon, vielleicht würden eh nicht alle kommen, die er eingeladen hatte. Der Herr, ein sympathischer ca. 60-jähriger Deutscher, meinte, er würde sofort verschwinden, wenn wir den Platz brauchen. Er hatte längeres schütteres Haar, Lausbubenaugen hinter einer Brille, Schalk im Nacken, eloquent … Ich kürze ab: Als ich das nächste Mal nach hinten kam, lag eine Frau vor dem Herrn auf dem Boden. Sie war gerade gestolpert, gestürzt und ausgerechnet vor seinen Füßen gelandet, aus ihrer Handtasche war ein Buch gefallen. Der Herr reichte der Frau die Hand, um ihr aufzuhelfen, da sah er das Buch auf dem Boden und rief sofort aus: „Was, das gibt’s doch nicht!!! Bei dem Autor habe ich in Brasilien wochenlang gewohnt!“ Und sie sagte: „Und ich habe ihn übersetzt!“ Der Herr konnte es kaum glauben, unterhielt sich in der Folge mit der Übersetzerin und bestellte gleich ein weiteres Vierterl. Als ich es ihm brachte, redete er aufgekratzt über den brasilianischen Autor und über den Zufall, ausgerechnet hier in diesem Hinterhof eine seiner Übersetzerinnen zu treffen. Ob ich Martina Schmidt kennen würde, sie habe ihm dieses Lokal empfohlen, und er müsse sagen, es übertreffe schon jetzt alle seine Erwartungen. Ich sagte, natürlich kenne ich Martina, sie war damals die Geschäftsführerin vom Deuticke Verlag, ich hätte schließlich zwei Bücher bei Deuticke veröffentlicht. Er riss Mund und Augen auf und schrie: „WAS HABEN SIE???“ – Er war jetzt völlig aus dem Häuschen. Ich stand vor ihm mit dem Tablett in der Hand, die grüne Schürze umgebunden, der gute Mann starrte mich fassungslos an, rang nach Luft (um nur ein bisschen zu übertreiben), krächzte mit belegter Stimme, er brauche dringend ein weiteres Vierterl … Um ihn herum tobte das Leben, er mittendrin, rotgesichtig, strahlend, trinkend, bedient von einem Autor, am Nebentisch eine Übersetzerin, und damit immer noch nicht genug. Er verriet mir, dass er bis vor kurzem als Buchvertreter in ganz Deutschland unterwegs gewesen sei. Er fragte mich nach meinem Namen und nach meinen Büchern bei Deuticke. Er meinte, der Titel Männer wie uns sage ihm was … Als ich ihm das nächste Vierterl brachte, konnte ich ihn schon wieder überraschen, indem ich meinte, und das war so eine blitzhafte Erkenntnis aus heiterem Himmel: „Ich glaube, wir sind vor mehr als 10 Jahren einmal zusammen an einem Tisch gesessen, und zwar in Frankfurt.“ Der Herr, er hieß Axel, wie ich inzwischen wusste, wunderte sich über gar nichts mehr. Männer wie uns stand damals kurz vor der Veröffentlichung, und der Verlag, also Martina, nahm mich mit nach Frankfurt, wo ich das Buch bei einer Vertreterkonferenz vorstellen sollte. Ich muss leider sagen, ich machte dabei gar keinen guten Eindruck, das Buch war dann auch ein völliger Misserfolg, es hat mir nur Schimpf und Schande eingebracht … Jedenfalls nach der Konferenz begann der gesellige Teil, und ich war mir sicher, dass dieser Axel, der jetzt vor mir saß, damals an unserem Tisch das große Wort führte. Martina sagte mir, es handle sich bei ihm um den deutschen „Starvertreter“ Soundso …
Sonst passierte auch noch viel an diesem Abend im Heurigen mit Reinhold und seinem bunten Haufen und all den anderen, aber genug. Es war einer jener besonderen Abende, die ich dort oft erlebte. Das noch: Axel tauchte am nächsten Tag gleich wieder auf, umarmte mich zur Begrüßung – wir waren bereits beste Freunde, schließlich kannten wir uns seit über zehn Jahren … Soviel zum Heurigen, nur eine von ca. 1001 Geschichten.
Nein, ich will dir noch was erzählen von diesem speziellen Ort, z.B. von einem Pferd! Übrigens sehr schön, was du in deinem Brief über Pferde geschrieben hast … Unser Gastgarten wurde an einer Seite von der hohen Feuerwand des Nachbarhauses begrenzt, wir durften diese Wand kaum berühren. Eine Zeitlang hatten wir immer wieder einen Künstler zu Gast, der uns ziemlich auf die Nerven ging. Er wollte uns dazu überrede, dass wir ihm erlaubten, ein riesiges Pferd an die Wand zu malen.
Was die Wände im Schankraum betraf, wollte eine Künstlerin sie mit Bildern behängen. Sie bot uns eine Ausstellung an mit schmutzigbraunen und dreckigschwarzen Leinwänden, auf die jeweils ein Hundemaulkorb draufgenagelt war. Auch das lehnten wir freundlich, aber bestimmt ab.
Ein Bild jedoch hing sehr lange im Schankraum, d.h. es hängt heute noch dort, eines von Friedrich Karl Waechter, dem Zeichner und Autor, der Bücher mit so schönen Titeln veröffentlicht hat wie: Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein und Es lebe die Freiheit.
Ich habe F.K. Waechter in Salzburg kennengelernt, wo ich fünf Wochen in seiner Cartoon-Klasse auf der Sommerakademie war. Ich habe selten einen so fantasievollen, verspielten und humorvollen Menschen kennengelernt wie ihn. Ich muss jetzt daran denken, was du über Pferde geschrieben hast, genau das könnte ich auch über F.K. Waechter sagen, er war „verspielt, humorvoll, vielseitig interessiert und wach, und es machte mir viel Spaß, mit ihm zu sein und von ihm zu lernen.“ Er war auch bescheiden und zurückhaltend, sehr aufmerksam und taktvoll. Wir zeichneten und blödelten viel, machten diverse Spiele, gingen zusammen in die Disco, und wir durften ihn Fritz nennen. – Da muss ich gleich wieder an die Fliege Fritz denken … Auch F.K. Waechter ist inzwischen tot, er starb an Lungenkrebs, obwohl er nie geraucht hatte. Ein Thema, zu dem wir während der Sommerakademie etwas zeichnen sollten, lautete: „Hilfe, meine Liebste brennt!“ … Es gibt ein unglaublich trauriges Gedicht von seinem Freund Robert Gernhardt, das mit der Zeile beginnt: „Nie werde ich den sterbenden Fritz vergessen.“ Auch Gernhardt ist bereits tot. Jetzt aber zu dem Bild, das ich vorhin erwähnte. Wie gesagt, im Schankraum hängt ein großes Poster von Waechter, das mir meine Evi damals schön rahmen ließ. Es hängt dort seit ewig und zeigt ein kleines Mädchen zwischen zwei großen Katzen, hinter ihnen gähnt ein Abgrund, und über allem steht: „Ist das Leben, ist die Welt / nicht wie unten dargestellt? / Links ein Hund, rechts ein Hund, / vorn ein klaftertiefer Grund?“ In einer Sprechblase sagt das Mädchen: „Ja, so ist es“. Beim Heurigen herrscht Selbstbedienung, was das Essen anbelangt, d.h. bei Hochbetrieb bildete sich vor dem Buffet neben der Schank, wo ich mir die Getränke einschenkte, oft eine längere Schlange. Alle, die dort in der Schlange warteten, bis sie dran kamen, hatten Zeit, sich das Bild in Ruhe anzusehen. Für mich war es oft sehr interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagierten. Die Bandbreite reichte von stillem Lächeln bis empörtem Losschimpfen: „Das stimmt ja nicht! Das sind keine Hunde und der Abgrund ist hinten. So ein Blödsinn!“ – Ich liebte es.
Schluss damit, sonst ufert die Sache aus.
Liebe Marjana, ich habe das Gefühl, dich schon lange zu kennen, dich persönlich – Bücher hatte ich ja schon einige von dir gelesen.
Weil du gefragt hast: Ja, ich würde gern mit dir eine Zugfahrt in die Berge machen. In der Schweiz gibt es z.B. sehr schöne Zugstrecken …
Aber Berge mag ich eigentlich nicht! – Also vom Zug aus gesehen schon, oder vom Hubschrauber, aber sonst … Als ich das letzte Mal auf einem Berg war, hatte ich Todesangst, denn nach einer ungefähr vierstündigen Wanderung wurde diese plötzlich zu einem Alptraum für mich. Ich sage nur soviel: Herunter vom Berg kam ich mit einem Hubschrauber. – Das erzähle ich dir aber ein anderes Mal, im Moment will ich gar nicht daran denken, sonst wird mir schwindlig.
Was das von dir zitierte My name is Fred anbelangt: das ist mir an einem sonnigen Nachmittag in Marseille eingefallen, als ich in einem Café saß und unermüdlich in ein Notizheft kritzelte. Das Café hieß CAFE LE BABY FRED – in meinem Buch Marzipan aus Marseille kommt es vor.
Wo hast du deinen Brief geschrieben? – Ich habe diesen hier zumindest zum Teil an einem Holztisch auf einer Praterwiese geschrieben, d.h. skizziert, mit Aussicht auf herumtollende Hunde, Bier trinkende Menschen, die untergehende Sonne, die in Bau befindlichen Triple Tower …
Viele meiner Fragen aus dem vorigen Brief hätte ich mir sparen können, wenn ich Google gemacht hätte, um‘s elegant auszudrücken. Aber wenn man so ein altmodischer Schneckenpostler ist wie ich …
Schreibst du noch an wen handschriftliche Briefe? – Ich an meinen norddeutschen Freund Uwe und an meine Nichte Paula. Uwe ist über 60, wir schreiben uns handschriftlich schon seit ca. 30 Jahren, und Paula ist 12 und hat sich erst vor ca. eineinhalb Jahren einen „Briefkontackt“ mit mir gewünscht – ich muss gestehen, dass ich ihr zwischendurch auch immer wieder mal einen Brief auf dem Laptop schreibe, ausdrucke, in ein Kuvert stecke, zur Post trage … Weil sie jetzt am 4. Mai Geburtstag hat und weil ich vorhin von Cartoons geredet habe: Eins meiner kleinen Geburtstagsgeschenke ist ein Comic, den ich eigens für sie gemacht habe. Auf einem großen schwarzen Karton sind zwei kleine weiße Sprechblasen. In der einen steht: „Mach ja nicht das Licht an!“, in der anderen: „Ich denke gar nicht dran!“
„Die Welt der Düfte!“ – Corona wirkt sich negativ auf den Geruchs- und Geschmackssinn aus, wie man weiß. Ein Freund von mir hat nach einem schweren Unfall den Geruchssinn verloren, was ihn in eine unglaublich tiefe Krise gestürzt hat … Ich glaube, die Bedeutung des Geruchsinns wird ganz allgemein unterschätzt. – Was meinst du? Bitte entschuldige die läppische Frage.
Am Mittwoch waren wir wieder beim Balkon-Konzert von Ernst Molden, bereits zum dritten Mal. Er spielt immer am Sonntag und am Mittwoch, jeweils 18 Uhr, am Bass oft sein Sohn Karl. Diesmal spielte er ein Lied, das er für Martina Schmidt geschrieben hat (eben jene, siehe oben!). Molden sprach sehr schön über Martina, der er viel verdanke … Auch ich könnte ein Loblied auf sie singen, obwohl für mich schon nach zwei Büchern Schluss war beim Verlag. Trotzdem: Es waren die goldenen Zeiten! Seit längerem schon wollten Martina und ich wieder einmal zusammen ins legendäre Schwedenespresso gehen, aber es hat ja leider zu. Wie so viele Lokale. Wie alle! Wenn mir früher wer gesagt hätte, es kommt eine Zeit, da hat in ganz Wien und Österreich kein einziges Lokal offen, hätte ich ihm den Vogel gezeigt und ihn für verrückt erklärt. Nicht in meinen schlimmsten Alpträumen …
Was geht dir am meisten ab in dieser Coronazeit?
Und was sonst noch?
Mit Martina ins Schwedenespresso – darauf freue ich mich!
Vielleicht sollten wir zwei auch besser ins Schwedenespresso, als mit einem Zug in die Berge?
Ich werde dir vielleicht im nächsten Brief von diesem ganz speziellen Lokal erzählen, falls es dich interessiert.
Mich interessiert oft, wie andere arbeiten. Hast du fixe Schreibzeiten? Regelmäßig und kontinuierlich oder eher eruptiv und phasenweise?
Lieblingsschreibplatz, abgesehen vom Schreibtisch?
Dein schönster Geburtstag auf dem Filmgelände in Odessa, das klingt gut, obwohl … Hast du sehr darunter gelitten, Außenseiterin zu sein? Warum hattest du diesen Außenseiterstatuts, wie du schreibst?
Du warst acht oder neun, die ganze Klasse wurde von deiner Mutter ins Kino eingeladen … Als ich das las, musste ich sofort an eine Filmproduktion des vorigen Jahres denken: Stell dir vor, ein Kindergedicht von mir wurde verfilmt, und zwar von Kindern. Es gibt ein Berliner Projekt, das nennt sich “Kinder machen Kurzfilm”. Die Kinder einer Schulklasse bekommen Gedichte zur Auswahl für eine Verfilmung – zu meiner großen Überraschungsfreude fiel ihre Wahl auf mein urtrauriges Gedicht Ein trauriges Gedicht, in dem es um den Tod unserer ersten Katze geht, was damals eine Katastrophe war für unseren Sohn, der die Katze als “seinen Bruder” bezeichnete, und der immer wieder sagte, unsere Katze würde bestimmt viel älter werden als eine Katze normalerweise wird, weil sie es bei uns so gut hat – sie starb mit drei Jahren. Wir suchten einen schönen Platz für ihre Asche, wir fanden ihn inmitten von fünf Bäumchen, hier im Prater. Der Tod der Katze war wirklich eine Tragödie, vor allem natürlich für unser Kind. Einen Sommer lang fast jeden Abend Tränen … Jahre später habe ich ein Gedicht geschrieben über den Tod der Katze, und wieder ein paar Jahre später haben jetzt, also Ende 2019, Kinder in Schwedt (Uckermark) in einer Projektwoche mit vier Profis aus Berlin ein kleines Filmchen über das Gedicht gemacht. Ich war eingeladen zu Workshop, Lesung, Gespräch (die erste Frage an mich, von einem aufgeweckten 12-jährigen: “Wie viel verdienen Sie?”), also ich habe die Kinder ein bisschen kennengelernt – schön war das! Und kurz vor meinem Geburtstag, nein, kurz vor Weihnachten habe ich den fertigen Film bekommen, den ich jetzt auch dir zeigen will:
https://www.youtube.com/watch?v=zDCnk6PKRv0
Tote Katze, tote Fliege, toter Fritz, toter Robert, tote Hose, totes Versprechen … Ja, ich habe mein Versprechen gebrochen! Ich wollte dir doch diesmal einen kürzeren Brief schreiben. Von Goethe gibt’s was Schönes über lange und kurze Briefe – vielleicht finde ich’s wieder …
Alles Liebe Gute Schöne,
Christian
PS: Ich habe von dir geträumt! Es war ein sehr schöner Traum, aber der geht sich jetzt nicht mehr aus, das heißt … Nein, ich erzähle ihn dir im nächsten Brief, versprochen!
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Hansjörg Quaderer & Antonie Schneider
Brief 1: wir haben in kurzer vorkorrespondenz verschiedene felder berührt …
weiter ...schaan, 6. mai 2020
liebe antonie schneider,
wir haben in kurzer vorkorrespondenz verschiedene felder berührt.
die pandemie hat viele, insbesondere künstlerische freiberufler über das verschärfte prekariat hinaus in unmittelbare not gestürzt. die lohnarbeit ist weggebrochen.
zu sagen und zu tun gibt es immer. arbeit geht nicht aus, vieles gelingt sogar in grosser dringlichkeit besser. aber die lohnarbeit versiegt.
die arbeitsleistung lässt sich nicht mehr verdingen, bleibt einstweilen unvermittelbar, auch wortwörtlich, da keine bühne, keine plattform, kein öffentlicher raum zur verfügung steht.
die öffentlichkeit wurde bis auf weiteres reduziert bzw. plombiert:
machen „geisterspiele» in imaginären treibhäusern oder zirkuszelten sinn?
anders betrachtet: die formen der wirksamkeiten verändern sich, bei virulenter vorhandenheit der eigenen person, der es immer weniger gelingt, lebensmittel zu produzieren.
man lebt nicht von luftwurzeln, lebt nicht vom verschieben, sondern von 1 : 1 eingelöstem stoffwechsel.
es verhält sich paradox. wenn die gering vorhandenen reserven aufgebraucht, zahlt sich trotz gesteigerter produktivität
die präsenz nicht mehr aus.
ausgesetzt, ‚aussätzig‘ geworden, kommt man ‚in die sätze‘; beginnt, weiter zu denken.
es schmerzt, dass leute in sog. risikoberufen unverschuldet in existenzielle not geraten sind.
aber welche berufe sind keine risikoberufe?
welchen ausweg gibt es?
keine(r) der freiberufler gibt sich mit staatlichen almosen zufrieden.
wann, wenn nicht jetzt ist die zeit reif für ein bedingungsloses grundeinkommen?
ich gestehe, sehr privilegiert zu sein: meine lebensmittel verdiene ich durch verschiedene (noch krisenfeste) projektarbeiten oder ‚parallelaktionen‘ als ‚funktionär‘,
sporadische einkünfte durch ein buchantiquariat. bin dankbar, dass es so ist.
nüchtern beobachte ich: quarantäne ist künstlern und autoren kein fremdwort, es ist schlichtweg die arbeitsbedingung im atelier.
sich isolieren, sich zurückziehen, sich aussetzen in den engsten, eigenen kreis, zu sich kommen, bei sich sein, ist die voraussetzung aller kunst.
«… geh mit der kunst in deine allereigenste enge. und setze dich frei.» schreibt paul celan.
die kunst der engführung lernt man nie genug. wie vertraut auch immer man mit den stimmen in der kunst der fuge.
kunststück: zurückgeworfen auf sich selbst, blättert einer in höchsten realisationen, liest, schaut und hört dinge,
die eine/r liebt, die einem notwendig, wie das atmen.
das kosten von lebenselexier, die sehnsucht nach dingen, die einem heilig sind.
die rückkoppelung zu dem, was eine/r als wesentlich erkennt.
das eintreten in einen strom von selbstvergessenheit.
sich einschreiben, der spur folgen, die man selber wird.
der satz von edmond jabès, den sie als zusatz am schluss eines briefes hinschrieben, klingt nach.
ich wiederhole ihn: «als ich, noch kind, zum ersten mal meinen namen schrieb, war mir bewusst, dass ich ein buch begann…»
dem beginnen in der beginnlosigkeit bewusst werden. das aufgreifen von fäden, nachdenken, denken, was bei paul valéry ‚den faden verlieren‘ heisst.
den knoten sehen, in den einer selber geknüpft, die schlaufe, die einen fasst, das gewebe in dem man hineinverwoben.
ich meine, man wird porös und wach, im dialekt heisst es bei uns ‚pluug‘, was dünnhäutig, fragil oder geschwächt bedeutet,
ein unübersetzbares wort.
über das unübersetzbare beginne ich nachzudenken und mich in gedanken zu verlieren.
ich grüsse sie herzlich ins allgäu, hansjörg quaderer
Hansjörg Quaderer (* 1958), lebt als freischaffender Maler und Buchkünstler im liechtensteinischen Schaan. Mitherausgeber des Jahrbuches des Literaturhauses Liechtenstein, organisiert seit 2008 mit Mathias Ospelt die Liechtensteiner Literaturtage.
Seine Briefpartnerin Antonie Schneider (* 1953) ist freischaffende Autorin im Westallgäu und veröffentlicht neben Kinderbüchern auch Lyrik für Kinder und Erwachsene.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Yannic Han Biao Federer & Verena Rossbacher
Brief 3: Auf der Baustelle machen sie Fortschritte …
weiter ...Verena,
auf der Baustelle machen sie Fortschritte, am Hang steht jetzt eine Mauer, ziemlich hoch und geschwungen, wozu sie gut ist, weiß ich nicht, aber das macht nichts, sie ist trotzdem interessant anzuschauen. Davor sitzen gelbe Baufahrzeuge im Geröll, ein Radlader, ein Vorderkipper, ein Hydraulikbagger, ganz dicht beieinander sind sie geparkt, als hätten sie was zu tuscheln. Vor ihnen drei Arbeiter, einer steht in einem Erdloch, einer lehnt an einer der Maschinen, ein dritter stemmt sich eine Hand in die Hüfte. Schweigend essen sie Eis aus einem Hörnchen, sehen dabei nachdenklich zu Boden, es sieht nach Einkehr aus.
Wenn ich am Schreibtisch nicht weiterweiß, stehe ich auf, gehe hinüber und schaue ihnen zu. Ich fühle mich dem kriechenden Gerät manchmal sehr verbunden, gerade jetzt, da ich ein Kapitel umschreibe, das nicht funktionieren will, und nach und nach liebgewonnene Passagen tilgen muss, es traf mich, als ich den Hydraulikbagger sah, wie er sich die grobe Schaufel vom Arm streifte und eine Art Siebgerät an deren Stelle steckte. Dann begann er, Geröll aus einer Aufschüttung zu lösen, es dauerte, bis er eine feine, bräunliche Masse vor sich hatte, ordentlich schichtete er sie auf, seine metallenen Zacken strichen Muster hinein, zärtlich fast. Später bugsierte er die aussortierten Betonbrocken über das Gelände, schichtete auch sie zu kleinen, kunstvollen Haufen, am Abend dann hantierte er mit einer Art Schere, umfasste eines der Fragmente, immer fester, immer fester, bis es barst, ich schloss das Fenster, konnte es dennoch weiter knacken hören.
Entschuldige, ich weiß, du wolltest eigentlich nichts mehr von der Baustelle hören, weil du der Meinung warst, ich sei verrückt und wir müssten streiten, aber nachdem ich deine Mail gelesen hatte, musste ich erst einmal aufstehen, hinübergehen, den Maschinen zusehen, wie sie sich friedlich brummend ins Erdreich gruben.
Gut, okay, also erst einmal denke ich, dass wir nicht streiten müssen, dass niemand streiten muss, auch „die mündigen Bürger einer Demokratie“ müssen nicht streiten, vielmehr dürfen sie streiten, wenn sie es wollen oder wenn sie sich dazu genötigt sehen, aber sie müssen es ganz bestimmt nicht, weil das Müssen gegenüber der Politik auf ein Mindestmaß begrenzt zu sein hat, die Politisierung innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens ist für den Einzelnen Option, nicht Zwang, nur in autoritären und totalitären Systemen ist der Einzelne dazu angehalten, sein Tun und sein Lassen immer und jederzeit an den Sprechweisen und Sprachregelungen des Politischen zu messen.
Gut, okay, wir können also streiten, wenn wir wollen, aber ich weiß eigentlich nicht, ob ich das wirklich will, weil es mich doch wundert: so wenig Streit hattest du, dass du ihn jetzt suchen musst? Mich findet er ziemlich zuverlässig, eigentlich immer, hier schon wieder, und eigentlich kann ich ihn gerade gar nicht brauchen, weil ich eigentlich hier sitzen wollte und mich endlich wieder denken hören wollte, ich wollte endlich wieder einen klaren Gedanken fassen, zu mir kommen, zur Ruhe kommen.
Ich weiß nicht, wo du warst, aber da, wo ich war, ist der Streit nie fort gewesen. Er wütete wie eh und je, nein, er ist schlimmer geworden, weil das, was ihn schon zuvor mehr und mehr verschärft hatte, jetzt zur allumfassenden Voraussetzung geworden ist. Die physische Kopräsenz, die Hannah Arendt in ihrer allzu oft und immer zu unrecht belächelten Theorie des Politischen als grundlegende Bedingung frei handelnder, menschlicher Gemeinwesen erkannt hatte, ist jetzt noch viel weniger möglich, ist jetzt noch viel mehr auf ihre medialisierten Surrogate verwiesen, auf deren inhärente Dynamiken und Zurichtungen – und dabei vor allem auf die Lautstärke, die sich algorithmisch so gut macht, es ist wie bei Zoom, wer am lautesten ist, erscheint im Vollbild und bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ich kann nicht denken, wenn’s laut ist. Ich kann nicht lesen, wenn’s laut ist. Und schreiben kann ich dann auch nicht. Und wenn ich sofort etwas sagen soll, sofort etwas meinen soll, mit herummeinen soll, bin ich so hilflos wie alle, die gerade versuchen, mit Sinn und Verstand auf ein klitzekleines Wesen, nein, Ding zu reagieren, das wir uns von Atemweg zu Atemweg zuhauchen, bis wir irgendwann, vielleicht, durchseucht sind, immun sind, oder auch nicht.
Um anders zu sprechen, braucht es Zeit. Sonst spreche ich wie alle. Und alle gibt es ja schon. Die können selber sprechen. Dafür brauchen sie mich nicht.
Oder ist dir jeder Versuch des Schauenlernens, des Hinhörens, alle Desautomatisierung von Wahrnehmung und Sprache, schon wertlos geworden, nichts als „harmlose, poetische Betrachtung[]“? Müssen wir jetzt alle diskursiv mobil machen, eine virologische Komplettexpertise behaupten, über die wir unmöglich verfügen können, nur um irgendwen als Insgebüschspringer zu geißeln? Als „Verrückte“? (Übrigens ist die rhetorische Pathologisierung des angenommenen Diskursgegners, da du ja selbst die deutsche und österreichische Geschichte erwähntest, eine eher belastete Tradition.)
Es ist ein Missverständnis, den demokratischen Diskurs mit chorischem Bekenntniszwang zu verwechseln, Chor und Gegenchor, bist du für uns, bist du gegen uns. Es gibt sie, die Orte, an denen gestritten wird, und es soll noch Orte geben, an denen man diskutiert, statt zu streiten. Und es ist gut, dass dem so ist, und es ist gut, dass dort jede und jeder im Takt der Ticker Position beziehen kann. Aber es gibt auch andere Orte. Sie mögen sich seltener äußern, langsamer auch. Sie mögen leiser sein. Und von einigen mögen sie deshalb als harmlos verspottet werden.
Aber sie sind es, die noch da sind, wenn das Licht einmal aus ist.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Quelle: literatur:vorarlberg netzwerk
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 9: Zunächst einmal bin ich natürlich ganz bei dir …
weiter ...Liebe Roberta!
Zunächst einmal bin ich natürlich ganz bei dir: Spekulationen sind das, was sie sind, nämlich nichts als Mutmaßungen, Gedankenspielereien mit unabsehbaren Folgen. Vielmehr ging es mir darum, dass ich bei uns einen offenen Diskurs vermisse, auch einen Dissens, eine Meinungspluralität, hier, in diesem nicht zuletzt durch Einwanderung und ethnische Diversität geprägten und folglich an Kultur- und Denkweisen eigentlich so vielfältigen Land. Alle haben – was anfangs sicher ein Gebot der Stunde war – sprichwörtlich an einem Strang gezogen. Und zugegeben: Der politische Konsens über Parteigrenzen hinweg war für den Moment sogar eine gewisse Wohltat, eine Politik, augenscheinlich bar jeder Verdunkelungstaktik und fernab jenes noch fast jede Aussage verweigernden Enthaltungsmusters, das mir immer mehr als das Hauptparadigma in unserer politischen Landschaft erscheint.
Aber Umsicht bedeutet nicht nur, vernünftige Entscheidungen zu treffen (und sie mussten rasch getroffen werden), sondern sie auch mit derselben Vernunft zu kommunizieren. Vielleicht hätte in dieser Hinsicht die öffentliche Verlautbarung durch unabhängige Experten und Expertinnen dem Eindruck vorgebeugt, es handle sich ein wenig um eine Inszenierung, um ein effektvolles Stagediving im potenziellen Wählerauditorium. Der gegenwärtige Seniorpartner der Regierung kratzt immerhin laut aktuellen Meinungsumfragen an der Absoluten, eine Partei, pardon, Bewegung, die – wie gesehen – keine Skrupel hat, zum Machtgewinn eine Koalition mit den Rechtsrechten einzugehen. Ähnlich exponentiell, wie die Infiziertenzahlen anfänglich gestiegen sind, nahmen auch die Maßnahmen zu, und dies kommunikativ in einer, wie ich finde, immer weniger temperierten, nur bedingt kalmierenden Art und Weise. Angst als Motor. Und die Wesensverwandtschaft zum Schrecken, also Terror, ist eine ersten Grades. Dramatik und Fatalismus haben sich mit jedem Mal verstärkt. Dass diese Vorgehensweise Spekulationen befeuert, finde ich nur mäßig überraschend.
Und ja, es ist ein Privileg, diese Dinge aussprechen zu dürfen, obwohl: Die Zeiten können sich schnell ändern. Presse- und Meinungsfreiheit kann auch einfach dahingehend ausgelegt werden, dass – so wie es beispielsweise unser ehemaliger Innenminister empfohlen hat – kritische Medien möglichst frei von einer Meinung bleiben sollen, indem sie einfach nur noch über das Nötigste vonseiten der Polizei informiert werden, von den direkten und nicht gerade wenigen Anfeindungen bestimmter namhafter Journalisten ganz zu schweigen. Da nimmt es auch nicht Wunder, dass Österreich im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen weiter Plätze eingebüßt hat.
Aber was soll man in diesem Zusammenhang bloß zu Ungarn sagen? Eigentlich verschlägt es einem ja die Sprache. Und erst zur Europäischen Union. Euphemistisch gesprochen führt sie sich selbst ad absurdum. Weniger beschönigend ausgedrückt hat sie vielleicht ihr letztes Quäntchen Glaubwürdigkeit eingebüßt. Denn nach wie vor ist die EU in ihrer Grundintention ein Friedensprojekt, wenn auch – führt man sich die Urinstitution der EGKS vor Augen – eines, das auf ökonomischen Ideen fußt. Aber Friede existiert nur, wo es Freiheit gibt. Alles andere ist ein diktierter Scheinfrieden. Das – wenn auch unter Vorbehalt – große Schweigen der Europäischen Union macht sprachlos. Der Eindruck, dass sie die Ouvertüre zum eigenen Abschiedsoratorium angestimmt hat, ist ein tiefgreifender.
Überall grünt und sprießt und farnt es. Beinahe getraut man sich schon nicht mehr, die Natur schreibend zu betrachten, mit ihr auf diese Weise in Kontakt zu treten, ohne Gefahr zu laufen, als Adept eines verklärenden Romantizismus gestempelt zu werden. Etwas zu sagen von Relevanz, darum muss es gehen, darum muss sich ja alles drehen. Und doch: Ist es für die Begegnung mit der gegenwärtigen Zeit(enwende) nicht auch vorteilhaft, das ruhige und ruhende Auge auf dem scheinbar Unwesentlichen zu schulen? – Das gravitätische Wiegen der Baumkronen im Wind. Der Fluss mit seinem Schwemmholz uferlang. Das Sekundenticken der Uhr, das unaufgeregte Sekundenkreisen auf dem Ziffernblatt einer Bahnhofsuhr.
Es grüßt dich herzlich,
Christoph
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Yannic Han Biao Federer & Verena Rossbacher
Brief 2: Was soll ich sagen …
weiter ...Tja, lieber Yannic.
Was soll ich sagen. Jetzt habe ich ewig gebraucht für die Antwort auf deinen ersten Brief, ehrlich gesagt, weil ich diverse Entwürfe jeweils wieder verworfen habe. Ich finde es derzeit nicht so einfach, Briefe zu schreiben – wiewohl ich normalerweise außerordentlich gerne Briefe schreibe, Briefe schreiben ist total herrlich und für Autoren ja recht eigentlich ein eins-a Spielplatz, du weißt schon, einer von denen mit Seilbahn und allem.
Und jetzt quäle ich mich damit herum und muss feststellen: Ich habe jede Leichtigkeit verloren, Spielplätze waren früher irgendwie anders, besser halt, die Schaukeln reißen mich nicht mehr vom Hocker, rutschen, ich weiß auch nicht, und die Seilbahn, naja. Anstatt alles unglaublich aufregend zu finden und mich lustig ins Getümmel zu stürzen, sitze ich blöd auf der Bank und grüble. Nur Langweiler sitzen auf Spielplätzen auf der Bank, darüber sind wir uns ja wohl einig, und plötzlich finde ich mich mitten unter ihnen und: Kann auf deine Spielangebote nicht mehr eingehen.
Worüber ich grüble? Ich bin so hin und her gerissen. Ich befinde mich nachgerade in einem Dilemma: Wir kennen uns nicht, du und ich, wir sind ganz zufällig zu Briefpartnern geworden und unter normalen Umständen, sprich, in Non-Corona-Zeiten, würden wir uns einander höflich und gemächlich annähern (um auf dem Spielplatz zu bleiben: Erst mal nur harmlos nebeneinander her sändeln), wir würden umsichtig abtätscheln, wo der andere eigentlich steht (backt er Kuchen oder arbeitet er an einer regelrechten Burganlage?), wie er so tickt (Matsch oder Trockenmasse), vielleicht also würden wir über Bücher sprechen, über Hobbys, über die bezaubernde Luzidität junger Buchenblätter. Ich spreche rasend gerne über Bücher und Buchen, und Hobbys sind eh super, zum Beispiel gehe ich seit Jahren joggen (wir kommen noch darauf).
In diesen Zeiten aber ist das anders. Ich fürchte, gerade müssen wir uns ein paar Manierlichkeiten schenken und ein bisschen miteinander streiten.
Warum in aller Welt?!, denkst du jetzt vielleicht entgeistert, was hab ich der fremden Frau getan? Ich schreib der ein paar harmlose, poetische Betrachtungen, Eiskugeln, Bagger, da kann man doch prima drauf aufbauen, aber nein, die macht gleich ein Fass auf?
Du hast vollkommen Recht. Eiskugeln und Bagger wären ja quasi das Sandförmchen, das du mir reichst, das Schäufelchen zum gemeinsamen, einträchtigen Schaufeln.
Jetzt aber sitze ich auf der Bank und denke: Ich habe keine Zeit fürs Sändeln und Rutschen – übrigens absolut nicht, weil Rutschen kindisch wäre, Autoren finden kindische Sachen schön, ich finde kindische Sachen schön, ich bin immer gerne gerutscht und ich wünsche mir nichts mehr, als bald wieder nur noch rutschen zu können, Rutschen ist groß.
Aber gerade denke ich, wir können nicht rutschen, wir müssen streiten, weil zu wenig gestritten wurde, in einer Sache, in der der Streit unabdingbar gewesen wäre und dringend nötig, von Anfang an. Er wäre in der Politik dringend nötig gewesen, aber die Opposition hatte den Betrieb eingestellt. Er wäre in den Medien dringend nötig gewesen, aber der kritische Diskurs fiel schlicht und einfach aus, und nicht nur das: Kritik galt ab sofort als Verschwörungstheorie. Er wäre in persönlichen Beziehungen dringend nötig gewesen, aber jeder zog sich in seine Privatsphäre zurück. Er wäre unter Intellektuellen, Autoren und Künstlern dringend nötig gewesen, aber wir haben zu lange geschwiegen. Er wäre dringend nötig gewesen, in allem, und er wäre in einer funktionierenden Demokratie vollkommen normal und selbstverständlich. Diesen Total-Ausfall halte ich für derart dramatisch, dass ich dir gar nicht sagen kann, wie sehr er mich erschüttert. Er erschüttert mich derart, dass ich keine Freude mehr habe am Spielen. Da du ja selbst weißt, wie wichtig das Spielen ist, ahnst du vielleicht, wie es mir gerade geht. Und wie sehr es mir fehlt.
Und darum finde ich: Zumindest wir, du und ich, sollten miteinander streiten, wie es unter mündigen Bürgern einer Demokratie angemessen ist.
Das ist also mein Dilemma. Ich möchte sehr nett zu dir sein, wie ich zu Fremden, die vielleicht zu Freunden werden könnten, gerne nett bin. Aber ich muss mit dir streiten, vielleicht, weil ich hoffe, dass wir dadurch Freunde werden könnten. Denn daran, soviel wage ich jetzt schon zu sagen, daran wird sich in Zukunft Freundschaft messen lassen müssen: Wie wir in dieser Sache denken, um was wir gestritten haben, was verhandelt und gefordert und wie gehandelt.
Reden wir darum über Hobbys. Stichwort Jogger.
Die Leute also, um die du so sorgfältige Bögen machst, denen du so großflächig aus dem Weg gehst, lachen oder schauen dich an wie ein Ungeheuer? Als wärst du, bringen wir es auf den Punkt, verrückt? Nun ja – es ist auch verrückt. Ich gehe selbst spazieren und Leute bleiben stehen, um mich vorbei zu lassen, ich gehe joggen (Hobby) und Leute flüchten sich ins nächste Gebüsch, und ich denke mir: Das sind Verrückte. Noch ein paar mehr, die sich ins Gestrüpp stürzen und sich an Mauern drücken, wenn ich nahe, und ich muss ein paar Scheibenwischer vor dem Gesicht machen, derart verrückt ist es.
Schau. Du wirst – und wenn du dich auf den Kopf stellst – beim Vorbeigehen niemanden, wirklich absolut niemanden anstecken. Du wirst auch nicht angesteckt werden. Es ist nicht möglich. Außer du – und ich unterstelle dir freundlich, dass du das auch vor diesem fahrlässigen und sinnlosen, kosmischen Debakel, in dem wir uns nun befinden, nicht getan hast – außer du bist hochinfektiös, also hustend und prustend und nicht nur das, du hustest und prustest deinen Weggefährten aus nächster Nähe ins Gesicht. Mir persönlich ist das noch nie passiert, ich persönlich habe das noch nie gemacht, ich persönlich kenne niemanden, der das je gemacht hat und auch du wirst, so sehe ich persönlich das, das nie gemacht haben.
Interessant ist zweierlei: Du findest das Verhalten der Frau als auch des Joggers merkwürdig. Warum findest du dein Verhalten nicht merkwürdig? Weil die Regierung sagt, dass man sich so verhalten soll? Also gut, die Regierung sagt, wir sollen uns so verhalten. Heißt das automatisch, dass es richtig, dass es sinnvoll ist? Nein, das heißt es nicht. Wenn wir etwas lernen müssen in diesen aufgebrachten Zeiten, dann dies: Wir müssen uns selber darüber informieren, was richtig ist und was falsch. Da die Massenmedien nach Wochen erst – nach Wochen! – sich irgendwie daran erinnern, was eigentlich ihr Job wäre, nämlich ein breites, vielfältiges und durchaus widersprüchliches Bild der Lage zur Verfügung zu stellen, auf dass wir Bürger uns eine eigene Meinung bilden können, kommt man nicht umhin, mal bei den sogenannten Verschwörungstheoretikern vorbei zu schauen. Interessanterweise waren diese Verschwörungstheoretiker vor diesem Desaster mitnichten Verschwörungstheoretiker, nein, es waren – und es sind -, namhafte Wissenschaftler (Prof. Dr. Bhakdi, Prof. Dr. Ioannidis, Prof. Mölling, um nur einige wenige zu nennen) – oft namhafter und erfahrener, wohlgemerkt, als die paar Experten, sprich: Virologen, die den derzeitigen Diskurs bestimmten. Und sie sagen andere Dinge, als ein Christian Drosten uns sagt und eine Angie Merkel. Und plötzlich gerät die scheinbare „Alternativlosigkeit“, die gerne ins Feld geführt wird, ins Wanken. Stimmt das eigentlich, was da gesagt wird? Diese Frage muss man sich stellen, und man hätte sie von Anfang an stellen müssen. Nein, nicht man: Wir.
Das mit dem Leute-Umrunden und Aus-dem-Weg gehen stimmt jedenfalls nicht. Es ist ein Mythos. Du wirst nirgends, von keinem Experten, irgendeinen Beleg dafür finden, dass sich beim Vorbeigehen Leute anstecken. Es ist reines Placebo. Es ist verrückt.
Das Zweite, was ich interessant finde, ist, dass ich mich frage: Welches Verhalten der Frau und des Joggers fändest du denn angemessen?
Wie gesagt, ich spaziere und jogge ja auch mal gerne und werde von Leuten im großen Stil umrundet, als hätte ich – jaha!: Als hätte ich die Pest (nur, damit wir uns mal wieder die Verhältnismäßigkeit des Ganzen klar machen). Ausdruckslos schaue ich sie an – ausdruckslos, weil, ich erwähnte es, ich muss mich sehr zusammenreißen, nicht wischi-waschi vor dem Gesicht zu machen, ausdruckslos ist das absolute Maximum an Höflichkeit, was ich zustande bringe – und wie schauen die Leute zurück? Ich würde sagen: Irgendwie beleidigt, gekränkt regelrecht, bis hin zu: aufgebracht.
Was wollen diese Menschen? Was willst du?
Sollen wir euch dankbar zulächeln? Quasi der wandelnde Daumen-Hoch? Falls ja (ich unterstelle das jetzt einfach, irre unfair, wie das halt so ist, wenn man sich ein bisschen streitet, ich werde mich SOFORT entschuldigen, wenn ich dir Unrecht getan haben sollte!), also, falls ja: Warum? Wollt ihr Anerkennung für euer Wohlverhalten? Warum? Hier werden „keine Artigkeitsnoten verteilt“, wie Christian Lindner (eigentlich not my favorit, ich schwöre, aber gerade wird ja das Unterste zuoberst gewurlt) das in der Bundestagsdebatte ziemlich treffend auf den Punkt brachte.
Klar, ich versteh schon: Jeder Schüler mag gerne vom Lehrer gelobt werden. Es kann der letzte Blödsinn sein, was der Lehrer da verzapft, aber wenn er mich mit Lob belohnt, lerne ich es, ohne nach dem Sinn des ganzen Krams zu fragen. Das ist das Perfide. Wenn einer geschickt ist darin, dich aufzubauen und dir ein gutes Gefühl zu geben, hat er dich in der Tasche. Du wirst dann blind auch das Falsche tun, weil es gut tut, wertgeschätzt zu werden.
Und was haben wir derzeit? Alle klopfen sich wohlwollend auf die Schulter dafür, dass sie sich brav an die Regeln halten (#stayathome, #flatttenthecurve und Nicht-ohne-meine-Maske – was da halt so an coolen Mit-Mach-Spielchen durch die Netzwerke geistert), es ist, nicht zuletzt, gemeinschaftsbildend. Aber dieser Aktionismus verhindert auch, dass wir uns ganz grundsätzlich und angstfrei fragen: Was an dieser Geschichte stimmt eigentlich? Wo ist bei dieser Sache die gesunde Skepsis, die bei wichtigen Entscheidungen immer angebracht ist – und doch erst recht, wenn es um so viel geht? Was wären mögliche Alternativen? Zu denken und zu handeln? Ich finde es höchst merkwürdig, dass diese Skepsis und diese Fragen ausblieben – sie sind was ganz Normales und Wichtiges, sie dienen als Regulans.
Ich meine, es ist angebracht, sich spätestens jetzt von dieser Art der Wohlgefälligkeit zu lösen. Dass eine Mehrheit etwas genau so für richtig hält und das auch nicht diskutieren möchte, hat noch nie geheißen, dass es auch das Richtige ist. Wir in Deutschland und Österreich sollten das sehr gut wissen.
Ich bin als Kritikerin nicht in der Bringschuld, es bin nicht ich, die etwas beweisen muss. Die Regierungen, die Staaten, haben eine ungeheure Entscheidung getroffen, die ungeheure Folgen hat und noch lange haben wird, und sie sollten sehr, sehr gut beweisen, dass es richtig war. Dass es nötig war. Denn „Alternativlos“, sagt Juli Zeh zu dieser Sache, „ist ein anderer Begriff für „Keine Widerrede!“ und damit ein absolut undemokratisches Konzept.“
Schau, ich streit hier alleine mit dir herum, dabei bist du vielleicht (wahrscheinlich, ziemlich sicher, also auf gar keinen Fall) auf Streit aus. Vermutlich tue ich dir, wie‘s beim Streiten halt so geht, gnadenlos unrecht, vermutlich vertu ich mich im Ton, vermutlich irre ich mich in allem Möglichen. Verzeih mir, falls dem so ist. Gerade muss ich ein bisschen auf der Bank am Spielplatz sitzen und habe keine Lust zu spielen. Es ist so nett von dir, dass du vorbei kommst und mir deine Spielgeräte anbietest und dass ich zuerst auf die Seilbahn darf, unter allen anderen Umständen hätten wir einen grandiosen Tag mit Spielplatzfreuden verbracht und wären abends müde aber glücklich nach Hause gekommen: Wieder ein durch und durch gelungener Autorentag. Aber weißt du: Ich denke, wir sollten alle miteinander aus der Deckung kommen. Lieber ist es mir, dass wir uns lauthals verrennen und uns dann entschuldigen müssen dafür, als zu Unrecht zu schweigen. Gerade passiert viel Unrecht. Magst du dich zu mir auf die Bank setzen und ein bisschen streiten?
Ich möchte nicht von mir sagen müssen, ich hätte von nichts gewusst.
Soweit.
Herzliche Grüße,
Verena
Verena Rossbacher (* 1979), aufgewachsen in der Schweiz und Österreich, lebt als Schriftstellerin in Berlin. Zuletzt bei Kiepenheuer & Witsch erschienen: «Ich war ein Diener im Hause Hobbs» (2018).
Ihr Briefpartner ist der in Köln lebende Autor Yannic Han Biao Federer (* 1986).
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 2: Dein Brief ist wunderbar …
weiter ...Lieber Christian Futscher,
dein Brief ist wunderbar. Ich danke dir! Auch ich habe einige deiner Bücher in meiner Bibliothek. Weißt du, welches ich ganz besonders liebe? – „Farblose Witze“. Es liegt gerade vor mir. Auf der ersten Seite steht:
My name ist Fred
I´m not afraid of being dead.
Diese Worte entstammen dem Schnabel eines auf einer Landstraße stehenden Hahns. Er scheint zu lächeln, auf jeden Fall bestens gelaunt zu sein, und das, obwohl sein Federkleid ramponiert ist. Im Hintergrund sieht man einen sich entfernenden Geländewagen. Vor zehn Jahren, als dein kleines Bilderbuch erschien, fand ich diesen Fred einfach nur lustig. Je länger ich ihn aber jetzt betrachte, umso mehr Zweifel kommen in mir auf, was die Form betrifft, in der sich dieser Vogel befindet. Wurde er, da überall Federn herumliegen, vom Geländewagen angefahren und ist doch durch ein Wunder am Leben geblieben? Oder ist er bereits tot und steht als Geist mitten auf der Landstraße? Neulich habe ich in Tschechows Erzählung „Das Drama auf der Jagd“ folgende Zeilen entdeckt:
„Psychiater berichten von einem Soldaten, der bei Waterloo verwundet wurde, den Verstand verlor und später jedem versicherte und selbst daran glaubte, dass er bei Waterloo gefallen sei und dass das, was man jetzt für ihn halte, nur sein Schatten sei, eine Widerspiegelung der Vergangenheit.“
Noch eine Option, um auf den Fred zurückzukommen.
In deinem Brief wirkst du sehr dynamisch auf mich, das ist kein Kompliment, bloß eine Feststellung. Ich frage mich, wie es wäre, dir gegenüber in einem Zugabteil zu sitzen. Würdest du viel reden, oder würdest du schweigend aus dem Fenster schauen? Hoffentlich lernen wir uns mal kennen, z. B. auf einer Zugfahrt in die Berge. Was meinst du, lieber Christian Futscher? Magst du Berge?
Du fragst mich nach meinem Corona-Alltag. Es hat sich wirklich wenig verändert, außer dass ich noch zurückgezogener lebe als zuvor. Tagsüber schreibe ich an meinem Buch (es geht um die Welt der Düfte), abends bin ich im Stall bei meinen Pferden (ja, das stimmt). Sie sind verspielt, humorvoll, vielseitig interessiert und wach, und es macht mir viel Spaß, mit ihnen zu sein und von ihnen zu lernen. Das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren von meinen Pferden gelernt habe, ist Taktgefühl. Zu meinen Lieblingsbüchern gehören u.a.: Aus dem Leben eines Taugenichts von Joseph von Eichendorff,Utz von Bruce Chatwin, Glut von Sandor Marai, Rot und Schwarz von Stendhal, Ein gewisses Lächeln von Françoise Sagan sowie Aus dem Tagebuch von Witold Gombrowicz. Momentan lese ich Der geträumte Duft von Jean-Claude Ellena. Einen runden Geburtstag habe ich erst in zwei Jahren. Mein schönster Geburtstag ist schon etwas länger her. Ich muss acht oder neun geworden sein. Es war eine große Party, die ich meiner Mutter zu verdanken habe. Damals arbeitete sie im Filmstudio von Odessa und lud meine gesamte Schulklasse zu einer Zeichentrickaufführung in einem der Kinosäle auf dem Gelände des Filmstudios ein. Am Ausgang gab es eine Schachtel Konfekt für jedes Kind. Bemerkenswert: Trotz dieser legendären Einladung änderte sich an meinem Außenseiterstatus in der Klasse nichts. Ob ich gern reise? Oh ja! Meine Reisen waren bisher Bildungs-, Lese- oder Vergnügungsreisen und meistens kurz. Und dein Brief war genau richtig. Ich freue mich auf deinen nächsten.
Herzlichst
Marjana
Marjana Gaponenko (* 1981) lebt nach Stationen in Odessa, Krakau und Dublin heute in Mainz und Wien. Sie schreibt seit ihrem sechzehnten Lebensjahr auf Deutsch. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis und dem Martha-Saalfeld-Förderpreis ausgezeichnet.
Ihr Briefpartner Christian Futscher (* 1960), Autor von Lyrik, Hörspielen und Prosatexten, lebt seit den späten 1980er-Jahren in Wien.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Peter Gilgen & Gabriele Bösch
Brief 2: Es ist schön …
weiter ...Lieber Peter,
es ist schön, in diesen Zeiten ein Du geschenkt zu bekommen. Dieses Du ist mir wie eine Biene auf dem leuchtenden Löwenzahn, der jetzt zu verblühen beginnt. Bienen sind kostbar geworden. Ich habe heute gelesen, dass diese weltweiten Shutdowns den Transport der Bienenvölker zwischen den Ländern verhindern. Ein Bild aus China kommt mir in den Sinn: Menschen in weißen Schutzanzügen bestäuben die Blüten der Bäume von Hand. Menschen in weißen Schutzanzügen sind es auch, die jetzt andere Menschen untersuchen, behandeln und heilen. Die beiden Bilder überlappen sich in meinem Kopf und werden eins.
Dein Du ist mir auch ein neuer Weg unter Wegen, deren wenige private oder kulturelle, die ich in der materiellen Welt noch zu gehen pflegte, man mir nun mit dem Shutdown genommen hat. Ich vermisse das Lachen in einer Theatervorstellung, das durch Betroffenheit ausgelöste Schweigen, das Verbindende in der Trennung, sich einmal jenen und dann wieder anderen zugehörig zu fühlen.
Ich vermisse die Umarmungen meiner Freunde. Die seltenen Momente, in denen ich einen von ihnen treffe, weil ich etwas vorbeibringen muss, stehen wir maskiert vor der Haustüre, lächeln uns beschämt zu und halten zwei Meter Abstand voneinander, weil dies das Maß ist, das die mit 40 kmh vorbeifahrende Polizei vom Auto aus als tolerierbar diagnostiziert. Die Strafen, von oben verordnet, sind drakonisch. Ob es hier, im Weg unseres Briefeschreibens, auch eine Selbstverordnung zur Maskenpflicht und zum Abstandhalten geben wird, da wir wissen, dass unsere Briefe veröffentlicht werden?
Das ist eine Frage, die ich mir seit Zusage zu diesem Projekt „Cara Roberta“ stelle. Ergo habe ich für mich beschlossen, meine persönlichen Zusagen, Absagen, mein Versagen auch, das viele Nicht-Sagen und das Einsagen von außen durch kolportierte Bilder zu beschreiben. Ich kann dir nämlich nicht viel von draußen berichten, da ich nicht viel unterwegs bin. Ich sitze in diesem Moment auf dem Balkon und blicke in den Garten. Der Flieder blüht, der Schneeball auch, und bald werde ich Holdersaft ansetzen. Es duftet in konzertierten Nuancen und die Tastatur ist voller Blütenstaub. Im Hühnerstall gibt es nun jeden Tag ein Ei zu ernten und das neue alte Hochbeet ist vorbereitet für die Anbausaison. In den letzten Wochen habe ich oft gedacht, dass wir gesegnet seien. Mit eigenen Walnüssen und Bärlauch vor der Haustüre, mit eingekochten Beeren und anderem Allerlei vom letzten Jahr lässt es sich sehr lange überleben. Diese (natürlich nicht allumfassende) Selbstversorgung ist mir seit Tschernobyl ein Anliegen gewesen. Damals war mein erster Sohn ein Jahr alt und ich habe die ersten Hamsterkäufe meines Lebens erlebt. Aber das weißt du ja, ich habe das an anderer Stelle schon beschrieben. Aber wusstest Du, dass es dort jetzt schon so lange brennt? Auch diesbezüglich überlagern sich Bilder in meinem Kopf. Wir haben in 34 Jahren nichts gelernt. Also schaue ich an diesem Sonntag in den Garten, höre die Vögel singen, sehe dem Spatz zu, der an einem Eck des Hochbeetes landet, die Kante entlang hüpft, was nicht unkompliziert ist für ihn, sehe, wie er auf die frische Erde kackt und davonfliegt. Eine kleine Selbstverständlichkeit wird zu einer Koordinate auf meiner Sicherheitskarte. Mao hat einst eine Hungerkatastrophe ausgelöst durch die Vernichtung der Vögel.
Zurück zu den Wegen. Die beruflichen Wege gehe ich seit vier Jahren auf drei Beinen.
Ein Bein heißt Altenbetreuung; an einer momentan wechselnden Zahl von Tagen in der Woche betreue ich eine alte Dame, die an Demenz leidet. Sie wird heuer neunzig. Die Tage mit ihr sind fallweise zeitlos. Wir machen alles, was wir machen, in einer Langsamkeit, die mich wohl allmählich zu prägen beginnt.
Ein Bein heißt nach wie vor Literatur. Es gibt zwei Projekte, die wohl noch länger nicht abgeschlossen sind, aber ich habe auch hier keine Eile. Auch die Pausen zwischen den Sätzen meiner alten Dame prägen allmählich meinen Umgang mit Sprache und deren Inhalt. Ich nehme diesbezüglich einen Kredit auf die Zukunft. Nicht alles muss jetzt veröffentlicht werden.
Das dritte Bein ist meine Arbeit im Atelier, das ich in Lustenau (der Nachbargemeinde von Hohenems) habe. Dort zeichne ich mit Tinte und Feder die Muster der Lebendigkeit des Lebens so wie ich sie verstehe. Es ist wohl ebenso ein Schweigen wie die intensivsten Momente mit meiner alten Dame ein Schweigen im Schweigen sind. Eine Form von Gebet. Eine stille Liebe.
Alle drei meiner Beine fußen auf einer Einsamkeit, die ich selbst gewählt habe. Doch zunehmend mit der Zeit im Shutdown ist mir, als hätte man mir eine verordnete Einsamkeit über die schon vorhandene selbstgewählte gestülpt. Die Wörter verhallten in dieser Isolierschicht dazwischen, die Zeichen, die meine Hand mit der Feder auf das Papier brachte, waren nicht mehr jene, die sie sein wollten. Ich habe nicht mehr geschrieben und habe aufgehört ins Atelier zu gehen, in welchem ich zuvor intensiv für eine Ausstellung im Herbst gearbeitet hatte. Doch jetzt gibt es da ein Du am anderen Ende der Welt, und ich freue mich, dass wir uns direkt schreiben und nicht nur unsere Texte, verfasst zu einem bestimmten Thema, in einem Band nebeneinandergestellt, lesen.
Dein Du ist mir übrigens auch wie die Auferstehung der Küchenuhr, die ich vor sechs Wochen abgehängt hatte. Ich habe die Zeit zwischen der Zeit verloren. Die Zeit ist an den Wechsel von Licht und Dunkelheit gebunden. Ich schlafe jetzt mehr als all die Jahre zuvor. Tagsüber wäre die Zeit an die vielen kleinen Wege meiner Finger gebunden. Im Nichtstun gibt es keine Orientierung. Das Denken kreist. Jetzt wird das Du zum heilenden Auftrag und ich danke dafür.
Dabei hatte alles anders angefangen. Das erste Bild, das ich mit dieser weltweiten Krise verbinde, ist wieder eines aus China. Eine leere Stadt. Die Menschen sitzen in ihren Wohnungen, die Stadt ist in Viertel eingeteilt. Eine App sagt dir, ob du die Wohnung verlassen darfst, in welches Viertel du gehen darfst und in welches nicht. Ein App sagt dir auch, ob dein Nachbar infiziert ist oder nicht. Überwachung von oben. Überwachung auf Augenhöhe. Überwachung von innen, weil du ständig Fieber misst. Das hat mir Angst gemacht, mehr als das Virus. Irgendwo habe ich gelesen, wenn man den Menschen Freiheit und Gesundheit zur Wahl stellte, würden sie sich für Gesundheit entscheiden.
Damals war China noch weit weg. Wir schrieben den 11. März. Ich war schon zwei Wochen vorher in keiner Art von Öffentlichkeit mehr gewesen, um meine alte Dame nicht unwissentlich anzustecken.
Einen Tag später telefonierte ich mit meiner Tochter in Lissabon. Sie macht dort im Erasmusprogramm ein Auslandssemester. Sie sprach davon, dass man munkle, dass es bald einen Lockdown gäbe. (Ich musste das Wort erst nachschlagen. Zum ersten Mal im Leben bedauerte ich, keinen Fernseher zu besitzen.) Ich hörte sie am Telefon husten, sie hatte die letzten zwei Wochen eine Grippe gehabt. Zum ersten Mal machte ich mir Sorgen.
Am 16. März kam dieser Lockdown. Ich weiß noch, wie ich den Arbeitsvertrag und den Mietvertrag für das Atelier ins Handschuhfach des Autos legte. Als ich an diesem Abend, es war schon dunkel, von meiner alten Dame nach Hause fuhr, waren nur fünf Autos auf der Rheintalautobahn unterwegs. Alle fuhren hintereinander mit nur 100 kmh. Keiner überholte. Es war, als wollten wir uns alle nicht gerne aus der Sicht verlieren. Als ich von der Autobahn abfuhr und bei der ersten Ampel hielt, fragte ich mich, wieso ich das tat. Kein Mensch, kein anderes Auto war zu sehen. Das war höchst seltsam. Ich dachte daran, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen meine Arbeit noch hatte, dass ich mich noch bewegen durfte, dass ich fast keine Einbußen erlitt und dass wir einen Garten hatten, der mit vielen Aufgaben auf uns wartete. Ich fühlte mich krisensicher. Und doch war da dieses Gefühl der Surrealität. Ringsum verschwand eine ganze Welt und mir wurde über Nacht „Systemrelevanz“ beschienen. Von der Systemkritik zur Systemrelevanz innerhalb von Stunden. Das Wort Zusammenhalt war in aller Munde und wurde in diesem Land von vielen Menschen in die Tat umgesetzt. Ich war tief berührt davon, dass die Vorarlberger Industrie z.B. sich plötzlich zusammenschloss und Schutzmasken für das medizinische Personal zu produzieren begann. Ich war froh, dass diese Krise vielleicht einen höheren Sinn barg.
Dann korrespondierte ich mit meiner französischen Freundin. Sie schrieb mir, ihre Kinder, beide Ärzte, seien an der Front. Ich war schwer irritiert. Von Krieg war die Rede. Von Sieg war die Rede. Ich sah den offenen Grenzen zu, wie sie der Reihe nach umfielen. Ich weiß, das ist ein Bild, das nicht funktioniert, und doch war es in meiner Wahrnehmung so da – das mag an diesem Dominoeffekt liegen. Die Grenzen werden jetzt bewacht und da der Flugplatz unseres Landes gleich hier in der Nähe ist, hörte ich mitten in dieser gespenstischen Stille den Hubschrauber ständig starten und landen, alle anderen Flugobjekte waren vom Himmel verschwunden. Ich hörte unseren Innenminister uns zu Lebensrettern erklären, und dachte, dass das Wort sein Gegenteil enthalte. Es dauerte auch nicht lange und jene, die keinen der fünf guten Gründe hatten, das Haus zu verlassen, und draußen angetroffen wurden, zahlten saftige Strafen und wurden zu Lebensgefährdern erklärt, weil sie ja stille Symptomträger sein könnten. Tagtäglich wurden und werden im Fernsehen die Zahlen der Gefallenen in diesem Krieg veröffentlicht. Eine ganze Nation, ganze Nationen weltweit verfolgen an Bildschirmen jeden einzelnen Tod in Form einer Addition. Die Waffen in diesem Krieg sind Drohungen. Wenn wir uns nicht eingrenzen, sagt der Kanzler, haben wir mit hunderttausend Toten zu rechnen, dann wird bald jeder jemanden kennen, der einen Menschen verloren hat. Das sagt er mit einem Gesicht, das keinerlei Besorgung erkennen lässt. Und zusätzlich hält er sich selbst an den Händen, eine Mischung aus Faltung und Reibung. Botschaft und Gestik sind nicht kohärent. Das war am 30. März. Ab da schlichen sich seltsame Gedanken bei mir ein. Wenn wir uns nicht eingrenzen. Das heißt, wir werden alle zu Soldaten in diesem Krieg gemacht, zu feindlichen Soldaten sozusagen, da, wenn wir nicht unterlassen, der Krieg verloren geht. Gesunde Menschen werden zur Bedrohung verkehrt.
Zuvor war ich ein gesunder Mensch gewesen. Dass ich durch meine Tätigkeit in der Altenbetreuung plötzlich zum systemrelevanten Menschen und gleichzeitig zur möglichen Lebensgefährderin erklärt wurde, ließ meinen Blutdruck in die Höhe fahren. Und das wiederum erschien mir so kurios, da ich mich doch vorher schon freiwillig an diese ganzen Beschränkungen gehalten hatte, um meine alte Dame nicht zu gefährden. Es muss an dieser Kriegsrhetorik liegen, dachte ich. Und als am 4. April die Bilder aus China zum Gedenken an die Coronatoten um die Welt gingen, da ging mein Blutdruck endgültig durch die Decke. Wie bringt man jeden einzelnen Menschen eines Staates dazu, zeitgleich für drei Minuten stillzustehen, egal ob er im Auto sitzt, in der U-Bahn unterwegs ist oder auf dem Feld arbeitet? Ich habe vor diesem Überwachungsstaat offensichtlich viel mehr Angst als persönlich vor dem Virus. Ich litt noch nie in meinem Leben an Bluthochdruck, deshalb suchte ich einen Arzt auf. Er verschrieb mir ein blutdrucksenkendes Mittel. Und so mutierte ich zu einem systemrelevanten Risikogruppenmitglied, das gleichzeitig eine potentielle Lebensgefährderin ist, da ich zu meinem Mann nicht auf absolute Distanz gehen kann, der ebenfalls ein systemrelevanter potentieller Lebensgefährder ist, da er nach wie vor in seiner Firma mit vielen, wenn auch jetzt mit weniger Menschen, arbeitet. Wir atmen dieselbe Luft, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir haben uns seit Wochen nicht mehr geküsst. Ich ermahne ihn des Händewaschens und hasse mich dafür.
Meine alte Dame leidet auch. Wir haben, schon bevor die Altersheime das hier taten, Besuche untersagt und statt der täglichen Spaziergänge in die Stadt, um Kaffee zu trinken und allfällige noch verbliebene Bekannte zu treffen, einsame Gänge durch ein menschenleeres Viertel getätigt – sie mit dem Rollator, ich mit Maske. Am letzten Freitag blieben wir vor einem Zebrastreifen stehen, weil ich aus der Ferne zwei Radfahrerinnen entgegenkommen sah. Die erste Radfahrerin ist vorbei gesaust, die zweite bremste ab und blieb stehen. Ich sah ihr ins Gesicht und bedankte mich. Sie senkte ihren Kopf und sagte: „Ich danke Ihnen.“ Ich war verwundert, wieso dankte sie mir? Wieso senkte sie den Kopf? Erst viele Schritte später begann ich zu verstehen. Sie dankte mir dafür, dass ich meine Arbeit fortsetzte. Viele Betreuerinnen sind noch kurz vor dem Shutdown in ihre Heimat gereist. Nach Rumänien, in die Slowakei. Nicht alle konnten zurückkommen. Für jene, die blieben, wird es einen Bonus von 500 Euro geben. Man dankt hier den Menschen, die blieben, um das System aufrechtzuerhalten, aber der Betrag ist lächerlich, er ist wohl am Lohn für zwei Wochen gemessen. Dieses Virus deckt viele Missstände auf, auch und gerade im Betreuungssystem.
Ich habe gemerkt, dass diese Arbeit mich zunehmend belastet. Nicht die Arbeit selbst, aber dass ich jetzt Nasenmundschutz und Handschuhe tragen soll. Berührung ist für alle Menschen wichtig, speziell für demente Menschen. Vor vier Jahren habe ich diese Berührungen eingeführt, sie haben meiner alten Dame über viele Stunden der Angst, die sie immer dann entwickelte, wenn ein Bewusstseinsfenster sich öffnete, und ihr klar wurde, was sie alles verliert, hinweggeholfen. Diese Berührungen – und mich kennt sie nicht am Namen oder am Gesicht – mich erkennt sie an meinen Berührungen. An der Sprache und am Inhalt der Gespräche. Ahja, Sie sind das, sagt sie dann. Diese Berührungen soll ich mit Handschuhen machen? Das geht nicht. Sie würde in noch mehr Isolation verfallen. Darum halte ich Abstand zu meinem Mann. Was, wenn ich die Überbringerin des Virus wäre? Hier in Österreich und auch in Frankreich hört man, die ersten Untersuchungen und Vorbereitungen von Klagen in Bezug auf Altersheime und das Versagen der Leitung seien schon im Gange. Laut WHO seien 50% der Todesfälle nach einer Infektion mit Corona in Europa in Pflegeeinrichtungen vorgekommen. Es ist so schwer, die Menschen in Heimen zu schützen. Irgendwo habe ich gelesen, in Schweden hätten die Putzfrauen, die auch in Hotels arbeiten, das Virus in die Heime gebracht. An diese Möglichkeit hatte ich gar nie gedacht. Diese armen, armen Putzfrauen. Und es bleibt völlig ungesagt und unbescholten, dass die einzelnen Regierungen im Jänner die Hilfe der EU ausschlugen -wochenlang gab es nirgendwo genügend Schutzausrüstung (schon wieder so ein Kriegsbegriff).
Ich weiß noch nicht, wie ich weiter mit dieser Situation umgehen werde. Als ich im Jänner eine schwere Grippe hatte, bin ich meiner alten Dame ferngeblieben, bis ich mich wieder gesund fühlte. Da handelte es sich um zwei Wochen. Jetzt ist die Situation eine andere. Immer öfter taucht der Gedanke auf, meine Arbeit in der Betreuung aufzugeben, weil ich den Wunsch hege, meine Kinder wiederzusehen, sie zu umarmen und mein Enkelkind zu knuddeln. Der Kleine ist ein Jahr alt und braungebrannt, wie ich auf Fotos sehe. Ich betrachte ihn, die pure Lebendigkeit, während Tränen auf die Tastatur fallen. Vermischt mit dem Blütenstaub ergeben sie ein seltsames Muster.
Hunderttausend Tote. Diese Annahme vom 30. März. Der Stress, den das in mir auslöste. Und eine gefühlte Woche später kündigt der Kanzler das Hochfahren des Tourismus für Mitte Mai an. Dieses technische Wort Hochfahren, als wären Menschen Maschinen. Dieselbe Mimik und Gestik wie bei der Ankündigung der hunderttausend Toten. Ich hatte mich auch für gezielte Öffnungen ausgesprochen, weil die produzierte Arbeitslosigkeit gigantisch ist. Ich hatte allerdings an die kleinen Geschäfte gedacht, an kleine Lokale, an kleine kulturelle Veranstaltungen und kleinere Betriebe, wo Kontakte überschaubar bleiben. Aber der Tourismus? Wo doch die allergrößte Zusammenrottung des Feindes (des Virus) in Ischgl geschah, von wo das Virus in die ganze Welt transportiert wurde? Ich war entsetzt. So viel nationale Anstrengung und Entbehrung, um den Tourismus wieder anzukurbeln? Wo hier und jetzt immer noch Polizei in den Bergen kontrolliert, ob man den Abstand wahrt, was mir das Wandern vermiest? Wie passt das alles zusammen? In meiner Naivität nahm ich an, dass der Kanzler und sein Beraterstab sich wohl verrechnet hatten. Ich dachte, wir hätten längst eine Herdenimmunität erreicht, die Herdenimmunität gegen Kritik. Bürgerrechte fallen reihenweise, zwar mit Ablaufdatum der Einschränkung versehen, aber aufgrund der Sprache der Kommunikation ist mir deutlich unwohl. Der Kanzler hat sich nie zur Ausschaltung des Parlaments in Ungarn geäußert. Was, wenn ihm das gefiele? Was, wenn er, jetzt auf dem Höhepunkt der Umfragewerte, eine dritte Regierung sprengte? Ich traue ihm und seiner Partei nicht zu, die richtigen Konsequenzen aus dieser Krise zu ziehen. Die anstehenden, vielfachen Dürren werden es zeigen.
Auf einer anderen Ebene habe ich das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Eine Geschichte. Versteckt in all diesen Büchern im Regal. Ich stehe davor und mir fällt der Name des Autors nicht ein. Es ist ein Mann, ich tippe auf Raymond Carver. Das Cover, das ich vage im Kopf hatte, passt aber nicht. Es ist jedenfalls ein Amerikaner. Ich habe die Bücher, so gut es geht, nach Ländern geordnet. Aus unerfindlichen Gründen ist T.C. Boyle woanders hingeraten. „Moderne Liebe“ heißt die Geschichte, Du kennst sie sicher, was erzähle ich Dir da. Diese Lust an abartigen Krankheiten, die gleichzeitige Angst davor, das Ganzkörperkondom, in welchem die beiden jungen Liebenden miteinander schlafen. Die umfassende Arztuntersuchung bis hin zur Genetik, die der junge Mann über sich ergehen lassen muss, damit sie mit ihm zusammenbleibt. Nach der Untersuchung hört er nichts mehr von ihr. Er erfährt weder von ihr noch vom Arzt, an welchem nicht sichtbaren Makel er leidet. Er ruft sie an. Sie ist ablehnend. Er sagt: „Aber wir waren uns doch so nahe!“ Sie sagt: „So nahe dann auch wieder nicht…“.
Abstand. Keine Berührungen. Das „New Normal“ aus Boyles Geschichte wird jetzt im Silikon Valley verkündet, daran wird dort von den Start-Ups mit Lichtgeschwindigkeit gearbeitet. Wir werden nach Corona in einer Gesellschaft leben, die ohne Berührung auskommen will, so tönt es. Touchless am Flughafen, beim Shopping usw., weil die mögliche Bedrohung durch Pandemien und Grippewellen bleibt. Touchless in Altersheimen, da wir die Menschen dort jetzt nicht schützen konnten? Eine solche Welt verliert für mich an Wirklichkeit.
Eines der wichtigsten Muster der Lebendigkeit des Lebens ist der Spalt. Im synaptischen Spalt wird ein elektrisches Signal in ein chemisches umgewandelt. So findet Austausch statt. Und so mag ich mit dir hoffen, dass wir als Art chemische Radikale uns in neuem Denken verbinden. Eines der wichtigsten Lebensprinzipien ist jenes der Osmose. Vielleicht, so mag ich denken, ist die Erscheinung der weltumspannenden Unsicherheit eine Art semipermeable Wand, an der sich ein Konzentrationsausgleich zum Überleben der Zellen abspielt. Vielleicht gelingt es den vielen kleinen Initiativen der momentan gelebten Solidarität sich in den Köpfen der Menschen mehr festzustecken als der Glaube an die Überlegenheit des Wettbewerbs, der so viel Armut produziert.
Es ist Abend geworden, die Lufttemperatur ist schlagartig gesunken, und ich muss den Sonnenschirm einholen. Gleich wird es regnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute Abend eine Fledermaus gesehen habe. Ihr Flattern ist zur Zeit die letzte Bewegung in der Natur, die ich wahrnehme, bevor ich mich ins Haus zurückziehe. In den letzten Jahren ist es ein paar Mal geschehen, dass sich eine Fledermaus ins Obergeschoss verirrt hat. Da hilft nur, die Lichter alle auszuschalten und alle Fenster zu öffnen – und Geduld.
So schicke ich Dir herzliche Grüße über den Teich in ein Land, in dem ich noch nie war.
Alles Liebe,
Gabriele
Hohenems, 26. April 2020
Gabriele Bösch (* 1966) arbeitet seit den 1990er-Jahren als Autorin und lebt mit ihrer Familie in Hohenems. Sie hat 2016 den Vorarlberger Literaturpreis erhalten.
Ihr Briefpartner, der Literaturprofessor Peter Gilgen (* 1963) lebt in Ithaca, New York.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 8: Mit Spekulationen habe ich meine Schwierigkeiten …
weiter ...Lieber Christoph,
mit Spekulationen habe ich meine Schwierigkeiten. Annahmen und Beurteilungen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeit. Sicher, Wirtschaft und Politik stehen nicht gerade im Ruf, leicht durchschaubar zu sein, aber es stimmt auch, dass Verheimlichung und Geheimhaltung abnorme Mechanismen totalitärer Regimes sind. Bleibe uns diese Manipulation erspart.
Allerdings, eine Manipulation von Rechten hat in den vergangenen Wochen auch in Europa stattgefunden. Zu viel Konzentration auf die Epidemie führte dazu, dass dies ohne große Proteste und Widerstände passieren konnte.
Zum jetzigen Zeitpunkt devoten Schweigens erteilte Ungarn dem Ministerpräsidenten unumschränkte Vollmacht, und zwar ohne Einschränkung, das heißt ohne zeitliche Beschränkung. Die Demokratie wurde ausgesetzt, eine paradoxe Entscheidung, wenn man bedenkt, dass diese vom Parlament beschlossen und von der Regierung unterstützt wurde. Europa reagierte kaum darauf, mit Verlaub, es reagierte überhaupt nicht darauf! Keinerlei Maßnahmen. Man äußerte sich höchstens besorgt und alarmiert zur Gefahr der Verletzung der Grundsätze des Zustands der Demokratie.
Nun, Christoph, ich glaube, dass ein solch zweifelhaftes Verhalten null Spielraum egal für welche Art von Zögern lassen sollte. Eine Virus-Notfallmaßnahme? Kein Grund rechtfertigt Autokratie. Eine solche Machtkonzentration ist in der Europäischen Union beispiellos, es ist ein Ereignis, das ihre Grundwerte zutiefst vergiftet. Alle Länder der Union haben schwierige Maßnahmen ergreifen müssen, die die Bürgerrechte ihrer Bürger einschränkten. Orban hat der gesamten Nation eine „unbefristete Quarantäne“ verordnet und damit die Meinungs- und Pressefreiheit beschnitten. Wir werden uns als europäische Bürgerinnen und Bürger also schon fragen müssen, ob wir, was in einem der Mitgliedstaaten geschieht, als etwas weit Entferntes oder als eine ernsthafte Bedrohung für das Gemeinwohl betrachten wollen.
Aber was ist das Gemeinwohl? Ist es Ausdruck des Staates, der Republik, der Öffentlichkeit? Unser öffentliches Sprechen, Christoph, ist zum Beispiel in diesem unseren Briefwechsel nicht selbstverständlich. Ich möchte daran erinnern, dass ein Teilnehmer an diesem Projekt sich entschieden hat, seine Beiträge auszusetzen, weil die Korrespondenz mit einem anderen Autor, der dem autoritären Regime in China kritisch gegenübersteht, sein Aufenthaltsrecht dort hätte gefährden können. Die Angst brachte einen verbalen Austausch zum Schweigen, der Wahrnehmungen und Empfindungen entfaltet hätte.
Ich glaube nicht, dass in Italien irgendjemand daran gehindert wurde, sich zu dieser Pandemie zu äußern. Hier ist die zahlenmäßige Dichte der Theorien unüberschaubar geworden, Meinungen gibt es noch mehr als Theorien, lediglich Überzeugungen hatten sich bereits nach der ersten Woche erschöpft. Aber es gibt die Meinungsfreiheit, und solange wir sie haben, sind wir auf der sicheren Seite, würde ich sagen, Virus hin oder her. Das Recht, seine Meinung frei zu äußern und nicht daran gehindert zu werden, ist ein Recht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte anerkannt wird. So steht es geschrieben, schwarz auf weiß, und geschrieben steht: universell. In der Astronomie ist das Universum die Gesamtheit der Himmelskörper, Planeten, Sterne und Galaxien. Wir Menschen gehören dazu, insofern ist „universell“ auch die richtige Bezeichnung. Und mitten in diesem „alles Umfassenden“ mischen wir uns ein Gebräu aus Werten und moralischen Prinzipien, aus Geschichte und Geschichten, Sprechweisen und Bestrebungen nach Frieden und Kontrolle und der Summe aus bestimmten Tugenden, von denen wir nicht einmal mehr wissen, welche es sind. Zutaten kurzum, die inzwischen ziemlich verdorben riechen.
Heute ist der 25. April, einer der schönsten Feiertage, weil er an die Befreiung Italiens erinnert, dem ersten und maßgeblichen Grundstein dieser Republik. Die Wiedererlangung unserer Freiheit verdanken wir dem Widerstand mutiger junger Menschen. Sie mussten sich einen Weg erfinden, den es vorher nicht gab. Um die Demokratie zu errichten, mussten sie sie zuerst erträumen. Es ist ihnen gelungen, obwohl die Umstände dramatisch waren. Dieses Land feiert die Befreiung, mit einem Lächeln auf den Lippen, obwohl es sich immer noch und immer wieder schwer tut mit der Aufarbeitung der eigenen faschistischen Vergangenheit.
Ich schaue deutsche Fernsehsender, fast jeden Abend werden hier hingegen Dokumentationen zum Nationalsozialismus gezeigt, ständig, als wollte man zeigen, dass davon nie genug sei. Bevor ich diesen Brief beendete, machte ich einen Spaziergang in den Wald hinter dem Haus. Ich suchte nach einer Blume, die uns näherbringen könnte, aber ich konnte keine finden. Es gibt die kleinen Soldanellen, das Leberblümchen, ja, ihre Schönheit, zumindest. Es liegt noch zu viel Schnee und der Frühling verhält sich zögerlich in diesem Jahr. So überlasse ich dir für diesmal mein Lächeln, Roberta.
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Marjana Gaponenko & Christian Furtscher
Brief 1: Kurz nachdem ich gestern erfahren hatte …
weiter ...Wien, 23. April 2020
Liebe Marjana Gaponenko,
kurz nachdem ich gestern erfahren hatte, dass wir uns in den nächsten Wochen Briefe schreiben würden, zog ich eines deiner Bücher aus dem Regal, das Buch Annuschka Blume, schlug es auf und konnte gleich zu Beginn lesen: „Liebe Anna Konstantinowna, es wird ein langer Brief werden. So einen Brief haben Sie in Ihrem Leben noch nicht bekommen. Sollten Sie ihn gewogen haben, haben Sie sicher bemerkt, dass er exakt das Gewicht einer Woche hat: dreißig Gramm! Ist das nicht entzückend?“ – Ich war entzückt, um dieses hübsche Wort aufzugreifen, als ich das las, und deutete es sofort als gutes Vorzeichen, was unseren Briefwechsel anbelangt. Und bei den 30 Gramm musste ich sofort an Dirk Stermann denken, der in der Sendung „Willkommen Österreich“ auf die Frage, wie viel Gewicht er während der ersten Woche in Quarantäne schon zugenommen habe, geantwortet hat: „30 Gramm.“ Ich glaube, es war auch in dieser Sendung, dass einer vom Duo Maschek den folgenden Witz erzählte: „Sagt ein Mann zu seiner Freundin: ‚Lass uns heiraten!’ Sagt sie: ‚Ich kenne nur den weißen.’“ – Ich bin stolz auf mich, dass ich den Witz nach einigen Sekunden intensiven Nachdenkens verstanden habe, er ist für mich schon jetzt der Witz des Jahres. Kleiner Hinweis zum Verständnis: „heiraten“ kann man auch so hören: „Hai raten“ … Liebe Marjana, ich hoffe, du hast jetzt nicht genervt ausgerufen: „Das kann ja heiter werden!“ oder so etwas Ähnliches.
Wie gesagt, der Anfang deines Buches ist für mich ein gutes Zeichen, ich freue mich auf die Briefe von dir, unser Briefwechsel wird, wie ich schon in der E-Mail im Vorfeld geschrieben habe, eine Reise in die Ferne, ein Nachtflug, ein Tanz vor dem Gewitter … Diese drei Lyrikbände von dir stehen auch bei mir im Regal, außerdem noch zwei deiner Romane. Ich hoffe, du hast auch Bücher von mir, du musst nicht sagen, welche das sind. Schluss damit, reden wir von etwas anderem! Um auf Annuschka Blume zurückzukommen, hier vor meinem Fenster blüht derzeit eine japanische Zierkirsche in voller Pracht, d.h. es befinden sich schon mehr von den rosaroten Blüten unter dem Baum als auf dem Baum. Vorgestern gab es hier geradezu einen Blütensturm. Der Wind riss von den Bäumen die Blüten, wirbelte sie durch die Luft. Jetzt sind der Gehsteig und die Straße, vor allem der Straßenrand, dicht bedeckt mit den Blüten, man kann darin waten, es ist eine ganz besondere Zeit, sie dauert nur ca. zwei Wochen im Frühling, alle Jahre wieder warte ich darauf, und heuer hingen an der Zierkirsche auch sechs bunte Luftballons, die waren dort für mich aufgehängt, anlässlich meines runden Geburtstages, der anders ausfiel als geplant, ganz anders. Eigentlich wollte ich ihn in Venedig feiern. Ich hatte bei der Literar Mechana wieder einmal um die Wohnung in San Polo angesucht, in der Autorinnen und Autoren alle drei Jahre für ca. zwei Wochen gratis wohnen können, wenn sie wollen, ich hatte zum ersten Mal einen Terminwunsch geäußert, und der wurde mir erfüllt. Die Vorfreude war groß, ich würde den besonderen Geburtstag in Venedig feiern, meine Frau würde die ganze Zeit bei mir sein, mein Sohn fünf Tage, meine zwei Schwestern auch ein paar Tage, mein Busenfreund und seine Freundin hatten in einer nahe Pension gebucht, ich würde in der Cantina DO SPADE (Zwei Schwerter) feiern, eine Woche davor wollte ich im LÖWEN in Feldkirch vorfeiern – beides fiel ins Wasser, nicht einmal eine kleine Feier im WILD in Wien war möglich. Egal, ich bin eh kein großer Feierer! Mein Geburtstag letzten Sonntag war trotzdem großartig! Zum Essen kam unser Sohn, er saß zwei Meter entfernt von uns. Später standen wir am Fenster (wir wohnen Hochparterre), vor uns die blühende Zierkirsche, von meiner Frau zusätzlich verziert mit den Luftballons, unten auf dem Gehsteig inmitten der Blüten standen meine zwei Schwestern und mein Schwager, der Bruder und eine Nichte waren per Video auch kurz mit von der Partie, es gab Sekt, der Nachbar kam zufällig vorbei (er reichte mir später durchs Fenster ein Geschenk herüber, unsere Wohnungen grenzen aneinander), ein zweiter Nachbar kam vorbei, mit seiner Freundin, die beiden legten mir später Rosen und ein hübsches Kärtchen vor die Haustüre, Passanten machten lustige Bemerkung, freuten sich über die Sektpartie auf dem Gehsteig … Am Abend spazierten wir ca. 20 Minuten zu dem Haus, in dem der gute Ernst Molden wohnt. Pünktlich um 18 Uhr gab er auf seinem Balkon ein Konzert vor ca. 200 Leuten. Er wurde von seinem Sohn am Bass begleitet. Unser Sohn besorgte bei der nahen Tankstelle Bierchen – alles war perfekt. Ein ganz besonderer Geburtstag, unvergesslich.
Wie schaut dein Alltag derzeit aus?
Kannst du der „Corona-Zeit“ auch Positives abgewinnen?
Ich habe gelesen, dass du Pferde sehr magst und sogar selber Pferde hast. Wir hatten bis vor kurzem eine Katze, sie hieß Chelsea und hatte Diabetes. Morgens eine Spritze, abends eine Spritze. Nach ihrem Tod war da plötzlich eine Fliege in unserer Wohnung, die sich ungewöhnlich verhielt für eine normale Stubenfliege, sie verhielt sich ähnlich wie die Katze. Wir schlossen sie ins Herz und gaben ihr den Namen Fritz. Fliege Fritz war unser neues Haustier. Wir recherchierten, wie lange eine Fliege lebt. Fritz lebte viel länger als angegeben. Er begleitete uns monatelang. Ich konnte lüften wie ich wollte, nie verließ Fritz unsere Wohnung. Er sah mir neugierig zu, wenn ich kochte, und wenn ich ein Buch las, ließ er sich auf der aufgeschlagenen Seite nieder. Er besuchte mich auch gern im Bett … Einmal, als ich nach zwei Wochen Abwesenheit wieder nach Hause kam, flog er mir entgegen, berührte mich an der Nase, setzte sich auf meinen Arm … Jeden Tag freute ich mich darauf, Fritz zu sehen! Er war gern in unserer Nähe. Sah ich ihn einmal längere Zeit nicht, machte ich mir Sorgen. Die Wiedersehensfreude war jedes Mal sehr groß, auf beiden Seiten, wie ich meine. Als Fritz plötzlich tagelang nicht mehr auftauchte, mussten wir das Schlimmste befürchten. Aber bevor ich nicht seine Leiche gesehen hatte, weigerte ich mich zu akzeptieren, dass er tot war. Schließlich fand ich Fritz in einer Ecke des Wohnzimmers. Er war kleiner als zu Lebzeiten. Seither ruht er in einem offenen Grab: in einem Drehverschluss einer Weinflasche, Öffnung nach oben, im Bücherregal vor dem Buch Tubutsch von Albert Ehrenstein. – Ich habe dir jetzt von Fritz erzählt, obwohl mir meine Mutter quasi verboten hat, von ihm zu erzählen. Sie macht sich Sorgen um meinen Geisteszustand, d.h. sie macht sich Sorgen, dass man mich für plemplem halten könnte, wenn ich von Fritz erzähle …
Dieser Brief ist ein Jungbrunnen für mich! Stell dir vor, ich fühle mich jetzt jünger als noch vor dem Brief. Ich bin schon neugierig, wie du auf ihn reagieren wirst. Ich liebe es, Briefe zu schreiben. Da darf ich Fehler machen, muss nicht druckreif sein. Und ich darf auch ausufernd sein. Darf ich doch? Dwarf heißt Zwerg und brief heißt kurz.
* * *
Nächster Tag, Fortsetzung
Liebe Marjana, als ich gestern an diesem Brief schrieb, kam ein Anruf von meinem Freund Johnny herein. Ob ich ihn nicht am Donaukanal treffen wolle? Aber sicher, aber immer. Am Ufer sitzen, Sonne tanken, Bierchen trinken und dem Wasser beim Fließen zuschauen. Ich will dir kurz von Johnny erzählen.
Er ist arbeitslos, war bis vor ein paar Jahren Nachtportier im besten und coolsten Hotel von Wien, im Kaiserhof am Brillantengrund. Musikgrößen wie Element of Crime, Rocko Schamoni, On + Brr u.a. sind in dem charmanten Hotel abgestiegen. Ich habe Johnny immer wieder während seiner Nachtdienste besucht, einmal habe ich sogar Silvester dort gefeiert. Johnny hat viele gute Geschichten auf Lager, was das Hotel anbelangt, er hat dort viel erlebt. Vor ein paar Jahren ist seine letzte große Liebe gestorben, das war ein harter Schlag für ihn. Er hat fünf Kinder mit vier Frauen, die sich übrigens alle gut miteinander verstehen, bzw. verstanden, auch die vier Frauen. Er war früher zeitweise als Tanzmusiker und Schauspieler in ganz Österreich unterwegs. Er hat nach wie vor immer wieder große Pläne, tut sich aber schwer damit, sie in Angriff zu nehmen und in die Tat umzusetzen. Derzeit versucht er seit über einem Jahr, seine neue Wohnung wohnlich zu machen. Er haust in einem Durcheinander, das an einen Flohmarkt erinnert. Als ich das letzte Mal bei ihm war, sprach er davon, dass er seit Wochen überlege, wie er es angehen solle, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Zum Glück habe er in Asien vom Buddhismus gelernt, dass ein Berg aus Sand auch dann irgendwann verschwindet, wenn eine Taube täglich nur ein einziges Sandkorn entfernt. Ich rief aus: „Mann, wie alt sind wir? So lange haben wir nicht mehr Zeit!“ Apropos Zeit: Ein anderes Mal, das ist bestimmt schon zwei oder drei Jahre her, trafen wir uns bei einem Kiosk. Er zeigte mir stolz ein großes dickes Buch mit leeren Seiten. Er habe vor, mit dem Schreiben zu beginnen. Im Laufe unseres Gesprächs, in dem es wieder einmal darum ging, was man nicht alles machen könnte, wenn man sich nur dazu aufraffen würde, zitierte ich einen meiner Lieblingssätze von Charles Bukowski: „Die Zeit ist zum Verplempern da.“ – Johnny war hellauf begeistert, geradezu elektrisiert! Er wisse schon, warum er mich gern treffe, ich würde jeden Therapeuten ersetzen, und er schrieb den Satz auf die erste Seite seines Buches. Als ich Johnny Monate später wieder traf, stand in dem Buch immer noch nicht mehr drin als dieser eine Satz. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Auch gestern kam der Spruch wieder zur Sprache, nachdem Johnny, am sonnigen Nachmittag im Grase sitzend, ein Bier in der einen Hand, eine Selbstgedrehte in der anderen, über die Corona-Zeit den schönen Satz sagte: „Ich würde in ein paar Monaten gern sagen können, ich habe die Zeit gut genützt.“
Ich musste aufbrechen, weil mich eine Freundin um 18 Uhr besuchen wollte. Anna habe ich 2013 in Târgu Mureș kennengelernt, sie lebt seit einigen Jahren in Wien, und hat mich per SMS so schön gefragt: „Kann ich Fensterbesuch machen?“ – Eine Nachwehe meines Geburtstages. Sie brachte ihren Freund Risto mit, ich bekam noch einmal Geschenke, es gab wieder Sekt: die beiden unten auf dem Gehsteig unter der japanischen Zierkirsche, ich oben am Fenster … Risto ist der Sänger und Geiger der Band Hotel Balkan. Das erwähne ich aus dem Grund, weil wir am 6. März auf einem Konzert von ihm waren, und das war ein besonderer Abend, u.a. deshalb, weil es der letzte Abend war, an dem ich Menschen, die nicht meine Frau waren, gebusselt und umarmt habe.
Die Geschichte, wie ich Anna kennengelernt habe, muss ich dir auch einmal erzählen, die ist sehr erzählenswert. Ich liebe sie!
Abschließend noch eine grobe Skizze meines derzeitigen Alltags (weil mich der von dir auch interessieren würde):
– Schreiben im Bett (Gedichte)
– Frühstück
– Schreiben am Schreibtisch (Kleiner Roman, Auftragsarbeiten)
– Mittagessen
– Lesen auf dem Sofa
– Schreiben am Wohnzimmertisch (E-Mails, Briefe, Pipapo)
– Ein bis zwei Stunden spazieren, mit meiner Frau (Prater, Donaukanal, Donau, Donauinsel …)
– Abendessen
– Zwei Folgen einer Netflix-Serie
– Lesen im Bett
So in etwa.
Und ganz abschließend noch ein paar Fragen:
– Arbeitest du an einem neuen Buch?
– Stimmt das mit den Pferden?
– Wie geht es dir?
– Hast du bald einen runden Geburtstag?
– Was war dein bisher schönster Geburtstag?
– Hast du eines oder mehrere Lieblingsbücher?
– Was liest du gerade?
– Reist du gern?
– Ist dieser Brief zu lang?
Uff!
Dieses war der erste Streich …
Alles Liebe Gute Schöne,
Christian
PS: Der nächste Brief wird kürzer, versprochen!
Christian Futscher (* 1960), Autor von Lyrik, Hörspielen und Prosatexten, lebt seit den späten 1980er-Jahren in Wien. Zuletzt bei Czernin erschienen: «Was mir die Erdmännchen erzählen» (2016) und «Wer einsam ist in der großen Stadt» (2017).
Seine Briefpartnerin Marjana Gaponenko (* 1981) wuchs in Odessa auf und lebt mittlerweile in Mainz und Wien. Sie schreibt seit ihrem sechzehnten Lebensjahr auf Deutsch.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Lettera 8: Faccio fatica con le congetture …
weiter ...Caro Christoph,
faccio fatica con le congetture. Supposizione e giudizi che poggiano sulle apparenze probabili. Certo, economia e politica non hanno fama di proprietà trasparente, ma è anche vero che l’occultamento e la segretezza sono meccanismi perversi dei totalitarismi. Lungi da noi questa sottrazione.
Eppure una sottrazione dei diritti è successa nelle ultime settimane anche in Europa, troppa concentrazione sull’epidemia ha fatto sì che accadesse senza grandi contrasti e resistenze.
In un silenzio remissivo del tempo ora, l’Ungheria ha dato i pieni poteri al primo ministro, lo ha fatto senza limiti, ciò significa con rinnovo senza limite. Hanno sospeso la democrazia, una presa di posizione paradossale visto che il via libera è stato deciso dal Parlamento e appoggiato dal governo. L’Europa ha reagito poco, permettimi, non ha reagito proprio! Nessun provvedimento. Se non l’espressione di timore e di preoccupazione per il rischio di violazione dei principi dello stato di democrazia.
Ecco Christoph, io credo che questo dubbioso comportamento non dovrebbe lasciare spazio a nessun tipo di esitazione. Emergenza virus? Nessun motivo giustifica l’autocrazia. Una tale concentrazione di potere non ha precedenti nell’Unione Europea, è un avvenimento che intossica profondamente i suoi ideali. Tutti i paesi dell’Unione hanno dovuto adottare misure difficili che hanno limitato i diritti civili dei loro cittadini. Orban ha messo in una “quarantena a tempo indeterminato” l’intera nazione, limitando la libertà di espressione e la libertà di stampa. Dovremo pur chiederci in quanto cittadini europei, se considerare ciò che sta accadendo in uno degli stati membri, come un qualcosa lontano da noi o come una grave minaccia al bene comune.
Il bene comune, quello che esprime stato, repubblica. Lo stare pubblico.
Ricordiamolo pure Christoph, lo stare pubblico in questo nostro epistolario, ha fatto sì che un compagno di percorso, ha dovuto prendere la decisione di non partecipare all’iniziativa, perché la sua corrispondenza sarebbe arrivata dal Giappone. Il timore di compromettere il suo soggiorno letterario ha zittito un contraccambio di percezioni e sentimenti.
Non credo che in Italia sia stato impedito a qualcuno di esprimersi in riguardo a questa pandemia. Qui la consistenza numerica delle teorie è incalcolabile, le opinioni superano le teorie, solo le convinzioni si sono esaurite dopo una settimana dall’inizio. Ma c’è la libertà di espressione e finché ce l’abbiamo, direi che siamo salvi, nonostante il virus. Il diritto di esprimere la propria opinione e non essere impediti in questo, è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani.
Così è scritto, scritto su carta e c’è scritto: universale. In astronomia universo è l’insieme dei corpi celesti, i pianeti, le stelle e le galassie. Dentro ci stiamo anche noi esseri umani e quindi dire “universale” è dire cosa giusta. E però dentro a questo “tutto intero” ci cuciniamo un intruglio di valori e principi morali, la storia e le storie, i linguaggi e le aspirazioni di pace e controllo e la somma di certe virtù che nemmeno sappiamo più quali sono. Vivande insomma, che ormai poco profumano di buono.
Oggi è il 25 aprile, festa delle più belle, poiché ricorda la Liberazione d’Italia, scritta con la maiuscola e prima pietra nelle fondamenta di questa Repubblica. È alla resistenza di giovani coraggiosi che dobbiamo il riscatto della nostra libertà. Loro si sono dovuti inventare una strada che non c’era. La democrazia per costruirla, l’hanno prima dovuta sognare. Ci sono riusciti in mezzo a una situazione drammatica. Questo paese festeggia la Liberazione, lo fa con il sorriso sulle labbra, eppure continua a faticare, e ancora a faticare in una riflessione sul fascismo. Guardo volentieri i canali della televisione tedesca, lì al contrario ogni sera o quasi un documentario sul nazismo, continuamente, come a dire, non sarà mai abbastanza.
Prima di finire questa lettera, ho fatto una camminata nel bosco dietro casa. Ho cercato un fiore che potesse porci in più stretta relazione, non l’ho trovato. Ci sono le soldanelle, l’anemone fegatella, se non altro, la loro bellezza. C’è troppa neve ancora, e la primavera quest’anno è incerta nell’agire. Ti consegno il mio sorriso, Roberta.

Quelle: literatur:vorarlberg netzwerk
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 7: Ja, der Löwenzahn blüht …
weiter ...Liebe Roberta.
Ja, der Löwenzahn blüht. Dieses von noch fast jedem Pfingstrosenzüchter und anderen Heimgärtnern ungeliebte Beikraut, das seine Wurzeln erstaunlich tief ins Erdreich schlägt. Ähnlich wie die Angst, die in unser Bewusstseinssubstrat gestreut wurde und schon jetzt nicht weniger erstaunlich stark verwurzelt zu sein scheint wie der Löwenzahn… Vieles bleibt Spekulation, zu so manchem sehe ich mich, trotz oder gerade wegen der von dir anfänglich eingemahnten Verantwortung, die uns als Schreibenden zukommt, nicht befähigt, eindeutig Stellung zu beziehen. Die Sachlage scheint mir zu komplex. Es kann also beispielsweise hier nur erwähnt werden, muss aber von mir mehr oder weniger unkommentiert bleiben, dass laut Erhebungen des Robert-Koch-Instituts, der ETH Zürich und auch der Ages der Reproduktionsfaktor in den jeweiligen Ländern bereits vor dem Lockdown teilweise deutlich unter den wichtigen Wert von R0=1 gesunken ist. Aufhorchen lässt auch eine Studie der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“, wonach ein infiziertes Kind in Frankreich trotz Kontakten mit mehr als 170 weiteren Kindern kein einziges angesteckt hat, was auf eine untergeordnete Rolle Heranwachsender bei der Verbreitung des Virus schließen lassen könnte. Ich möchte mir nicht anmaßen, daraus irgendwelche (voreiligen) Schlüsse zu ziehen, allerdings werde ich den sich nach und nach verhärtenden Eindruck nicht los, dass vieles, was von der Politik als evidenzbasiert verkauft wird, eher einer trickreichen Jonglage mit Unbekannten und Dunkelziffern entspricht. Der Umstand, dass ein renommierter Gesundheitsexperte aus der hiesigen Covid-19-Taskforce ausgeschieden ist, weil er laut dem „Standard“ zum Dorn in dem vom Kanzler angestrebten konsensualen Wissenschaftsauge wurde und vor allem auch auf völlige Transparenz gegenüber der Bevölkerung pochte, lässt zudem hell- und hellsthörig werden.
Eine schon weniger subjektive Wahrnehmung (wie du bereits geschildert hast) ist die Angstrhetorik und -symbolik, die nicht nur von der Politik, sondern auch von vielen Medien betrieben wird und wurde. Zur Regel geworden waren scheinbar dem Gravitationsgesetz übermäßig gehorchende Gesichtszüge ostentativ besorgter Moderatoren in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen und deren nachgerade defätistischen Ansagen, die immer mehr dem Regierungsprotokoll entliehen schienen. Experten gegenläufiger oder zumindest kritischer Ansichten kamen nicht zu Wort. Jedenfalls hat es sich vor einigen Wochen so verhalten, zwischenzeitlich habe ich aufgehört, diese Sendungen zu verfolgen. Nicht aufgehört hat dagegen die Pflanzung von Angstsetzlingen. Wenn auch verbal weniger martialisch als in Frankreich oder eben in Italien. Vonseiten der Politik war die Rede von Alternativlosigkeit, von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg oder davon, dass schon bald jeder einen Corona-Toten kennen werde – das In-Erwägung-Ziehen einer Aufweichung des „in Zeiten wie diesen“ gemeinwohlerodierenden Datenschutzes inklusive. Und diese Rhetorik hat, wie ich finde, ihre Entsprechung in der Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes gefunden – ein kontrovers diskutiertes Thema. Eindeutig dagegen sind die psychosozialen Dimensionen, die Funktion der Maske als eine Art portables Memento mori, eine unverhältnismäßige Permanent-Vergegenwärtigung der unsichtbaren Gefahr um uns. Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben, weiß der Volksmund. Angst und Panik, so das „Addendum“-Magazin, seien schlechte Ratgeber und hoch infektiös. So infektiös, dass man sogar Menschen allein in ihren Autos sitzend Schutzmasken tragen sieht. Als gälte es, sich vor sich selbst zu schützen.
Der Löwenzahn. Verpönt bei den Gartenkultivierern, geliebt von den Kindern. Jedenfalls der reife, die Pusteblume. Seifenblasen nennt sie mein Kind. Weil die Samen wie Blasen durch den Luftraum schweben. Das Kind pustet einmal. Der Wind ist günstig, die Samenschirmchen werden hoch in die Lüfte verteilt. Wer weiß, wo sie landen und Wurzeln schlagen werden …
Es grüßt aus V,
Christoph
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Peter Gilgen & Gabriele Bösch
Brief 1: Wir haben uns noch nie getroffen …
weiter ...Liebe Gabriele,
Wir haben uns noch nie getroffen. Doch würde ich nicht sagen, dass wir uns nicht kennen. Oder zumindest: dass ich Dich nicht kenne. Dazu habe ich beim Lesen Deiner Texte schon zuviel über Dich erfahren. Zunächst allerdings dies: Ich hoffe, dass Dir die vertraute Anrede nicht unangebracht scheint. Die Entscheidung, ohne lange Umstände oder Anfragen in diesem ersten Brief die Du-Form zu verwenden, habe ich nach längerem Zögern getroffen. Insgeheim hatte ich gehofft, dass Du vielleicht in unserem Briefwechsel den Anfang machen und damit die Tonlage und vielleicht auch schon das eine oder andere Thema vorgeben würdest. Was die passende Anrede betrifft, fällt es mir nicht leicht zu beurteilen, ob meine Befindlichkeiten in dieser Frage auf der Höhe der Zeit sind. Dafür lebe ich schon zu lange in einem Sprachraum, in dem es die Unterscheidung zwischen informeller Anrede und Höflichkeitsform längst nicht mehr gibt. Ausserdem gehöre ich zu jener Generation, die erwachsen wurde, als sich Anredeformen und manche Anstandsregeln, die uns im Kindesalter eingebläut wurden, zu verflüchtigen begannen. Später lebte ich als Student einige Jahre in Zürich. Ich glaubte, mich mit einem höflichen “Sie” im Zweifelsfall durchschlagen zu können, bis ich an eine Kellnerin geriet, die beleidigt bemerkte, sie sei für diese Anrede nicht alt genug, und was ich damit eigentlich beweisen wolle? Darauf wusste ich keine Antwort. Von diesem Zeitpunkt an schien jede neue Begegnung komplizierte Abwägungen zu verlangen, um die Beteiligten nicht vor den Kopf zu stossen und der Situation gerecht zu werden.
Als ich nach Amerika kam, gefiel es mir, dass hier jeder unterschiedslos mit “you” angesprochen wird. Dabei war das “you” des Immigrationsbeamten autoritärer, als noch das zackigste “Sie” je hätte sein können. Trotzdem glaubte ich, in der nur durch den Tonfall modulierten, als Wort aber gleich bleibenden Anrede die ursprüngliche politische Vision dieses Landes erkennen zu können, eine Art Versprechen, das in jedem Gespräch erneuert wird. Daran gewöhnte ich mich gern. Im Gegensatz zu Zürich, einer Stadt, die mir vor allem den Rücken zugewandt hatte, war es in Chicago, der weitaus grösseren und, wie man vermuten würde, anonymeren Metropole, leicht, mit Leuten, die man nicht kannte, ins Gespräch zu kommen und dann – das fiel mir anfangs nicht leicht – auch wieder weiterzugehen, ohne nach dem Namen des anderen gefragt oder den eigenen genannt zu haben. Die englische Sprache nötigte mich nicht, im Voraus zu entscheiden, in welcher Nähe oder Ferne ich mich gegenüber einer anderen Person verortete, und zu bestimmen, welche Verbindlichkeiten ich eingehen wollte und wie formell oder informell ich die Situation einschätzte, in der ich mich gerade befand. Die ersten Monate im neuen Land waren allein deshalb nicht nur eine Einübung in ein anderes Sprechen, sondern vor allem auch in einen andere Art von Gesellschaft.
Am dritten oder vierten Tag im neuen Land ging ich von der Universität zum Bahnhof, um mit dem Pendlerzug nach Hause zu fahren. Ich wohnte die ersten zwei Wochen bei einer Gastfamilie etwas ausserhalb der Stadt. Der Vater wollte mich dort am Bahnhof abholen und hatte mich gebeten, vorher anzurufen. Als ich vor der langen Reihe von Telefonautomaten stand – es gab noch keine Handys –, bemerkte ich, dass ich nur eine 5-Dollar-Note in der Tasche hatte. Es war nach Feierabend, und der ganze Bahnhof war voll von Menschen. Ich ging auf einen Mann in einem eleganten, blauen Anzug zu, der ein ledernes Aktenköfferchen trug. Er schaute auf, als ich ihn fragte, ob er meine fünf Dollar vielleicht wechseln könne, da ich Münzen brauche, um zu telefonieren. Er steckte seine Hand in die Hosentasche, gab mir eine Handvoll Kleingeld und sagte: “Don’t worry!” Im Weitergehen rief er noch: “Good luck, son!”, bevor er in der Menschenmenge verschwand.
Erst Jahre später begann ich mich zu fragen, ob mir dieser Mann auch geholfen hätte, wenn meine Haut dunkler wäre, und ich einen anderen, nicht-europäischen Akzent hätte. Seine Geste war herzlich und spontan gewesen. Etwas in mir sträubt sich dagegen, diese Grosszügigkeit in Zweifel zu ziehen. Ich rede mir ein, dass solche Äusserlichkeiten für ihn keine Rolle gespielt hätten. Zugleich weiss ich, dass die Statistiken gegen mich sprechen. Schon nach wenigen Wochen in Chicago wurde mir bewusst, dass es mit Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit nicht weit her war in diesem Land der grossen Träume. Die Träume aber – sie blieben mir lieb.
In der von einem Virus ausgelösten gegenwärtigen Krise werden diese Träume mehr denn je auf die Probe gestellt. Sozialen Unterschiede, über die das joviale “you” hinwegzutäuschen vermag, treten umso deutlicher hervor. Wer sind die Leute, die noch immer den Abfall abholen, die Pakete ausliefern, den Rasen in den Vorgärten mähen? In den Städten, liest man, steigt die Flut der Toten in armen und schwarzen Nachbarschaften wie nirgendwo sonst. Manche Kommentatoren, die zum schmeichelnden Hofstaat eines unfähigen Präsidenten mit Allmachtsfantasien gehören und das Offensichtliche nicht wahrhaben wollen, behaupten ohne den geringsten Beweis, die Betroffenen hätten es sich selbst zuzuschreiben, da sie sich nicht an die verordneten Massnahmen hielten. Die Wahrheit sieht etwas anders aus: Lange sträubte sich dieselbe Regierung – zuvorderst jener Präsident, der sich um nichts als seine Wahlchancen und den Gewinn seiner Firmen schert – die Kosten für die erforderlichen medizinischen Tests zu übernehmen. Noch dazu deckte seine Regierung die Krankenkassen, die gleichfalls von diesen Kosten nichts wissen wollen. Den Armen, von denen der Grossteil sich ohnehin keine Krankenversicherung leisten kann, und denjenigen Menschen, die seit Jahren langsam aus dem Mittelstand in die Unterschicht abrutschen und deren Gesundheitsversorgung davon abhängt, was von ihrer Versicherung bewilligt wird, bleibt nichts anderes übrig, als sich mehr schlecht als recht zu schützen, wenn sie ihre Jobs für den Minimalstundenlohn von $ 7.25 erledigen. Keiner weiss, wer das Virus in sich trägt und gerade dabei ist, alle seine Arbeitskollegen anzustecken.
Hier in Ithaca, auf halbem Weg zwischen New York City und Buffalo, zwischen Hügeln und Wäldern, Wasserfällen und Seen leben wir seit Wochen in einem seltsamen Schwebezustand. Die Cornell University, an der ich arbeite und die der grösste Arbeitgeber in dieser Kleinstadt ist, stellte im März, noch bevor die Regierung in Washington sich zu entsprechenden Empfehlungen durchringen konnte, den ganzen Lehr- und Forschungsbetrieb drei Wochen lang ein, um alle Lehrveranstaltungen auf ein Internetformat umzustellen. Das war für Professoren und Forscher eine Herausforderung, denn nicht jedes Seminar und jedes Labor kann ohne weiteres auf die unmittelbare Realität, die Anwesenheit der Studierenden und die Materialität der zu untersuchenden Gegenstände verzichten. Als Kulturwissenschaftler fiel mir das leichter als einer guten österreichischen Freundin, die hier als Astronomin arbeitet.
Die Läden und vielen Restaurants der Stadt blieben zunächst noch geöffnet. An einem der letzten Abende, an denen das gesellschaftliche Leben noch nicht zum Stillstand gekommen war, gingen meine Frau und ich mit unserem vierjährigen Sohn und unserem Hund in unser Lieblingsrestaurant essen. Es war gut gefüllt. Die Leute hielten ein wenig linkisch Abstand voneinander, denn man musste sich an diese neue Realität erst noch gewöhnen. Viele hatten Handseife dabei. Andere rannten alle paar Minuten auf die Toilette, um dort ihre Hände zu waschen. Es war ein heller, sonniger Abend, der schon den nahenden Frühling ankündigte. Man nahm alles gelassen und war sich noch nicht bewusst, was schon zwei Tage später auf uns zukommen würde.
Es ist schwierig zu den aktuellen Entwicklungen in Amerika etwas zu schreiben, das nicht schon am nächsten Tag von einer neuen, von höchster Stelle abgesegneten oder sogar initiierten Absurdität überholt wird. Lange hatte der Präsident die Krise bestritten und bagatellisiert, bis er schliesslich Mitte März einsehen musste, dass noch das vehementeste Leugnen, unterstützt von einem weit gespannten Propagandaapparat mit dem Fernsehsender Fox News und unzähligen Talk-Radio-Stationen sowie allen erdenklichen konspirativen Webseiten und anderen Internetformaten, am Ende die rasant ansteigende Anzahl von Infektionen und Todesfällen nicht ungeschehen machen kann. Der Präsident hält sich selbst für ein medizinisches Naturtalent, was er auf seine ausgezeichneten Erbanlagen und einen Onkel zurückführt, der am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) Professor für Ingenieurwissenschaft war und dessen Erfindungen für die Anwendung von Röntgenstrahlen und die Strahlentherapie wichtig waren. Der Präsident, der aufgrund dieser natürlichen Qualifikationen von sich behauptet, komplexe medizinische Probleme auf Anhieb intuitiv zu verstehen, versuchte darauf, sich als entschlossener Krisenmanager in Szene zu setzen. Auch hier sollte die unaufhörliche Wiederholung der immer gleichen Lügen – nämlich dass er als erster die Gefahr erkannt und sofort gehandelt habe – eine neue, alternative Wahrheit schaffen. Journalisten, die bei Pressekonferenzen des Weissen Hauses kritisch nachfragen, werden vom Präsidenten persönlich beschimpft und als moralisch fragwürdige Personen verunglimpft. In manchen Fällen wird ihnen kurzerhand die Akkreditierung entzogen – ein unerhörter Vorgang in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ich habe den Eindruck, dass man sich in Europa nicht im Klaren darüber ist, in welchem Masse die gegenwärtige Regierung demokratische Grundrechte und Institutionen in den letzten Jahren ausgehöhlt hat. Im Windschatten des Virus hat sich diese Tendenz noch gesteigert. Sie ist in mancher Hinsicht beängstigender als die eigentliche Pandemie.
In den Tagesnachrichten sieht man jetzt viele Menschen, die, angestachelt vom Präsidenten, gegen die von seiner eigenen Regierung angeordneten Massnahmen protestieren. Viele meiner akademischen Freunde sehen in ihnen nur rechts-konservative Fanatiker. Die gibt es, keine Frage. Allerdings sind bei diesen Demonstrationen auch viele dabei, die ihre Arbeitsstelle verloren haben, sei es auf Zeit oder permanent. Seit Beginn der Coronakrise sind bereits gut 22 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. Die “soup kitchens,” in denen Bedürftige etwas zu essen bekommen, melden Engpässe und diskutieren über die Möglichkeit, das Essen zu rationieren. Es ist absehbar, dass bald mehr Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können und Konkurs anmelden müssen als nach der Finanzkrise von 2008. Diese Menschen, die sich seit Jahrzehnten von der Regierung allein gelassen fühlen, haben keine Zeit, um lange auf einen noch fernen Aufschwung zu warten. Viele von ihnen wollen an ihren oft schlecht bezahlten Jobs festhalten, bei denen soziale Distanzierung kaum möglich ist. Vor die Wahl zwischen finanziellem Ruin und diffuser Corona-Gefahr gestellt, zögern sie nicht lange. Denn von höchster Stelle in Washington werden die Auswirkungen des Virus noch immer zum Nutzen der Wirtschaft heruntergespielt.
Unter den Transparenten und Plakaten der Demonstranten entdeckte ich eines, auf dem stand “Give me liberty or give me death!” Freiheit oder Leben. Das war die von Patrick Henry – er war einer der sogenannten founding fathers der amerikanischen Nation – ausgegebene Devise im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Man kann nicht sagen, dass diese Demonstranten, die einem sich despotisch gerierenden Präsidenten zujubeln, verstanden haben, worum es Patrick Henry gegangen war.
Ich sitze hier in Ithaca, arbeite weiter, so gut es mit einem vierjährigen Kind zuhause geht. Doch kann ich mich der schleichenden Melancholie nicht entziehen. Ich frage mich, was für eine Welt mit Covid-19 begonnen hat. Die Krise kam mit Ankündigung. SARS und MERS hatten wir schon, weitere Mutationen und Virusübertragungen über Artengrenzen hinweg sind vorhersehbar. Es wäre vermessen zu behaupten, dass unsere westliche Gesellschaftsordnung darauf eingestellt sei. Und zugleich wird im Moment deutlicher als vielleicht je zuvor, dass das demokratische Experiment Amerika am Abgrund steht. Der Gedanke macht mich schaudern.
Eine auffällige Sache ¬– vielleicht ein Hoffnungsschimmer – an der gegenwärtigen Krise: Sie ist nicht lokal, nicht begrenzt und auf absehbare Zeit auch nicht eingrenzbar. Was mich daran interessiert ist weniger die damit verbundene Gefahr, sondern die Tatsache, dass die Situation und die getroffenen Massnahmen an allen Ecken und Enden der Welt recht ähnlich sind. Die Posts von Bekannten in Neuseeland, die Berichte meiner Verwandten in Liechtenstein, meiner Freunde in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Japan und Brasilien gleichen sich. Es ist, als hätte die mehr oder weniger resolut vorangetriebene, letztlich unvermeidliche Vereinzelung jede und jeden aus ihren bisher stillschweigend vorausgesetzten sozialen Konstellationen herausgelöst und dabei zu einer Art chemischem Radikal gemacht, das sich rundherum als sehr bindungsfreudig erweist, wenn auch nur in virtuellen Medien, die das alles auf Distanz halten.
Wenn ich an meinem Schreibtisch lese, nachdenke und schreibe, schaue ich dazwischen oft hinaus in den Garten, wo die leuchtenden Frühlingsblumen schon langsam verblühen. Am Abend beobachte ich das Murmeltier, das nach ein paar Tagen Abwesenheit, während derer ich schon befürchtete, dass es von einem Nachbarn vertrieben oder in der Nacht von einem Kojoten geholt worden sei, zurückgekommen ist. Es lässt sich Zeit, schnuppert im Gras herum, um die saftigsten Blätter und Kräuter zu finden. Ab und zu setzt es sich auf die Hinterbeine und horcht. Wenn es etwas Ungewohntes hört, macht es sich schnell aus dem Staub. Später kommt es wieder, frisst weiter und trollt sich, wenn es genug hat. Ich schaue ihm gern zu. Ein Quantum Trost würde in meinem jetzigen Leben fehlen, wenn es nicht mehr käme.
Mit herzlichen Grüssen aus Ithaca, N.Y.,
Peter
Peter Gilgen (* 1963), Professor im Department of German Studies an der Cornell University in Ithaca, New York, hat u.a. zu Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann und Walter Benjamin veröffentlicht.
Für Cara Roberta. steht er im Briefwechsel mit der Vorarlberger Autorin Gabriele Bösch (* 1966).
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 6: Deine Frage …
weiter ...Lieber Christoph, deine Frage
Jeder von uns wird sich fragen müssen, ob es überhaupt etwas zu verteidigen gilt außer der eigenen Würde.
Darauf antworte ich dir mit einem entschiedenen Ja. Es gilt, die Würde des anderen, des nächsten zu verteidigen, damit die eigene Würde ihres moralischen Anspruchs würdig sei! Das ist Verfassungsgrundlage jeder demokratischen Gesellschaft.
Dem Virus ist das egal. Das einzig Offensichtliche, das es in dieser Geschichte gibt, ist, dass der Virus, wie wir ihn auch nennen wollen, keinerlei Rücksicht kennt, weder auf Anerkennung, noch auf Grenzen, welcher Art immer. Er greift uns alle gleichermaßen an, unterschiedslos welcher Kultur, Religion oder Politik wir angehören.
Den Vorzug aber gibt er den Alten. Ein Teil von ihnen ist gestorben, die Ärzte sagen, manchmal im Hauch eines Augenblicks. Man hat sie weggebracht in tausenden von Särgen. Wie wenn man zur vollen Reife den Löwenzahn anpustet und die Samen zigfach in der Luft zerstieben.
Dieses Mal sind die zerstobenen Samen die Generation, die weiß, was ein Krieg ist. Die mit der Kriegsrhetorik, wie sie in den vergangenen Wochen zum Vorschein gekommen ist, nicht einverstanden ist. Nicht genug, hier in Italien ist von Krieg die Rede, von Ärzten an der Front oder im Schützengraben. Es taucht auch wieder der Begriff Sündenbock auf. Doch dieser Feind hat kein Gesicht. Hätte er eins, wäre es das Lächeln meiner Töchter, das meiner Mutter.
Von Kampf sprechen ist angebracht. Die Ärzte mittendrin in einer Vielzahl von Notaufnahmen, behandeln sie dramatische Atemnöte, dirigieren das Gefühlsbarometer, während der Widersacher ihren eigenen Körper bewohnen könnte, wie auch meinen, während ich schreibe.
Nicht Krieg. Vielmehr die Gegensicht. In diesem Augenblick des trauernden Fortschritts gewähren wir uns eine Ordnung des Innehaltens. Es ruft die Fische und Vögel zurück, säubert die Flüsse und macht uns betroffen, aus Angst vor Verzweiflung und Verlust. In der geologischen Zeitrechnung sind wir wenige Minuten, in der Nacherzählung unserer Zeit aber wird dieser Hauch eines Augenblicks zählen.
Gleichwohl. Was mich im Augenblick beeindruckt, ist der Wille zum Gehorsam. Wie dieser als eine Pflicht respektvoller Unterwerfung ausgeübt wird, verursacht mir Unbehagen. Eine ungute Vorahnung. Wir gehorchten aus Angst, noch bevor die Maßnahmen und Regelungen in Kraft traten. Von einem Tag auf den anderen führte uns die Angst an, war Angst die ausübende Vorsitzende der Ausgangssperre. Wir sperrten uns zu Hause ein und protestierten nicht, wurden sogar zu Spitzeln und suchten nach denen, die zu wenig gehorchten.
Indessen singt Italien Bella ciao. Zeigt sich auf den Balkonen und an den Fenstern, schwenkt die Trikolore und singt Bella ciao. Die ganze Welt singt mittlerweile Bella ciao, es ist eine Allerweltshymne geworden, anwendbar auf jeden erdenklichen Umstand. Man sagt, dass man das Lied in den zwanzig Monaten des Partisanenkampfes nie singen gehört hat, es soll erst nachher geschrieben worden sein. Nichtsdestotrotz wird es als das Symbol des italienischen Widerstands angesehen, seine wenigen Worte gelten der Freiheit und dem Kampf gegen Diktaturen.
Dieser Chor aber, in den die Italiener einstimmten, ist konfus und huldigt einem rissigen Patriotismus, der in keinerlei Hinsicht einem berechtigten Stolz auf die eigenen Fähigkeiten entspricht: Größe und Kapazität werden in zurückhaltender Weise von jenen an den Tag gelegt, die ihre Pflicht tun und ihr Handeln unbeirrbar in den Dienst an der Gemeinschaft stellen.
Zuhause ereigneten sich Begegnungen und Einsamkeiten. Wird erduldet und aufgedeckt. Gibt es Armut und Gewalt. Lachen und Mitgefühl. Man hat sich geliebt, Kinder wurden geboren, es geschahen Selbstmorde und Morde. Der Löwenzahn. Griechisch taraxakos bedeutet ich heile, bin Heilmittel gegen Unausgeglichenheit. Er wächst im Grunde überall. Bei euch, Christoph, wird er gerade voll in Blüte stehen.
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Lettera 6: La tua domanda …
weiter ...Christoph caro, la tua domanda.
Ognuno di noi dovrà chiedersi se davvero c’è ancora altro da difendere tranne la propria dignità.
Ti rispondo di sì e con certezza. Difendere la dignità dell’altro, del prossimo, perché la dignità propria sia degna della sua nobiltà morale! È la base costitutiva di una società democratica.
Il virus di questo se ne frega. Se c’è una cosa lampante in questa storia, è che il virus di qualsivoglia nome, non ha alcun riguardo per nessun riconoscimento, per nessun genere di frontiera. Colpisce tutti e senza distinzione di culture, religioni e politiche.
Ha una preferenza per i vecchi invece. È morta una parte di loro, a volte dicono i medici, in un soffio. È stata portata via in migliaia di bare. Come quando a maturazione, si soffia il tarassaco e una moltitudine di semi si perde nell’aria.
I semi dispersi questa volta, sono la generazione che sa cos’è una guerra. Quella che non concorda con il linguaggio bellico che è insorto nelle settimane scorse. E ancora, qui in Italia si dice: guerra, i medici stanno al fronte, in trincea. È ricomparso il termine untore. Eppure questo nemico non ha volto. Se lo avesse sarebbe il sorriso delle mie figlie, quello di mia madre.
Dire lotta è dire bene. E i medici stanno dentro a una moltitudine di corsie di emergenza, curano respiri drammatici, l’intensità emotiva nelle loro mani. Mentre l’antagonista potrebbe abitare il loro stesso corpo, anche il mio mentre scrivo.
Non guerra. Per converso invece, in questo attimo dell’evoluzione in pianto, ci stiamo restituendo un ordine di quiete che richiama i pesci e gli uccelli, pulisce le correnti e ci commuove per smarrimento e sconcerto. Sull’orologio geologico siamo pochi minuti, nella conta dei nostri secoli si racconterà questo istante di tempo.
Ebbene, in questo istante del tempo, a me impressiona l’ubbidienza. Mi provoca turbamento l’ubbidienza esercitata come un dovere di rispettosa sottomissione. È un terribile sapersi questo. Abbiamo ubbidito per timore, prima ancora delle disposizioni e dei regolamenti imposti. Da un giorno all’altro la paura è stata la nostra guida, ha presieduto la segregazione a funzione direttiva. Ci siamo chiusi in casa e non abbiamo protestato, diventando addirittura delatori in cerca di chi non ubbidiva assai.
E l’Italia canta Bella ciao. Si presenta sui balconi e alle finestre, sventola il Tricolore e canta Bella ciao. Tutto il mondo ormai canta Bella ciao, è diventato un inno pop, variato secondo i criteri del momento. Nei venti mesi della guerra partigiana, sembra non si sia mai sentito cantare Bella ciao, dicono sia stata scritta dopo. Ciononostante è considerata il simbolo della Resistenza italiana e le sue poche parole sono affidate alla libertà, alla lotta contro le dittature.
Ma è diventato un coro confuso, per il quale gli italiani si sono riuniti, tirando fuori un patriottismo lacero, che non corrisponde in nessun modo ad un giustificato orgoglio delle proprie capacità: volumi e levature che si esprimono in maniera pudica attraverso i molti che fanno il proprio dovere e agiscono con rigore assoluto a favore della collettività.
Dentro casa sono successi incontri e solitudini. Sopportazione e scoperte. La miseria e la violenza. Il sorriso e la commozione. Si è fatto all’amore, sono nati figli e ci sono stati i suicidi e gli omicidi. Il tarassaco. Taraxakos in greco significa io guarisco, sono il rimedio agli squilibri. Cresce praticamente ovunque. Da voi Christoph, ora sarà in pieno fiore.
Roberta
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Yannic Han Biao Federer & Verena Rossbacher
Brief 1: Die Eisdiele war geschlossen …
weiter ...17.4.2020
Verena,
die Eisdiele war geschlossen, aber das lag am Wetter, jetzt hat sie geöffnet, trotz Corona. Innen ist es dunkel, man muss genau hinsehen, dann erkennt man den Verkäufer im karierten Hemd, er trägt blaue Handschuhe aus Gummi, schält Kugeln aus den gekühlten Behältern, ein unendlich schmaler Junge steht vor dem Glas, zeigt mit dem Finger auf die Sorten. Als er fort ist, tritt der Verkäufer hinaus in die Sonne, schaut sich um, stemmt die Hände in die Hüften. Gegenüber schlendert eine Frau im Schatten der Gebäude, allein, in ihrer Linken ein üppiger Strauß Tulpen, der Blumenladen hat geöffnet, der Buchhändler nicht.
An der Baustelle rührt sich nichts mehr. Kürzlich noch riesige, spinnenartige Maschinen, die sich am Hang zu schaffen machten, ihn zurechtbaggerten, glatt walzten, dann mit Beton bespritzten, aus einer Düse, die ein Bagger am senkrecht erhobenen Arm in die umgegrabene Böschung richtete. Irgendwann fiepende Lastwagen, die vorgegossene Bauteile lieferten, ein Schwerlastkran hievte sie in die Vertiefungen, die offenbar für sie angelegt worden waren, wie hohle Zähne stehen sie nun im Gefälle, verlassen.
Ich erinnere mich an die Frau, die mich ansah, irritiert, verstört beinah, als ich stehenblieb, um sie passieren zu lassen, um Abstand zu halten, aber sie verstand nicht, betrachtete mich wie ein eigenartiges Ungeheuer, trippelte langsam an mir vorbei, ohne mich aus den Augen zu lassen, blickte sich noch mehrfach um, wie sie sich entfernte. Einmal auch ein Läufer im Wald, ich ging zur Seite, trat sogar ins Gestrüpp, und er lachte, rief mir nach, so dick bin ich nicht.
Inzwischen die ersten maskierten Menschen auf der Straße. Ein Mann mit Sauerstoffflasche in der Rollatortasche, ein Schlauch führt ihm zur Nase, langsam schiebt er das Gestell über den Gehweg, blickt zu mir auf, als ich vorbeikomme, ängstlich fast, er zieht an den Bremsen, die an den Haltegriffen sitzen, dabei gehe ich schon einen weiten Bogen, ich kann ihn verstehen.
So ist es hier, Verena. Wie ist es dort?
Yannic
Yannic Han Biao Federer (* 1986), aufgewachsen in Südbaden, lebt als freier Autor bei Köln. Er erhielt u.a. den Harder Literaturpreis 2018 und den 3sat-Preis 2019.
Seine Briefpartnerin Verena Rossbacher (* 1979) lebt nach Stationen in Österreich und der Schweiz mittlerweile in Berlin.

Quelle: literatur:vorarlberg netzwerk
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 5: Wer bei uns zurzeit auf die in diesem Ausmaß noch nie dagewesene Frequentierung der Fahrrad- und Flanierwege schaut …
weiter ...Liebe Roberta.
Wer bei uns zurzeit auf die in diesem Ausmaß noch nie dagewesene Frequentierung der Fahrrad- und Flanierwege schaut, der könnte meinen, wir lebten nicht in einer Krise, sondern es sei zu einer tiefgreifenden ökosozialen Steuerreform gekommen. Der Unterschied zwischen Ausgangssperre und -beschränkung ist folglich ein gewichtiger. Die Einschnitte sind zwar drastisch, allerdings nicht vergleichbar mit jenen, die bei euch vorgenommen wurden. Dass die Maßnahmen zum Großteil mitgetragen werden von einer nicht kleinzuredenden Solidarität in Form von Nachbarschaftshilfen oder der Unterstützung regionaler Händler, steht dabei außer Frage. Aber in gewisser Hinsicht handelt es sich eben doch um eine verordnete Solidarität, die – endet der eigene Gesichtskreis am vielzitierten Tellerrand – nicht unter dem Eindruck von solchen Schreckensbildern steht, wie wir sie aus anderen Ländern kennen. Es könnte also eine Solidarität auf Zeit sein. Außerdem haben wir erlebt, wie schnell auch eine verordnete Ent-Solidarisierung greift, als Beispiel sei hier die mantragleiche, mit dem Brustton der Verleugnung vorgetragene Erzählung von der Schließung der Balkanroute genannt, deren Notwendigkeit nur sehr bedingt infrage gestellt wurde. Die Folgen sind bekannt.
Dieses Wir, es könnte – auch buchstäblich – seine Grenzen haben. Was wenn, und das scheint mir nicht denkunmöglich, aus einem „Wir zuerst“ ein „Jetzt erst recht wir zuerst“ wird? Denn beteiligen sich nicht alle, wirklich alle, gemäß ihren Möglichkeiten an der Bewältigung der gegenwärtigen Situation und deren Folgen, dann wird es zu einer dramatischen Verantwortungsverschiebung nach unten auf die Schultern der Schwächsten kommen und damit möglicherweise zu einer Lebensrealität, welche die Bilder aus dem Mittelmeer, aus Moria und Idlib noch leichter vergessen macht. Die Ankündigung bestimmter milliardenschwerer Großunternehmen beispielsweise (die zwar bei einer solchen geblieben ist, aber eben doch ein scharf konturiertes Unsittenbild entwirft), aufgrund vorübergehender Filialschließungen keine Miete mehr bezahlen zu wollen, spricht dabei eine Sprache, deren Vokabular nicht jenes eines allumfassenden Schulterschlusses ist.
Fraglos wird es aber auch, wie du bereits erwähnt hast, einer Entledigung dieses unsäglichen Feigenblattes namens „Werte“ bedürfen, deren im Zuge der ersten großen Flüchtlingsbewegung vor ein paar Jahren so zäh und großmaulig beschworene Verteidigung bis zu einem bestimmten Grad auch in der Verwechslung von moralischen mit materiellen Werten gründete. Jeder von uns wird sich fragen müssen, ob es überhaupt etwas zu verteidigen gilt außer der eigenen Würde.
Nur das Beste,
Christoph
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 4: Unter seinen vielen guten Eigenschaften besitzt der Mensch auch die angeborene Eigenschaft …
weiter ...Lieber Christoph,
unter seinen vielen guten Eigenschaften besitzt der Mensch auch die angeborene Fähigkeit, schnell zu vergessen. Trotzdem glaube ich, dass die Wertehierarchie tiefgreifende Veränderungen erfahren wird. Nehmen wir das Pronomen wir zum Beispiel. Es wird sich die Frage gefallen lassen müssen, was ich und du, gemeinsam und in gleichem Maß bedeutet. Für ein wir zuerst werden wir keine Rechtfertigungen und Entschuldigungen mehr vorschützen können. So wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben und damit eine der größten menschlichen und politischen Katastrophen seit Beginn des 21. Jahrhunderts verdrängt haben. Krieg und Unterdrückung, Elend oder einfach der Wunsch nach einem besseren Leben sind Realitäten, die in der Zwischenzeit nicht verschwunden sind. Es werden noch mehr Migranten gezwungen sein, ihr Leben auf gefährlichen und beschwerlichen Reisen zu riskieren. Wohin? Um wieder an unserer Zurückweisung, an unserer Gleichgültigkeit aufzulaufen? Für Solidarität waren wir bis gestern nur halbherzig bereit und begegneten jedem Hilferuf mit einem neuen Fragezeichen, heute, in dieser Zeit der Epidemie, erfahren wir sie im gesamten Ausmaß ihrer Bedeutung, weil sie dringend notwendig ist und wir also bereit sind, die Verordnung und die Verantwortung zu teilen.
In der unmittelbaren Zukunft wird erneut an unsere Solidarität appelliert werden. Von Seiten derjenigen, die weder Europäer noch weiß sind und andere Sitten und Gebräuche haben. Darauf antwortend werden wir nicht mehr so tun können, als hätten wir dieses besondere Gut nicht am eigenen Leib erfahren. Die gegenseitige Unterstützung im Bewusstsein des Allgemeinwohls findet nämlich jetzt gerade statt und es ist fast nicht zu glauben, wie schnell Pflicht und Vermögen assimiliert wurden. Italien geeint in seinem dolce vita und in der Übertretung der Regeln ist in wenigen Tagen zu einer disziplinierten, sich für das Gemeinwohl aufopfernden Gemeinschaft geworden.
Ich glaube, dass diese Notsituation, die wir nie, niemals für möglich gehalten hätten, uns gerade erkennen lässt, welche besonderen Qualitäten das Pronomen wir enthält. Und zwar, dass wir die Fähigkeit besitzen, die obsessive Nabelschau der sogenannten „Werte“ zu überwinden – eine Geisteshaltung, die einem Gegenüber sofort das Schutzschild zeigt, sich abschottet und damit jede Chance auf Veränderung und Wandel verhindert.
Bewusst wurde uns diese Fähigkeit in der gemeinsamen Gefahr, die dieses Mal an unsere Tür geklopft hat. Außer Gefahr wird sie sich wieder in einem Gemenge aus Individualitäten verfangen und sich im Nebulösen verlieren, das zunehmen wird je größer das Gefühl der wiedererlangten Freude sein wird. Bleiben aber wird das Gewissen und in unseren Erzählungen des gemeinsam Erlebten zum Ausdruck kommen. Entlang zukünftiger Entscheidungen werden wir den Widerhall dieses Bewusstsein hören, von uns als einzelne Individuen und in Beziehung zur äußeren Welt.
Du hast Recht, wenn du sagst, dass das Himmelschlüssel schön anzuschauen ist. Der deutsche Name entspricht nicht dem italienischen, der die Blume als primula, als die Erste nämlich bezeichnet. Schau an, im Ladinischen, meiner Muttersprache, nennen wir sie sogar tle de San Pire, Petrusschlüssel und räumen ihr mithin das Vorrecht ein, das Paradies zu öffnen.
Das Paradies gibt es nicht. Und der Heilige Petrus besitzt auch nicht die Schlüssel dazu. Gemeinsam betrachtet aber ist auch diese Geste des Toröffnens schön anzuschauen, für die anderen, aber auch für uns, die wir uns mittlerweile in der fünften Woche des Hausarrests befinden.
Ich schrieb dir diesen Brief vor ein paar Tagen, Christoph. Als ich ihn heute abschicken wollte, lese ich von einem Schiffsunglück im Mittelmeer. Vor wenigen Stunden ist eines der vier überfüllten Flüchtlingsboote, von denen man seit Tagen wusste, gekentert. Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Wir haben sie sterben lassen, am Tag des Osterfestes.
Ich möchte diese traurige Nachricht meinen Überlegungen hinzufügen und dich auch wissen lassen, dass ich in diesem Moment ohne Aussicht schreibe. Ich neige gewöhnlich zur Zuversicht, diesen Brief jedoch beende ich in einem Gefühl tiefen Scheiterns.
13IV2020
Übersetzung: Alma Vallazza
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Lettera 4: L’essere umano ha molte qualità e conserva dentro di sé anche una predisposizione a dimenticare in fretta …
weiter ...Caro Christoph.
L’essere umano ha molte qualità e conserva dentro di sé anche una predisposizione a dimenticare in fretta, ciononostante credo che la gerarchia dei valori presenterà dei rovesciamenti. Il pronome noi ad esempio, dovrà far fronte a cosa significa dire tu e io, insieme e in uguale misura. Non avremo più giustificazioni e discolpe da poter esibire per dire: prima noi. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, respingendo una delle più gravi emergenze umanitarie e politiche dall’inizio del ventunesimo secolo. Le guerre e la repressione, la miseria o il semplice desiderio di una vita migliore, tutte realtà che non sono scomparse nel frattempo. Ecco, esse spingeranno ancora più migranti a mettere a rischio la propria vita in viaggi pericolosi e difficili. Per dove? Per approdare ancora al nostro rifiuto e alla nostra indifferenza? La solidarietà, quella che fino a ieri abbiamo dato solo in parte, ponendo continuamente il punto di domanda ad ogni richiesta di aiuto, oggi in questo tempo di epidemia la stiamo conoscendo nel suo pieno significato, per necessità urgente e condivisione del proponimento e della responsabilità.
Ritornerà nel futuro prossimo una nuova richiesta di solidarietà. Da chi non sarà europeo, da chi non sarà bianco e avrà altri usi e costumi. Nella risposta che daremo loro, non potremo fingere di non avere avuto conoscenza diretta attraverso l’uso e la pratica, di questa qualità. Perché ora, il rapporto di reciproco sostegno nella coscienza dei comuni interessi sta succedendo ed è inverosimile quanto sia stata veloce l’assimilazione del dovere e del volere. L’Italia congiunta alla dolcezza della sua vita e all’evasione delle regole, è diventata in pochi giorni una comunità disciplinata e pronta al sacrificio per il bene collettivo.
Io credo che questa emergenza che mai, mai avremmo pensato possibile, ci stia proponendo una virtù del pronome noi. Ci sta dimostrando che esiste la capacità di superare l’ossessione identitaria dei cosiddetti “valori”. Quella che alza lo scudo di protezione e crea la barriera, prima di tutto mentale, nei confronti degli altri e che impedisce qualsiasi possibilità di mutamento e di trasformazione.
È una capacità della quale ci stiamo accorgendo nell’insieme del pericolo che questa volta ha bussato alla nostra porta. Fuori dal pericolo, si complicherà di nuovo in un ammasso di individualità e si perderà nel dimenticatoio che tenderemo ad alimentare col sentimento della gioia ritrovata. Ma rimarrà la coscienza, quella che tireremo fuori nel racconto e nelle emozioni vissute insieme e a lato delle volontà future sentiremo il riverbero della consapevolezza, di noi singoli individui e del mondo esterno con cui saremo in rapporto.
Hai ragione a dire che la primula è un bel vedere. Himmelschlüssel, chiave del cielo, il suo nome in tedesco non equivale a quello italiano che nomina questo fiore come primo, primula appunto. Vedi, in ladino, nella mia lingua madre lo chiamiamo addirittura tle de San Pire, la chiave di San Pietro, riconoscendogli la prerogativa di apertura al paradiso.
Non c’è il paradiso. E San Pietro non ha le chiavi per entrarci. Nell’immaginazione collettiva è però un bel vedere anche questo gesto dell’aprire il portone. Agli altri, ma anche a noi qui e ora, che ormai siamo alla quinta settimana di segregazione in casa.
Ho scritto questa lettera pochi giorni fa, oggi prima di spedirti la mia risposta Christoph, leggo di un naufragio nel Mediterraneo. Nelle scorse ore uno dei quattro barconi pieni di migranti, dei quali si sapeva da giorni, si è rovesciato causando la morte di decine di persone. Li abbiamo lasciati morire nel giorno di Pasqua.
Voglio aggiungere alla mia riflessione questa triste notizia, e farti sapere anche che in questo momento ti sto scrivendo a vuoto. Tendo ad avere sempre un sentimento di aspettazione fiduciosa, concludo questa lettera invece, con un senso profondo di fallimento.
13IV2020

Quelle: literatur:vorarlberg netzwerk
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 3: Nicht nur die Schachtelhalme wachsen …
weiter ...Liebe Roberta.
Nicht nur die Schachtelhalme wachsen, auch die Himmelschlüssel stehen in Blüte. Was für ein Wort. Die Himmelschlüssel als Türöffner, wenn man so will, nach und nach zerfasern die Wolkenbruchlinien, zeitgeraffte vereinzelte Spaltenbildungen wie auf einer Gletscherzunge, bis die Decke endlich bricht und sich ein weites dunstiges Blau zeigt als ein von abgesonderten Cirrusgruppen durchweidetes Hochplateau. Derselbe Himmel wie vor jahrundjahr und doch ein anderer. Eine Fremdheit. Etwas ist im Begriff, sich zu verändern, wenn ich mir auch nicht sicher bin, ob die Auswirkungen, von denen du sprichst, für uns alle die gleichen sind. Zudem kann ich nicht sagen, ob wir die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit unserer Wertehierarchie in jenem Später, von dem wir jetzt nicht mehr wissen, als dass es einmal sein wird, noch als solche erkennen werden. Wünschenswert wäre es, so recht daran glauben kann ich nicht. Für den Moment jedenfalls. Das ganze mich umgebende Land, das mir zurzeit auf so seltsame Weise ungeläufig ist, ist ein in Stein und Holz und Erde gebanntes Gedächtnis, das nicht vergisst. Der Mensch dagegen vergisst so schnell. Die Systemerhalter werden sich vermutlich wieder Gehör verschaffen, die Fortschrittsgutgläubigen, die Zyniker. Bereits jetzt sind bei uns Stimmen zu vernehmen, die den entstandenen wirtschaftlichen Schaden in Relation setzen zu den Menschenleben, die durch die ergriffenen Maßnahmen gerettet wurden. Eine Waage, die nicht nur einfach unmöglich austariert sein kann, sondern gar nicht existieren dürfte.
Die Himmelschlüssel sind schön anzuschauen. Diese weithin sichtbaren Frühblüher. Nach einer kurzen, aber heftigen Kälterückkehr, mit teilweise tieferen Temperaturen als während des gesamten Winters, hat sich der Frühling durchgesetzt, er ist über uns hereingebrochen, mit einer ähnlichen Plötzlichkeit wie die gegenwärtige Krise. Und er ist gekommen, um vorerst zu bleiben – die schon jetzt große Trockenheit könnte für die Bauern zum Problem werden. Auch damit werden wir uns also beschäftigen müssen: Die Herausforderungen in jenem Später werden nicht weniger werden. Aber vielleicht zeigt uns die momentane Situation gerade, was mit dem nötigen politischen Willen alles möglich ist. Vielleicht.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.
Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 2: Wie wir uns hier begegnen …
weiter ...Lieber Christoph, wie wir uns hier begegnen, ist ziemlich einzigartig.
Wir haben die Gelegenheit, aus dieser Begegnung ein Näherkommen in der Zeit, eine Zusammenführung von Sprachen zu machen. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass es sich wie eine Verantwortung anfühlt, unsere Verantwortung, diesen besonderen Augenblick zu interpretieren.
Schön, dass sich die Kommunikationswege wieder des Briefeschreibens besinnen und unsere Beobachtungen, unsere Überlegungen auf diese Weise ineinander übergehen und in der Dichte der Wahrnehmungen zusammenfließen können. In unserem Kleinen denke ich, wird es uns gelingen.
Du erzählst von den ersten Landschaften, die vor deinem Fenster auftauchen. Den Schachtelhalm, den du erwähnst, werde ich in meinem gewohnten Waldstück erst in zwei Monaten sehen. Davon abgesehen scheint diese Zeit jetzt in ihren Auswirkungen für uns alle gleich.
Ich gehe. Noch mehr als sonst gleicht der Wald einem Ort aus alter Zeit, viel Schnee und kaum Huflattich rundum, solcherart ist hier die Einsamkeit im Frühling, sobald der Winter Zeichen gibt, sich zu verabschieden. Sehr viel später zeigt sich der Frühling in den hiesigen Bergen in einer Pracht aus Farben und ist schön anzusehen. Ich schaue, beobachte und warte, bis diese neue Stille ihr ganzes dramatisches Ausmaß zeigt, damit ich, währenddessen, nachher, wenn überhaupt, davon erzählen werde können mit eigenen Gedanken.
Ich bin in meinem Schreiben immer von einer Mehrzahl von Stille ausgegangen. Nun hat sich diese Mehrheit vereinigt, bildet eine Einheit, ist gleichförmig, solidarisch geworden. Steht in Übereinstimmung mit dem Gesamt des Denkens, Fühlens oder Handelns. Es gefällt mir nicht, ich ertrage es, es ist überall dermaßen gleich, dass es mir zuwider ist. Es entspricht dem Zustand eines respektvollen Beobachtens im Stillstand. Einem stummen Geflüster, das zu Schweigen gebietet.
Du schreibst, „Italien als tragische Blaupause”. Mit der Tragik des Moments bin ich einverstanden, allerdings nicht mit der Tatsache, dass es zum Modell gestempelt wird. Noch vor wenigen Wochen hat man rund um Italien, das damit beschäftigt war, den Virus zu bekämpfen, die Grenzen hochgezogen. Und erst sehr langsam, zu langsam haben dann die anderen Staaten begonnen, jeder auf seine Art auf die Epidemie zu reagieren. Niemand hat dabei den Fall Italien bedacht, dieses arme Land, das als erstes verstehen musste, worauf es gerade zusteuerte.
Später ja, in der Zeit danach. Werden wir wohl alle und ohne Modell mit der gleichen existentiellen Frage konfrontiert sein. Diese plötzliche Wiederherstellung von Einheit, die gemeinsame Isolation, die einen einheitlichen Organismus in Gang setzte, hat uns zu einem Notfallpatriotismus gebracht und aus mir und dir ein wir gemacht. Ein wir, das uns dazu veranlassen wird, uns im Inneren, im Inneren der Wertehierarchie auseinander zu setzen.
Bis bald, Roberta
Roberta Dapunt (*1970), Bäuerin und Lyrikerin, lebt und arbeitet auf dem Bauernhof ihrer Familie im Gadertal in Südtirol. Sie schreibt auf Italienisch und Ladinisch, der rätoromanischen Sprache ihrer Heimat. Nächste Veröffentlichung beim Folio Verlag: «die krankheit wunder, le beatitudini della malattia» (September 2020).
Ihr Briefpartner ist der Vorarlberger Autor Christoph Linher. Roberta Dapunts Briefe werden von Alma Vallazza ins Deutsche übersetzt.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.

Un epistolario tra sconosciuti. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Primera lettera / Lettera 2: È un’incontro al quanto singolare il nostro …
weiter ...Caro Christoph, è un’incontro al quanto singolare il nostro.
Nella sua qualità possiamo farlo diventare un avvicinamento nel tempo, una congiuntura di lingue. Mi sembra di poter aggiungere anche, che la sensazione è quella di una nostra responsabilità di interpretazione di questo momento così particolare.
Ecco allora che le vie di comunicazione ritornano all’epistolario, le nostre osservazioni, le considerazioni che confluiscono l’una nell’altra nella profondità delle sensazioni. Nel nostro piccolo io credo, ci riusciremo.
Così tu mi racconti di primi paesaggi appena fuori dalla finestra. L’equiseto di cui tu mi parli, lo vedrò appena tra due mesi, nel bosco che frequento, seppure questo tempo ora, sia così uguale nelle sue misure e per ognuno di noi. Sta in una sospensione dell’esterno succedere.
Cammino. Il bosco sembra ancora di più un luogo remoto, molta neve e pochi farfari intorno, sono solitudini primaverili quando l’inverno qui dà prova di andarsene. Se i farfari si presentano è tempo. Molto più tardi la primavera alpina presenterà un tripudio di colori e sarà un bel vedere. Guardo, osservo e lascio che il silenzio nuovo di ora si mostri nella sua drammatica totalità, al fine di poterlo raccontare nelle mie riflessioni, nel frattempo, dopo e forse.
Sono sempre partita da un plurale di silenzio, ogni volta che l’ho preso in considerazione per un componimento. Ora si è unito, costituisce un insieme, è diventato omogeneo, solidale. Sta in concordanza con l’intero modo di pensare, di sentire o di agire. Non mi piace, lo subisco, è così uguale dappertutto che mi è diventato avverso, perché si presenta unicamente in qualità di una rispettosa osservanza. Un sibilo sordo che intima il tacere.
Mi scrivi, l’Italia, un modello tragico, in tedesco “Italien als tragische Blaupause”. Concordo sulla tragicità del momento, non invece sul fatto che sia stata presa a modello. Poche settimane fa, intorno all’Italia impegnata a combattere il virus si sollevava una cortina di ferro, mentre ogni altro governo, lentamente, troppo lentamente rispondeva in modo diverso all’epidemia, senza prendere d’esempio questa povera terra che ha prima dovuto capire con cosa si sarebbe confrontata.
Dopo invece, nel tempo successivo. Saremo posti, tutti quanti e senza alcun modello, di fronte ad una domanda esistenziale unica. Questa rigenerazione improvvisa dell’unità, l’isolamento collettivo che ha messo in moto un organismo unico, ci hanno portati ad un patriottismo di urgenza, facendo di me e di te un noi che ci metterà a confronto dentro, lì dentro nella gerarchia dei valori.
A presto, Roberta.

Ein Briefwechsel zwischen Unbekannten. Christoph Linher & Roberta Dapunt
Brief 1: Ein literarisches Blinddate …
weiter ...Liebe Roberta.
Ein literarisches Blinddate also. Ohne jeden Hintergedanken. Obwohl. Sind Hintergedanken nicht notwendiger denn je? Geistige Winkelzüge, Notausgänge aus diesem Gedankenkorridor, in dessen Fluchtpunkt zur Stunde nur gelegentlich Lichtreflexe aufscheinen? Ich denke da auch an eine Art Restlichtverstärker. Schaue mit Katzenaugen in das Rieseln hinter der Scheibe, in das dichte, zartstoffliche Schneerieseln hinter dem Fensterglas, und kann: Ich kann ein Leuchten sehen. Fühle mich erinnert an das körnige Bildrauschen alter Fernsehapparate, das immer auch ein Bruchteil der kosmischen Hintergrundstrahlung in sich trägt. Spuren des allerersten Lichts. Und tatsächlich: Bereits am nächsten Tag klart es auf, bald schon ist der Himmel wolkenlos und weit, wenn auch unfassbar wie vielleicht noch nie. An den Büschen hinterm Haus hängt der letzte Morgenfrost als brüchiges Weiß. Vor dem Haus Tau auf dem Beikraut bis weit in den Tag hinein, gierig silbern schimmernd, schillernde Leuchtdioden, ein Sternenfall. Dazwischen ein ellenlanger Schachtelhalm, dessen in der Mittagssonne erzeugter Schattenwurf in jene Richtung weist, in welcher der Bahnhof liegt. Eine Station, an der bis auf Weiteres kein Zug mehr hält. Und wieder biegt das Denken ein in den nämlichen Korridor. Seit vergangener Woche, musst du wissen, sind Teile unserer Ortschaft abgeriegelt, wir sind – wie man so sagt – von der Außenwelt abgeschottet. Sperren, nicht nur an den Zubringerstraßen, sondern auch an Forstwegen, Radstrecken, Brücken. Beidseits des Sperrgitters an der Brücke über den Grenzfluss treffen sich gelegentlich Jugendliche, reden, reichen sich Gegenstände durch das Gitter, schweigen, rauchen, bis eine vorbeifahrende Streife die Gruppe zerschlägt und nichts bleibt als das Nachtönen der Schritte im Klangraum der gedeckten Holzbrücke und eine schwach glimmende Zigarettenkippe auf dem grauen Asphalt davor. Dort, wo sie nicht durch die Bahntrasse, die Straßenführung oder den Lauf des Flusses vorgegeben ist, lassen die Grenzziehungen an willkürliche Demarkationslinien denken, als befänden wir uns in einer Nachkriegszeit, in einer am berühmten Reißbrett geteilten Weltgegend. Aber wem erzähl ich das? – Italien als tragische Blaupause. Du wirst es vermutlich nicht wissen, aber italienische Verhältnisse sind bei uns das Reizwort schlechthin in diesen Tagen. Als könnte darunter etwas anderes verstanden werden als il dolce far niente! Es kann. Aber darüber wirst du besser zu berichten wissen.
Ein Gruß aus V und nur das Beste,
Christoph
Christoph Linher (*1983) lebt und arbeitet als Autor und Musiker in Vorarlberg. Er hat 2015 den Vorarlberger Literaturpreis erhalten. Zuletzt bei Müry Salzmann erschienen: „Farn» (2016) und „Ungemach“ (2017).
Seine Briefpartnerin ist die Südtiroler Lyrikerin Roberta Dapunt (*1970). Christoph Linhers Briefe werden für sie von Werner Menapace ins Italienische übersetzt.
Cara Roberta. ist ein Kooperationsprojekt von literatur:vorarlberg netzwerk, Literaturhaus Liechtenstein, der Südtiroler Autorinnen- und Autoren-Vereinigung und Literaturhaus & Bibliothek Wyborada.